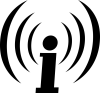Früher waren die Fronten klar: links die Demonstranten, rechts Staatsgewalt und Bürgertum. Aber seit auch CDU-Wähler gegen Bahnhöfe und Atomkraft protestieren, haben die Polizisten nur noch Gegner. Und in zwei Tagen ist der 1. Mai.
Manchmal wirft sogar jemand Urinbeutel
nach ihnen. Sie werden bespuckt. Geschubst. Getreten. Geschlagen.
Beschimpft sowieso, als »Schwein« oder mit: »Hopp, hopp, hopp –
Schweinchen im Galopp«. Olaf Heinze und Sven Kaiser kennen das alles, es
gehört zu ihrem täglichen Geschäft. Sie sind Beamte der Berliner
Bereitschaftspolizei.
Ihr Job ist es dazwischenzugehen, wenn sich
Hooligans prügeln oder Hells Angels oder arabische Großfamilien. Sie
selbst sagen, sie seien so etwas wie die Feuerwehr der Polizei, sie
rücken an, wenn es den Streifenbeamten zu heiß wird. Ihre echten Namen
möchten sie nicht in der Zeitung lesen, aus Angst um ihre Familien und
sich selbst. Bei Demonstrationen stehen sie in der ersten Reihe, mit
Schutzhelm und 18 Kilo Brust-, Schienbein- und Ellenbogenpanzer am
Körper. Sie sehen dann ziemlich martialisch aus, eher wie Soldaten als
wie Wachtmeister. Aber Olaf Heinze und Sven Kaiser sagen, es muss sein,
schließlich würden sie reichlich mit »Steinen und Flaschen eingedeckt«.
Olaf Heinze hat es vergangenes Jahr im Juni so schwer erwischt, dass er
sich in den Innendienst versetzen ließ: Auf einer Demonstration gegen
die Sozialpolitik der Bundesregierung hatte es Rangeleien mit dem
»relevanten Block« gegeben, wie Polizisten die Autonomen nennen. Sie
waren gerade in die Torstraße eingebogen, irgendjemand hatte dort eine
schwarz-rot-goldene Fahne an seinen Balkon gehängt. Die Demonstranten
riefen: »Nie wieder Deutschland«. Dann explodierte ein Böller, und Olaf
Heinze bekam den Auftrag, den relevanten Block nun »eng zu begleiten«.
Die Autonomen schubsten und drängten, die Polizisten schubsten und
drängten. So, wie es immer ist. Dann landete plötzlich ein rauchender,
tennisballgroßer Gegenstand zwischen Olaf Heinzes Beinen. Piff, paff –
und zwei Sekunden später machte es: buumm! Die Zeitungen schrieben
damals tagelang von einem »Bombenanschlag« und einem »Comeback des
linken Terrors«, aber es war wohl ein aufgemotzter Böller, der da
explodierte.
Die Wunden an seinen Beinen hat Olaf Heinze
mit der Handykamera dokumentiert: Risse, Verbrennungen und Splitter,
die ins Fleisch geschossen sind. »Der eine saß acht Zentimeter tief«,
sagt er und zeigt auf sein Handy. In dem American-Football-Trikot, das
er trägt, wirkt der 48-jährige, drahtige Mann noch etwas fremd in seinem
neuen Büro.
Sein Kollege Sven Kaiser, 42 und einen Kopf
größer als Heinze, war beim letzten Castor-Einsatz dabei, als 50 000
Menschen im November im Wendland tagelang die Züge mit den
Atommüllbehältern aufhielten. Kaisers erste Schicht dauerte 24 Stunden,
die meiste Zeit in der Kälte am Gleis. Dann sollten sie schlafen, in
einer Turnhalle mit hundert anderen. Vor der Tür landete alle paar
Minuten ein Hubschrauber. Dann wieder raus in den Wald, 15 Stunden, ohne
Toiletten. »Die Demonstranten haben uns beim Pullern gefilmt«, erzählt
er.
Wer Sven Kaiser und Olaf Heinze eine Weile
zuhört, möchte vor allem eins: kein Polizist sein. Und der Job wird
immer gefährlicher, sagen Wissenschaftler des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen. Sie haben vor Kurzem eine Studie
veröffentlicht, Ergebnis: 90 Prozent der bundesweit rund 21 000
befragten Polizisten wurden im Laufe eines Jahres mehrmals beleidigt
oder bedroht, jeder zweite wurde gestoßen oder geschubst, jeder vierte
geschlagen oder getreten. Besonders stark zugenommen haben die schweren
Verletzungen, nach denen Polizeibeamte mindestens sieben Tage
dienstunfähig waren – im Vergleich von 2005 bis 2009 um gut 60 Prozent.
Viele Polizisten fühlen sich als »Prügelknaben der Nation«, so das Fazit
der Forscher, und besonders bei Demonstrationen haben Polizeibeamte das
Gefühl, ausbaden zu müssen, was die Politik versäumt hat.
Passend dazu hat im April der neue Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich eine Untersuchung zur Entwicklung politisch motivierter Kriminalität
vorgelegt. Auch darin wird die Gewalt gegen Polizisten thematisiert:
wurden 2009 rund 2200 Straftaten gezählt, bei denen Polizisten verletzt
oder deren Autos oder Reviere demoliert worden sind, waren es 2010 fast
2900 – also ein Drittel mehr, was vor allem daran liegt, dass es
vergangenes Jahr so viele große Demonstrationen gegeben hat.
Der Vorsitzende der Deutschen
Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, wollte nach dem Castor-Einsatz sogar
einen Bundesligaspieltag absagen, weil seine Kollegen ausgezehrt und
überlastet seien. Im Kopf sind noch die Bilder von der Love Parade, als
eine Handvoll Beamte Zehntausende Menschen davon abhalten sollten, in
den Tunnel zu gehen. 21 Menschen starben, und bis heute wird gestritten,
wie viel Schuld die Polizei daran trägt.
Dann war da natürlich noch Stuttgart:
monatelang Demonstrationen, Wutbürger, Wasserwerfer, Verletzte. Für
Andreas Feß hat sich der Job in einen Albtraum verwandelt. Er ist der
Leiter des Stuttgarter Polizeireviers 2, in seinem Gebiet liegt der
Bahnhof, über den so erbittert gestritten wird. Feß, 38, sitzt in seinem
Büro mit Blick über die Stadt, Uniform, zwei Sterne auf der Schulter,
er seufzt. »2010 war das schlimmste Jahr meines Berufslebens. Die Grenze
des Erträglichen ist überschritten.«
Das größte Problem war für ihn und seine Leute,
dass sie bei den Demonstrationen auf einmal die Menschen vor sich
hatten, von denen sie eigentlich immer glaubten, sie seien auf Seiten
der Polizei. Da stand kein autonomer Block, keine alternative Welt – da
standen Akademiker, Lehrer, Ärzte, CDU-Wähler. »Man hatte plötzlich gut
situiertes Bürgertum vor sich, von denen manche leider nicht wussten, wo
die Grenzen des Protests verlaufen«, sagt Feß. »Und dann muss man so
einen festnehmen, weil er nun mal gegen geltendes Recht verstößt.«
Das ist eine neue Dimension: Was tun, wenn
gerade die, für die man die Drecksarbeit zu machen glaubt, konservative
Bürger, sich gegen einen wenden? Nichts ist mehr, wie es war.
Vergangenes Jahr setzte sich Wolfgang Thierse, immerhin der
Vizepräsident des Bundestags, medienwirksam auf die Straße, um eine
Nazi-Demo in Berlin zu verhindern. Der Mann hatte in der Sache natürlich
völlig recht, aber die Polizisten brachte er in eine Zwickmühle: Die
hatten den Auftrag, das verfassungsgemäße Recht zu demonstrieren
durchzusetzen, auch wenn die Demonstranten von der NPD sind. Dazu
gehörte es, dass die Polizisten einen der höchsten Repräsentanten des
Systems, das sie schützen sollen, aus dem Weg schaffen mussten. Thierses
Verhalten empört viele Beamte bis heute, denn er ließ die Polizei
schlecht aussehen.
Feß sagt, er sei »frustriert, ganz klar«. Und
dann schiebt er noch ein Beispiel aus dem Alltag hinterher: »Der Mangel
an Respekt macht uns zu schaffen. Ich stehe in Uniform an der
Fußgängerampel – und da gibt es Menschen, die bei Rot direkt an mir
vorbei über die Straße laufen. Da fällt mir nichts mehr ein. Das wäre
doch vor zehn, 15 Jahren undenkbar gewesen! Das kränkt mich.«
Respekt, bei dem Stichwort geht es im Grunde um
zweierlei: Das eine ist der schwindende Respekt vor der Amtsperson. Das
andere ist der schwindende Respekt vor dem Menschen, der da in der
Uniform steckt. Die Frage ist: Wie fühlt sich einer, der in seinem Job
von immer mehr Menschen mit nichts als Misstrauen und Arroganz behandelt
wird?
Das kann einem Rafael Behr erklären. Behr war
selbst Polizist, 15 Jahre lang, studierte dann Soziologie und
promovierte über Männlichkeit und Handlungsmuster in der Polizeikultur.
Heute lehrt er an der Polizeiakademie Niedersachsen und bildet
Führungskräfte aus. Behr, 53, ein kräftiger Mann mit dröhnendem Bariton,
sagt: »Gerade jüngere Polizisten sehen sich inzwischen immer mehr in
der Defensive. Nur unter ihresgleichen fühlen sie sich wirklich sicher.«
In Verbindung mit Wutbürgern eine ungute Mischung, da schaukelt sich
was hoch: Die Beamten werden misstrauischer, die Bürger auch, beide
Seiten stehen sich von Tag zu Tag abweisender gegenüber. Eine Spannung,
die in manchen Großstadtvierteln schon Normalität ist. Da sehen
Polizisten in jedem türkischen oder arabischen Jugendlichen einen
potenziellen Drogendealer, und jeder Polizist wird nur noch als
»Scheißbulle« beschimpft. »Besonders in sozialen Brennpunkten fühlen
sich viele Beamte wie Underdogs«, sagt Behr. »Es ist kein Wunder, dass
von jungen Polizisten oft Figuren wie Rambo als Vorbild genannt werden,
einsame Kämpfer. Diese Sicht erleichtert das Selbstverständnis. Viele
denken: Wir sind die Grenzhüter der Nation, wir bewachen die Grenze
zwischen Arm und Reich. Das muss man erst mal aushalten.«
Seite 2: Polizisten sind eigentlich ständig überfordert
Polizisten sind eigentlich ständig überfordert. In der Ausbildung lernen
sie, wie man zum Beispiel einen Armhebel richtig ansetzt. Wenn der
Druck zu stark wird, sagt der Kollege stopp. Aber bei Fußballspielen
oder auf der Reeperbahn nachts um halb eins werden sie mit einer völlig
anderen Wirklichkeit konfrontiert. Da sind die meisten, die Ärger
machen, so betrunken und hochgeputscht vom Adrenalin, dass sie nicht
mehr spüren, wenn ihr Arm schon halb gebrochen ist. »Der junge Polizist
erlebt dann zum ersten Mal, dass das, was er gelernt hat, leider nicht
immer was bringt«, sagt Behr, »und das macht den Beruf riskant.«
Überfordert war die Stuttgarter Polizei auch am
30. September. Was damals passiert ist, wird den Revierleiter Feß bis
an sein Lebensende verfolgen: Tausende von Demonstranten gegen Tausende
von Polizisten, die Situation geriet außer Kontrolle, dann zielte ein
Beamter mit dem Wasserwerfer zu hoch und verletzte einen älteren
Demonstranten schwer an den Augen. So etwas darf nicht passieren. Aber
im Eifer des Gefechts – wer würde an der Stelle des Einsatzleiters die
nötigen Entscheidungen treffen wollen? Andreas Feß sagt: »Als ich von
den Verletzungen gehört habe, hat mich das sehr getroffen. Andererseits
fragt man sich: Was hättest du denn sonst machen sollen? Hinterher sind
immer alle schlauer …«
Das Bild des blutenden Demonstranten ging durch
Deutschland – keiner aus dem Schwarzen Block, kein Kämpfer, sondern ein
pensionierter Ingenieur. Seitdem hat Feß keine ruhige Minute mehr. »Das
geht bis hin zu persönlichen Angriffen im Internet, bei Twitter«,
erzählt er. Die S21-Gegner kennen ihn. Seit beinah jeder eine Kamera in
seinem Handy hat, werden Polizisten ständig gefilmt, auch Feß.
Aber auch Polizisten, die Straftaten begehen.
Nach dem letzten 1. Mai in Berlin-Kreuzberg wurde zum Beispiel ein Video
ins Internet gestellt, in dem ein junger Mann zu sehen ist, der auf dem
Boden kniet. Im nächsten Moment rennt ein Polizist an ihm vorbei und
tritt mit voller Wucht gegen seinen Kopf.
Marco Wüllner * hat diesen Film gesehen. Er ist
Hundertschaftsführer bei der Bereitschaftspolizei Berlin und damit
verantwortlich für die Gesundheit, aber auch die Verfehlungen seiner
Truppe. In seinem Büro im Berliner Norden hängen Plakate vom G-8-Gipfel
in Heiligendamm und den »Revolutionären 1. Mai Demos« an der Wand.
Wüllner ist seit 1978 bei der BePo, der Bereitschaftspolizei. Wenn er
heute nach einem Einsatz auf YouTube geht und die Videos anschaut, fühlt
er sich als Polizist oft ungerecht behandelt: »In den Videos ist immer
nur der Moment der Festnahme zu sehen, wenn der Kollege zulangt, aber
nicht, was davor passiert ist«, sagt er. »Vielleicht müsste man da mit
der Zeit gehen und selbst entsprechende Bilder einstellen.«
Marco Wüllner formuliert diesen Vorschlag vorsichtig, er kann das ohnehin nicht entscheiden, er ist ein Mann für draußen, kein Schreibtischtyp. Auch zum Gespräch hat er die petrolfarbene Schutzhose der BePo an. Nur: Festnahmen sind das eine – aber gezielte Tritte? »Die dürfen nicht passieren, sind aber Realität«, beginnt Marco Wüllner und klopft dabei mit den Fingern auf den Tisch. »Aber wenn Sie schon mal im Steinhagel stehen, dann bekommen Sie so ein merkwürdiges Gefühl. Ich vergleiche das manchmal mit der Bundesliga: Wenn ein Spieler dauernd gefoult wird, foult er irgendwann zurück.«
Zurückfoulen, Aggression als Reaktion, der
Zwang zu handeln. Da argumentieren der Berliner Wüllner und der
Stuttgarter Feß ganz ähnlich. Aber was beiden Polizisten nur schwer über
die Lippen kommt: So ein Tritt ist eine Straftat. Punkt.
Entschuldigungen gibt es nicht. Und auch Polizisten schlagen grundlos
zu, jemand wie Michael Dandl ist sich da sicher. Dandl gehört zum
Bundesvorstand der Roten Hilfe, einer linken Organisation, die Opfer von
Polizeigewalt betreut und ihnen Anwälte besorgt. Er sagt, es gebe
extrem viel Gewaltbereitschaft bei der Polizei. »Wir beobachten immer
wieder, wie sich Polizisten am Rande von Demos gegenseitig abklatschen
und untereinander angeben, was sie gerade für einen Treffer gelandet
haben. Wie Sportler.«
In einem Bericht von Amnesty International aus
dem vergangenen Jahr werden zahlreiche Fälle beschrieben, in denen
Polizisten auf Demos friedliche Demonstranten verletzten. Eine junge
Frau erlitt beispielsweise einen Rippenbruch, als ein Beamter mit dem
Schlagstock auf sie einprügelte. Später, vor Gericht, wollten seine
zwölf Kollegen nichts davon gesehen haben. »Klima der Straflosigkeit«
nennen das die Autoren der Studie. Sie beklagen vor allem, dass es kaum
statistisches Material zur Gewalt gibt, die von Polizisten ausgeht – im
Unterschied zur Gewalt gegen Polizisten, die zum Beispiel in der Studie
des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen dokumentiert
wird.
Amnesty International fordert auch, dass
Bereitschaftspolizisten individuell gekennzeichnet werden. Bisher tragen
sie auf ihrer Uniform nur eine vierstellige Nummer, die sie als
Mitglied einer sogenannten Gruppe kenntlich macht. Doch Gruppen können
bis zu zwölf Mann stark sein. Wie sollen ein Opfer oder ein Zeuge da
einen möglichen Gewalttäter finden? In Berlin wurde die individuelle
Kennzeichnung, eine fünfstellige Nummer, im Januar eingeführt, in den
anderen Bundesländern noch nicht. Die Polizisten wehren sich dagegen.
»Für viele Beamte ist das eine Bankrotterklärung«, sagt der
Polizeiexperte Rafael Behr, »sie glauben, sie gehören zu den Guten. Aber
gekennzeichnet zu werden, das bedeutet ja: kontrolliert zu werden.« Auf
einmal sind sie die Bösen.
Marco Wüllner, der Hundertschaftsführer aus
Berlin, sieht das anders. Er hat Angst um seine Kollegen. Als vor Kurzem
einer seiner Männer einen Rocker der Hells Angels verhaften wollte,
blaffte der ihn an: »Packst du mir in die Eier, schlag ich dich tot.«
Der Rocker hatte auf seiner Kutte den gestickten Schriftzug »Filthy
Few«, das heißt, er hat schon einmal einen Menschen getötet. »Ich kann
verstehen, wenn ein Familienvater Angst bekommt, dass so einer
rausfindet, wer er ist«, sagt Wüllner.
Es gibt Gründe, über die deutsche Polizei zu
schimpfen: über Polizisten, die sich auf Demonstrationen aufführen wie
schlechte Kopien aus Actionfilmen, die zuschlagen und Kollegen decken.
Aber wenn es um Mord und Totschlag geht, um organisierte Kriminalität,
um Hells Angels oder Russenmafia, dann ruft niemand mehr: »Haut ab!«.
Dann ist der Bürger froh, dass es die Polizei gibt. Der CDU-Wähler
genauso wie der Linke, der Arzt genauso wie der Punk. Es ist eine
schizophrene Situation. Auch für die Beamten selbst.
Olaf Heinzes Frau ist froh, dass ihr Mann seit
dem Bölleranschlag im Innendienst arbeitet. Und er? Na ja. Der Kollege,
mit dem er jetzt das Zimmer teilt, hat sich einen Plüsch-Polizisten an
die Schreibtischlampe gehängt – auf Heinzes Computer läuft als
Bildschirmschoner eine Diashow aus seiner Vergangenheit: Pressefotos von
brennenden Mülltonnen, glatzköpfigen Hooligans, dann ein Polizist, der
einen Autonomen im Schwitzkasten hält. Auf einem Bild hat sich Heinze
mit seiner Gruppe wie eine Fußballmannschaft aufgestellt. Es ist vom 1.
Mai 2010, ein Kollege hat es gemacht. Die Polizisten lachen auf dem
Foto. Eine schöne Erinnerung, ein Gemeinschaftserlebnis. Der
Polizeiexperte Rafael Behr meint, für viele Beamte seien solche Einsätze
wie ein Räuber-und-Gendarm-Spiel, ein Kräftemessen. Die Polizisten
brauchen die Autonomen genauso wie die Autonomen die Polizisten: zur
Selbstvergewisserung.
Olaf Heinze sagt, er werde dieses Jahr zum
ersten Mal nicht in Kreuzberg dabei sein. Nächstes Jahr vielleicht
wieder. »Und wie ich mich kenne, bin ich so verrückt und stehe in der
ersten Reihe wie früher.«
Sein Kollege Sven Kaiser zeigt zum Ende des
Gesprächs ein paar bedruckte DIN-A4-Seiten, er hat sie aus dem Internet,
sie gehören zum sogenannten Polizeibericht Berlin, den
autonome Gruppen zusammengestellt haben. Darauf sind Bilder von
umgestürzten Polizeiautos zu sehen. Daneben steht: »Ein Mannschaftswagen
ist dank der Möglichkeit des Aufschaukelns (...) nicht wesentlich
schwerer umzukippen als ein leichterer Pkw.« An anderer Stelle wird
beschrieben, welche Körperteile eines Polizeibeamten trotz Brustpanzer
und Schienbeinschoner nicht geschützt sind. »Das gibt es doch gar
nicht«, sagt Kaiser, »die bereiten sich darauf vor, wie sie uns am
besten verletzen können!« In dem Bericht wird von der
Organisationsstruktur der Polizei bis zur Reichweite des neuen
Wasserwerfers WaWe 10 (65 Meter) kein Detail ausgelassen, auf 109
Seiten. Olaf Heinze kann es nicht fassen: »Dieser Bericht ist besser als
das Material, das unsere Dienstanfänger bekommen!«
Nein, man möchte kein Polizist sein. Selbst
jemand wie Michael Dandl von der Roten Hilfe, ein Mann, der die Polizei
nicht mal ruft, wenn bei ihm eingebrochen wird, findet am Ende Worte,
die so etwas wie Mitgefühl ausdrücken: »Polizisten sind oft überfordert,
sie sind frustriert, sie werden nicht sonderlich gut bezahlt. Sie
müssen an Tagen, an denen alle anderen ihre Freizeit genießen, Schicht
schieben, sie sind oft kaserniert, sie unterliegen einem komischen
Korpsgeist, es gibt krasse Hierarchisierung, es werden Befehle erteilt.
Das ist ein ganz erheblicher Psychodruck.«
In zwei Tagen ist der 1. Mai.
* Name von der Redaktion geändert