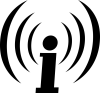Havard-Professor Hans-Helmut Kotz spricht im FR-Interview über die neue Armut in Amerika, die zusätzlichen Probleme nach dem Sieg der Republikaner und die Notwendigkeit zur Kooperation.
Professor Kotz, in den USA haben die Republikaner die Kongresswahl vor allem mit den Versprechen von weniger Staatsschulden und Einschnitten bei den öffentlichen Leistungen gewonnen. Was bedeutet das für die Wachstumsaussichten der größten Volkswirtschaft der Welt?
In den nächsten beiden Jahre droht politischer Stillstand, weil sich Präsident und Kongress gegenseitig blockieren. Es ist jetzt noch unwahrscheinlicher geworden, dass die USA die internationalen Folgen ihrer Politik berücksichtigen werden. Das ist in einer Phase hoher wirtschaftlicher Unsicherheit potenziell ein enormes Problem.
Warum?
Weil die US-Wirtschaft einfach in richtig schlechter Verfassung ist.
Berichten Sie!
Die effektive Arbeitslosigkeit, die offiziell erfasst wird, liegt bei 17 Prozent! Darin sind die entmutigten Arbeitsplatzsucher, diejenigen, die die Suche aufgegeben haben, nicht einbezogen. Gleichzeitig fehlen für uns selbstverständliche Abfederungsmechanismen, auf der betrieblichen Ebene etwa Arbeitszeitkonten und Kurzarbeit. Hinzu kommt, dass die Arbeitslosenunterstützung wenig mehr als ein Drittel des Lohns beträgt und normalerweise auf 26 Wochen befristet ist.
Aber ist die Arbeitslosenunterstützung nicht mehrfach wegen der Krise verlängert worden?
Das ist richtig, auf mittlerweile bis zu 99 Wochen. Genau diese Verlängerung der Bezugsdauer droht eines der ersten Opfer des Stillstands zu werden, weil die Republikaner dagegen sind. Davon wären am Ende bis zu 6,5 Millionen Arbeitnehmer, das sind knapp 45 Prozent der Arbeitslosen, betroffen. Bereits heute sind 42 Millionen Menschen, und damit etwa jeder sechste US-Haushalt, auf Essensmarken angewiesen.
42 Millionen?
Ja. Die Zahl ist im Verlauf der Krise um die Hälfte angestiegen. Der mittlere begünstigte Haushalt erhält 133 Dollar im Monat. Etwa die Hälfte geht an arbeitende Haushalte. Deren Netto-Einkommen wird durch das Antihungerprogramm – die Zuschüsse dürfen nur für Lebensmittel verwandt werden – um im Mittel mehr als ein Fünftel angehoben. Aber Armut ist nicht nur ein privates Phänomen, sondern auch ein öffentliches.
Sie meinen die Regionen, die Kommunen leiden ebenfalls?
Richtig, insbesondere die Gemeinden und Kreise mit den größten Immobilienblasen. Hier sind die Einnahmen drastisch eingebrochen. Aufgrund von Schuldenregeln müssen die Ausgaben ebenso drastisch zurückgefahren werden. Deshalb werden Investitionsaufwendungen gekappt und eben in hohem Umfang Personal entlassen. Der Arbeitsplatzabbau im öffentlichen Sektor ist so groß und anhaltend, dass er die ersten Zugewinne im privaten Bereich mehr als ausgleicht. Die Erfahrung der letzten großen Rezession Anfang der 1980er lehrt zudem, dass besonders negativ betroffene Regionen noch eine Generation später die Spuren zeigen.
Kann man also das Kaufprogramm der US-Notenbank Federal Reserve, die erneut insgesamt 600 Milliarden Dollar in Staatsanleihen investieren will, als Antwort auf den Stillstand bei der Fiskalpolitik deuten?
Wenn man will, kann man das. Wichtiger aber ist die handlungsleitende Diagnose der Fed. Sie will auf jeden Fall eine Deflation verhindern. Sie will zudem ihrem, neben der Kaufkraftsicherung, zweiten Auftrag genügen, nämlich für Wachstum zu sorgen. Die Notenbankzinsen sind bereits bei null Prozent. Da bleibt nach Einschätzung der Fed als Ersatzpolitik allein die mengenmäßige Lockerung, wissend, dass diese nur begrenzte Wirkung entfalten kann. Diese wird dennoch verfolgt, weil die möglichen Kosten des Nichtstuns – Deflation – als bei weitem zu hoch eingeschätzt werden.
US-Volkswirte kritisieren das enorme Volumen der Anleihekäufe als immer noch als zu gering, um damit den Abbau der Arbeitslosigkeit zu erreichen. Stimmen Sie zu?
Das Ankaufprogramm wirkt sehr indirekt, über höhere Vermögenspreise und die damit verbundene Stärkung des privaten Verbrauchs sowie einen tendenziell niedrigeren Wechselkurs. Die meisten gehen davon aus, dass die Fiskalpolitik stärkere Stabilisierungswirkung zeigen würde. Die ist aber am Spielfeldrand. Das US Haushaltsbüro stellt fest, dass die Wirtschaft heute sechs Prozent unter ihren normalen Möglichkeiten arbeitet. Im Verlauf des großen Einbruchs ist eine Lücke von 12 Millionen Arbeitsplätzen entstanden. Würde Wirtschaft mit der aktuellen Rate wachsen, dann brauchte es eine Generation, um das Beschäftigungsniveau von 2007 wieder zu erreichen. Aber bereits das heutige Wachstum ist sehr fragil. Vor dem Hintergrund diagnostiziert die Fed die Gefahr einer Preisabwärtsspirale.
Für den Rest der Welt ist diese ultra-lockere Geldpolitik eine Katastrophe. Gerade die Schwellenländer werden durch billige Dollar geflutet.
Für den Rest der Welt ist das Problem, dass dies alles nicht abgestimmt stattfindet. Klar sind der Zustrom billigen Geldes und die damit verbunden Aufwertung für die Schwellenländer eine große Sorge. Hinzu kommt der rasante Anstieg der Rohstoffpreise. Aber, so die Antwort von Präsident Obama, wenn ein Viertel der Weltwirtschaft in die Rezession rutscht, hat der Rest der Welt auch ein Problem.
Was ist die Konsequenz dieser Abhängigkeiten?
Zunächst ist es unabdingbar zu akzeptieren, dass wir in einer Welt der „strukturellen Interdependenz“ leben, wie es Richard Cooper (Harvard) ausdrückt. Diese wechselseitige Abhängigkeit hat zugenommen. Sie macht Kooperation zweckmäßig, das ist der ökonomische Grund für G20. Die erste Voraussetzung für deren Gelingen ist, dass man sich in die Lage der anderen versetzt, deren Ausgangssituation wahrnimmt. Die formulieren ihre Politik ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern im Lichte ihrer Interessen.
Und schon versteht man die Position der Amerikaner, die Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen wie China und Deutschland vorwerfen, sie exportierten Arbeitslosigkeit?
Dieses US-Argument ist natürlich bei weitem zu simpel. Es gibt nicht einen gegebenen Haufen Weltnachfrage, der einfach umzuschichten wäre. Die deutschen Firmen reagieren auf die Anreize ihrer Umgebung und zwar sehr erfolgreich, ohne jede Wechselkursbegünstigung. Es ist deshalb eine abstruse US-Idee von der deutschen Politik zu verlangen, dort bremsend einzugreifen. Es ist allerdings auch nicht der Zweck allen Wirtschaftens zu Exportieren. Wir haben ein Eigeninteresse, ein ganz unmittelbares, an einer robusteren Binnenwirtschaft. Gerade als Überschussland. Denn aus dem strukturellen Hinterherhinken unserer Binnennachfrage folgt, fast physikalisch, dass wir Finanzforderungen gegenüber den Kreditländern aufstocken. Gläubiger sind daran interessiert, dass ihre Forderungen bedient werden können. Tatsächlich geht es darum, wie die zu hohen und deshalb korrekturbedürftigen Leistungsbilanzschieflagen auf ein durchhaltbares Maß gebracht werden. Die amerikanischen Haushalte, die in den vergangenen Jahren den globalen Konsum angetrieben haben, sind schlicht am Ende. Diese Ungleichgewichte waren eine der Ursachen der Krise. Die G20 handelt davon, wer die Anpassungslasten trägt. Diese Ungleichgewichte waren eine der Ursachen der Krise. Die G20 handelt davon, wer die Anpassungslasten trägt. Sie muss vor allem eine gemeinsame Sicht der Dinge entwickeln.
Was passiert, wenn es den G20 nicht gelingt ihre Wirtschaftspolitiken zu koordinieren, wenn sie von Kooperation nichts wissen wollen?
Das ist ganz einfach: Sind die Interessenunterschiede unüberbrückbar, oder werden als solche konstruiert, dann geraten wir in die schlechteste aller möglichen Lagen. Bei einem Rette-sich-wer-kann-Verhalten dominiert am Ende immer der stärkste Spieler. Den anderen bleibt nur die Option des Anpassens.
Und der stärkste Spieler sind noch immer die USA?
Auf jeden Fall.
Wie beurteilen Sie denn vor dem Hintergrund die Ergebnisse des jüngsten Treffens in Seoul?
Als einen allzu mageren Erfolg, immerhin. Basel III, der neue Ansatz der Finanzmarktregulierung, wird auf den Weg gebracht. Das ist besser als das, was wir hatten, aber nicht ausreichend. Unser Thema, die korrekturbedürftigen weltweiten Ungleichgewichte, ist vor die Klammer gezogen worden. Das ist offenkundig keine Lösung. Und es reicht natürlich nicht, die Vorschläge der jeweils anderen Seite zu desavouieren.
Interview: Robert von Heusinger