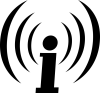Martin Arndt sammelt im Auftrag der Stadt Erinnerungen an die Gewaltausbrüche des Sommers 1992
Seit 2015 bauen Sie im Rahmen eines von der Stadt finanzierten Projekts ein Archiv zu den Ausschreitungen vor dem »Sonnenblumenhaus« vor 25 Jahren auf. Was sind die Archivalien?
Den Ausgangspunkt bildeten kleine, private »Archive« von Bürgerinnen und
Bürgern, die damals gesammelt haben, was ihnen in die Hände kam - das
sind natürlich zunächst oft Mediendokumente, schwerpunktmäßig aus den
lokalen Zeitungen. Die Flugblätter, die damals von den Rechten in Umlauf
gebracht wurden und die von der Gegenseite. Wir haben alle Unterlagen
aus dem damaligen Alternativen Jugendzentrum übernommen, darunter ist
eine zeitgenössische Chronologie der der Ereignisse, die natürlich auch
viele Details enthält, die man im Nachhinein ansonsten vergisst.
Das ist »deutsches« Material. Mai-Phuong Kollath vom Sprecherrat der Migrantenorganisationen im Land hat kürzlich gesagt, man müsse den Betroffenen mehr zuhören.
Es gehört zu den Zielen unseres Projekts, die Perspektiven der
Betroffenen rekonstruieren zu helfen. Dazu gibt es bereits Ansätze. Vor
fünf Jahren hat etwa die Heinrich-Böll-Stiftung eine Reihe von
Zeitzeugeninterviews aufgezeichnet, mit damaligen Bewohnern des Heims
für vietnamesische Vertragsarbeiter, zum Beispiel auch mit Wolfgang
Richter, dem damaligen Ausländerbeauftragten der Stadt, der ja im
»Sonnenblumenhaus« war, während es angegriffen wurde, und mit
Gegenaktivisten. Während viele vietnamesische Zeitzeugen noch in der
Stadt sind und mit dem nach den Ereignissen gegründeten Verein Diên Hông
auch eine Adresse haben, ist es sehr schwierig, Stimmen der damaligen
Roma-Flüchtlinge zu finden, gegen die sich die rassistische Mobilmachung
zuerst gerichtet hatte. Viele von diesen kamen aus Rumänien und wurden
nach dem entsprechenden Abkommen vom September 1992 zurückgebracht. Ihre
individuellen Blickwinkel sind bisher tatsächlich ein blinder Fleck.
Immerhin spielen Roma als Gruppe inzwischen eine größere Rolle in der
Erinnerung. Am Dienstagabend wird mit Romani Rose vom Zentralrat der
Sinti und Roma erstmals ein Vertreter der Roma an einer
Gedenkveranstaltung teilnehmen.
Haben Sie Kontakt zu »Tätern«, zu Leuten, die damals dabeistanden und das nun vielleicht bereuen?
Tatsächlich haben sich zwei Personen bei uns gemeldet, die damals
ungefähr eine solche Rolle gespielt haben. Bisher haben wir es noch
nicht geschafft, uns mit diesen Zeitzeugen hinzusetzen und ausführliche
Interviews zu führen, aber auch das gehört auch zu den Zielen unseres
Projekts. Unsere Finanzierung läuft noch ein Jahr, so dass ich hoffe,
dass das möglich sein wird.
Welche Rolle spielt »Lichtenhagen« inzwischen in der Stadt? Haben die Vorfälle einen festen Platz in ihrem öffentlichen Gedächtnis?
Es ist zumindest so, dass die Stadt diesmal recht viel Geld in die Hand
genommen hat. Neben unserem Archivprojekt, dessen Einrichtung alle
demokratischen Fraktionen in der Bürgerschaft zugestimmt haben, gibt es
ja noch weitere Aktivitäten, etwa das Kunstprojekt, bei dem dezentral
fünf Stelen in der Stadt aufgestellt werden, auch vor Institutionen, die
eine negative Rolle spielten, die damals versagt haben - also die
Politik, die Polizei, die Medien. In diesen Institutionen ist man
inzwischen durchaus dazu bereit, sich auch kritisch mit dem eigenen
Handeln in der damaligen Situation zu befassen. Die »Ostseezeitung«, die
damals eine sehr negative Rolle spielte, veranstaltet am Mittwoch eine
Podiumsdiskussion. Ich finde es in diesem Zusammenhang auch
bemerkenswert, dass die Stadt inzwischen offiziell den Begriff »Pogrom«
verwendet.
Was sagen diese Vorfälle vor einem Vierteljahrhundert heute jungen Rostockern?
Diejenigen, die ohnehin politisch interessiert sind, beschäftigen sich
viel mit dem Thema. In der vergangenen Woche gab es zwei
Podiumsdiskussionen im Peter-Weiss-Haus, die beide sehr gut besucht
waren, oft von sehr jungen Leuten. Aber auch Veranstaltungen mit
Rostocker Schulklassen zeigen, dass die Ereignisse nicht vergessen sind.
Wenn es auch vielen heutigen Schülern, die um die Jahrtausendwende
geboren sind, schwerfällt, die Ereignisse zum Beispiel zeitlich richtig
einzuordnen. Solche Veranstaltungen zeigen aber auch: Bis heute halten
sich in familiären Überlieferungen hartnäckige Legenden. Etwa diejenige,
die Ausschreitungen seien vor allem von busseweise angekarrten Neonazis
verübt worden und hätten mit der Stadt nicht viel zu tun gehabt. Oder
die Geschichte von den Geflüchteten, die Möwen gegrillt hätten. Das
zeigt, wie notwendig ein Projekt wie unser Archiv tatsächlich war und
ist.
Was hat das Pogrom in der Stadtgesellschaft bewirkt? Wären solche Szenen wie damals heute in Rostock noch möglich?
Im vergangenen Juli und August hat es ja eine Situation gegeben, die ein
wenig an 1992 erinnerte. Vor einer Unterkunft für minderjährige
Geflüchtete im neben Lichtenhagen gelegenen Stadtteil Groß Klein
versammelten sich abends regelmäßig Gruppen von etwa 20 bis 40 Personen,
darunter auch bekannte Neonazis. Diesmal wurde die Situation genau
beobachtet, nicht nur von linken Aktivisten, sondern auch von der
Polizei. Auf Anweisung des Sozialsenators Steffen Bockhahn (LINKE) wurde
die geplante Einrichtung einer weiteren Unterkunft in dem Stadtteil
abgebrochen und die Flüchtlinge auf andere Einrichtungen verteilt. Die
Rechten mögen das als Sieg gefeiert haben, aber das zeigte auch, dass
die Politik heute aufmerksamer reagiert als vor 25 Jahren. Nicht nur in
Rostock, sondern in den neuen Bundesländern überhaupt sind in den
letzten beiden Jahrzehnten doch bedeutende zivilgesellschaftliche
Strukturen entstanden, die ein »Lichtenhagen«, also eine tagelange
Belagerung mit Volksfestcharakter, bei der man mit der Familie auf dem
Weg zum Strand vorbeischaut, schwer vorstellbar erscheinen lassen.