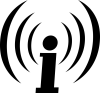Von Karsten Polke-Majewski
Das Leben nach dem Mord hat keine Farbe mehr. Was heißt Mord: Morde. Monströse Verbrechen, gefolgt von monströsen Ermittlungsfehlern. Was nach 6 Jahren, 7 Monaten und 16 Tagen übrig bleibt, ist eine kalte Welt in schwarz-weißen Bildern. Der Filmemacher Sobo Swobodnik hat sie für seinen Dokumentarfilm über die Mordserie des Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) aufgenommen. Noch ein Film also. Sechs Jahre lang zogen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt mordend durchs Land. Seit vier Jahren führt das Oberlandesgericht München einen der größten Terrorprozesse der Geschichte der Bundesrepublik. Seither haben mehr als ein Dutzend Filme dokumentarisch oder fiktional versucht, sich den Verbrechen zu nähern, denen zehn Menschen zum Opfer fielen. Was soll ein weiterer Film dem hinzufügen?
Der Asphalt ist nass, Pfützen stehen darauf. Das Bild wie eingefroren. Quälend lange richtet sich der Blick der Kamera auf den Boden. Endlich wechselt die Perspektive. Die gleiche gesichtslose Landstraße. Irgendwann fährt ein Auto vorüber. Überall könnte das sein und nirgends. Hier wurde ein Mensch getötet, ermordet aus menschenverachtenden Motiven. Müsste nicht irgendetwas diesen Ort verändert, ihn auf immer gezeichnet haben? Doch da ist nichts weiter zu erkennen.
76 Minuten lang geht das so. Ob Kassel, Hamburg, München, Nürnberg, Dortmund: Keiner der Tatorte verrät etwas über die Tat. Jedoch über die Opfer. Es sind gewöhnliche Orte, so gewöhnlich wie der größte Teil des Lebens der meisten Menschen, sodass sie niemand mehr wahrnimmt. Doch sie sagen: Der hier starb, war ein Mensch wie jeder andere. Einer, der über Straßen ging, die jeder benutzt. Der in Häusern wohnte und arbeitete, die aussehen wie alle anderen auch. Gerade weil die Orte beliebig erscheinen, ist es so schwierig, die Bilder auszuhalten.
Zu den Bildern hört man Stimmen. Schauspielerinnen und Schauspieler des Berliner Ensembles lesen im Off Zeitungsmeldungen vor, Prozessaussagen, Äußerungen der Hinterbliebenen. Wie kalt es klingt, wenn die Zeitung über den ersten Schuss berichtet, der nur die Schläfe streifte. Den zweiten, der tötete. Die Täter, die das Opfer fotografierten, bevor sie flohen. Über die Polizisten, die der Witwe das Foto einer angeblichen Geliebten ihres toten Mannes vorhielten, die es nie gab, weil sie den Zusammenhalt der Familie brechen wollten.
Ist es möglich, nachzuempfinden, was diese Familien fühlten, was sie heute fühlen? Wenn überhaupt, dann möglicherweise so. Denn was sieht ein trauernder Mensch: unscharfe Details. Eine Krähe, die über den Gehweg hopst, eine Nuss im Schnabel, und plötzlich davonfliegt. Menschen, die vorübergehen, Autos, die vorbeigleiten, manchmal im Zeitraffer, manchmal merkwürdig verlangsamt.
Was ist wirklich geschehen?
Nichts davon hat für sich Bedeutung, aber alle diese Bilder treiben den Betrachter in jenen Gedankenstrudel, der viele Hinterbliebene gefangen hält: Was ist wirklich geschehen? Wie konnten die Polizisten der Säuferin glauben, die – sich wichtigmachend – einen dunkelhäutigen Täter gesehen haben wollte. Und wie ihrer Bekannten, die dieser Säuferin nur nachplapperte? Wie konnte dieser Polizeikommissar versuchen, sich noch vor Gericht damit herauszureden, man solle mal nicht so tun, als habe es keine türkische Mafia gegeben? Wie nur konnten die Ermittler die Toten des Drogenhandels bezichtigen, sie dem Rotlichtmilieu zuordnen, die Angehörigen selbst als Mitwisser diffamieren? In den Worten der Familie der erschossenen Polizistin Michèle Kiesewetter: "Wie kann es sein, dass die Polizei unterm Strich so gut wie nichts an zutreffenden Fakten richtig ermittelt hat?"
Alles ist diesen Menschen verloren gegangen, das Vertrauen in ihre Heimat, ins Leben, in die Zukunft. Doch sie kämpfen darum, ihren Ort im Leben zurückzugewinnen. In den Bürgersteig in Hamburg-Bahrenfeld ist ein Stern eingelassen, so wie im Walk of Fame in Hollywood, darauf das Porträt von Süleyman Taşköprü. Ein Stolperstein. In Rostock stehen zwei steinerne Bänke zu Ehren Mehmet Turguts, darauf die Inschrift: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten."
Am Ende spürt man: Was man da sah, ist gar kein Film, sondern eine Bildmeditation. Doch gerade weil sie keine Erklärung liefert und kaum Dramaturgie, erklärt sie viel darüber, was diese Verbrechen für das Land bedeuten.