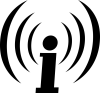Wenn Jehuda Teichtal vor seinem Kleiderschrank steht, hat er nicht die freie Wahl. Als orthodoxer Rabbiner kann er sich nicht aussuchen, wie jüdisch er aussehen möchte – er muss. Der Vollbart, der schwarze Anzug, die schwarze Kippa und darüber ein breitkrempiger Filzhut, der Borsalino, sind für Teichtal und seine Glaubensbrüder, die Lubawitscher Juden, obligatorisch. Die Kippa unter einer Baseballcap zu verstecken, wie es angeblich immer mehr gläubige Juden in manchen Gegenden Berlins tun, das kommt für Teichtal nicht infrage.
Wir sind auf der Sonnenallee in Neukölln verabredet. "Arabischer" als diese Straße ist kaum eine in Berlin. Halal-Fleischereien gibt es da neben Hochzeitsgeschäften, die Nikabs im Schaufenster zeigen; libanesische Cafés konkurrieren um den besten Hummus. Von "No-go-Areas" oder "Problemvierteln für Juden" in Berlin spricht der Zentralrat der Juden schon seit einer ganzen Weile, und damit dürften wohl vor allem Straßen wie die Sonnenallee gemeint sein. Über die Frage, wie gefährlich es ist, sich dort zu erkennen zu geben, ist in der jüdischen Gemeinde heftiger Streit entbrannt. Wir wollen es testen.
Rabbi Jehuda Teichtal, 44 Jahre alt, erscheint zum Treffen mit der elektrisierten Vergnügtheit, die für Lubawitscher Juden zum Glauben dazugehört wie der Borsalino. Die orthodoxe Gruppierung, die vor 250 Jahren in dem Ort Lubawitsch in Weißrussland entstand und mittlerweile in rund 70 Ländern präsent ist, feiert ihre Gottesliebe gern extrovertiert – mit ekstatischem Tanz, mit Singen und Klatschen. Diesen Winter, als Heiligabend und der Beginn des jüdischen Lichterfests Chanukka auf einen Tag fielen, hat Teichtal vor dem Brandenburger Tor einen riesigen neunarmigen Leuchter entzündet und überall in der Stadt kleine Lichter. Nur nicht in Neukölln.
Zur Begrüßung deutet Teichtal eine kleine Verbeugung an – er darf Frauen nicht die Hand geben. "Manche sagen, mit Jüdischem in Berlin soll man lieber zurückhaltend sein", sagt er. "Aber das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Wir sind da! Und das ist doch schön!" Mit federnden Schritten bewegt er sich durch die Menschenmenge. An der Ecke Weichselstraße gehen wir an einem kaum achtjährigen Jungen vorbei, der eine Elektrozigarette raucht. Niemand beachtet ihn. Gleich hinter ihm kommt eine Frau in einem orangen Turban, die sich ein altes Transistorradio ans Ohr hält, aus dem in voller Lautstärke Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen dröhnt. Auch nach ihr dreht sich kein Mensch um. Aber den orthodoxen Juden, den scheinen alle zu sehen.
Die meisten gehen stumm vorbei. Aber in der Dreiviertelstunde, die wir auf der Straße unterwegs sind, kurbeln zweimal Leute ihre Autofenster herunter und brüllen dem Rabbi etwas hinterher. Yahoud, "Jude", ist das einzige Wort, das man im Straßenlärm versteht. Zwei jüngere Männer gehen an ihm vorbei, der eine dreht an seiner Gebetskette. Sie sagen nichts. Doch ihre Blicke sind eisig. Ein Mann rempelt Teichtal an, eine Frau spuckt im Vorbeigehen auf die Straße – ob aus Versehen oder mit Absicht, ist beide Male nicht ganz klar. Leute hupen an der Ampel, grinsen ihn an, fühlen sich gedrängt, seine Gegenwart irgendwie zu kommentieren.
Das hier ist sicher keine No-go-Area, niemand bedroht den Rabbiner mit physischer Gewalt. Aber es fühlt sich alles nicht gut an, nicht selbstverständlich. Mit einem Fotografen zur Linken und einer Reporterin zur Rechten – es wirkt, als müssten wir ihn schützen, was Teichtal weit von sich weist. "Gott schützt mich", sagt er nur. Alles Fröhliche ist inzwischen aus seinem Gesicht gewichen. Morgens, als er das Haus verließ, um sich auf den Weg zu machen, hat ihn seine Frau Leah noch gefragt: "Muss es Neukölln sein?" Sie hatte Angst. Teichtal erzählt es beiläufig. Er ist trotzdem gekommen.
Es ist eine Sache, über Antisemitismus in der Zeitung zu lesen – aber eine komplett andere, mit dem eigenen Körper den Hassgefühlen fremder Leute ausgeliefert zu sein. Teichtal hat ein breites, freundliches Gesicht, wache Augen über dem vollen Bart. "Ich komme aus New York", sagt er, mit einem knödeligen Brooklyn-Akzent. "Dort habe ich niemals so ein Gefühl gehabt wie hier auf der Straße. Es kann doch nicht sein, dass ich Angst haben muss, hierherzukommen! Dass ich Angst um meine Kinder haben muss! Das ist doch nicht normal!"
Teichtal stammt aus einer Familie mit 13 Kindern, wie bei Lubawitschern üblich. Er selbst hat sechs. Seine Familie hatte 500 Jahre lang in Deutschland gelebt, bis die Nazis kamen – nur sein Großvater hat den Holocaust überlebt. Yehuda Teichtal ist vor 20 Jahren mit seiner Frau nach Berlin gezogen, weil der oberste Lubawitscher Rabbiner, Menachem Mendel Schneerson, ihn damit beauftragt hat, hier wieder für jüdisches Leben zu sorgen.
"Was soll ich machen, Papa?"
Teichtal ist einer von Tausenden "Schlichim", Gesandte der Lubawitscher, im Grunde so etwas wie Missionare. Und darin ist er sehr erfolgreich. Sein Chabad-Zentrum hat inzwischen einen Kindergarten, eine Synagoge, eine Grundschule und ein Gymnasium. Aber Teichtal spürt eben auch den Gegenwind. Seine jüngste Tochter, sechs Jahre alt, ist kürzlich nach Hause gekommen, erzählt er, und war bleich vor Schreck. Im Sportunterricht hatte ein muslimischer Mitschüler gesagt, er wolle keine Juden in seiner Mannschaft, und niemand habe protestiert. Sie war plötzlich nicht mehr ein Mädchen von vielen, sie war eine Jüdin. "Was soll ich machen, Papa?", hat sie Teichtal gefragt. Ja, was soll sie machen, was macht er, wenn er einen Antisemiten trifft? Die kurze Antwort lautet: "Gar nichts. Tu gar nichts. Ignorier sie."
Die Frage, ob Araber und Juden, gerade jetzt in der Flüchtlingskrise, Brüder oder Feinde sind, zielt tief ins Zentrum jüdischer Identität. Verpflichtet die jüdische Geschichte zu Universalismus, zu Solidarität mit Flüchtlingen, weil man die Erfahrung, fliehen zu müssen, so gut kennt? Oder muss man zuerst an sich selbst denken? Ist es jetzt überlebenswichtig, die Gefahr zum Thema zu machen, die Hunderttausende arabische Flüchtlinge darstellen könnten, weil sie durchweg aus Ländern stammen, in denen der Antisemitismus so selbstverständlich ist wie essen und trinken?
Vor ein paar Wochen wurde im Jüdischen Museum Berlin das Buch Ein Jude in Neukölln des ungarischstämmigen Rabbinerstudenten Ármin Langer vorgestellt, es trägt den Untertitel Mein Weg zum Miteinander der Religionen . Teichtal ist gar nicht erst hingegangen.
Der 26-jährige Langer hatte zuvor für einiges Aufsehen gesorgt, weil er den Zentralratsvorsitzenden Josef Schuster als "Rassisten" bezeichnet hatte. Schuster wiederum hatte den muslimischen Antisemitismus ein "ethnisches Problem" genannt. In einem anderen Kommentar schrieb Langer, "Muslime sind die neuen Juden". Beide, Schuster wie Langer, entschuldigten sich zwar später für ihre Äußerungen. Aber die Frage, wie Juden und Araber in Europa zusammenleben können, bleibt offen und schmerzhaft.
150 Zuhörer kamen zu der Buchpräsentation, streng bewacht von Polizisten, so wie jeder jüdische Kindergarten in Berlin, jede jüdische Schule von Polizisten bewacht wird. Langer zitierte während der Lesung Sätze aus der Thora: "Ihr kennt die Seele des Fremden, weil ihr selbst Fremde in Ägypten wart." Was man heute in Deutschland über Muslime sagen dürfe, das sei den Argumenten der Antisemiten des 19. Jahrhunderts sehr ähnlich. Eine Frau zischelt ihrer Nachbarin zu: "Der ist überhaupt kein Jude. Der ist ein Konvertit."
Langer sagt, er habe in Neukölln, wo er lebt, als Jude nie Probleme gehabt. Im Jahr 2014, dem Jahr des Gazakrieges, als in Berlin auf propalästinensischen Demos "Juden ins Gas" gerufen wurde, da habe er, Langer, auf einem arabischen Straßenfest eine muslimisch-jüdische Menschenkette gebildet – "nichts ist passiert".
Er trägt während der ganzen Veranstaltung ein sanftes Lächeln zur Schau, auch und gerade wenn er über sich selbst spricht, seinen Weg zum Judentum, das er vom Vater und nicht von der Mutter geerbt hat, wie es der Glaube von Jehuda Teichtal verlangt, über die eigene Homosexualität, seine Epilepsie.
Mit leisem Spott weist er die Furcht vor Neukölln ins Reich der "Paranoia von Charlottenburger Juden". Das deutsche Judentum sei überhaupt sehr brav, sehr ängstlich. Doch niemand müsse Angst vor Neukölln haben, auch kein Jude. Da meldet sich in der letzten Reihe ein junger Mann, französischer Jude: "Ich komme aus Paris", sagt er und lässt, ein Jahr nach dem blutigen Überfall auf den koscheren Supermarkt in Paris, eine kurze Pause. Dann ruft er: "Herr Langer, ich habe das Gefühl, wir leben in verschiedenen Welten."
Während des Gazakrieges 2014 zählte der Kriminalpolizeiliche Meldedienst bundesweit 1596 antisemitisch motivierte Straftaten, darunter 36 Gewalttaten. Im Jahr darauf waren es zwar weniger, etwa 1200 – doch noch immer mehr als drei pro Tag. Allerdings werden viele antisemitische Taten, wenn sie von Zuwanderern begangen werden, als "politisch motivierte Ausländerkriminalität" verbucht und tauchen in der Antisemitismus-Statistik gar nicht auf.
In Berlin wurden laut Polizeistatistik im vergangenen Jahr über 170 antisemitisch motivierte Straftaten registriert; in den meisten Fällen waren die Täter Rechtsextreme. Der Großteil der Verbrechen fand im Bezirk Mitte statt, die wenigsten in Neukölln und Spandau.
Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, kurz Rias, geht jedoch davon aus, dass die Zahl viel zu niedrig sei, weil viele Fälle einfach nicht angezeigt würden, da die Leute sich nicht trauen oder denken, es sei sinnlos. Rias sammelt und überprüft daher – auf Verlangen auch anonyme – Meldungen solcher Fälle, die von Juden selbst kommen, und hat dabei für Berlin über 400 Straftaten pro Jahr registriert, darunter auch Gewaltverbrechen.
"Aber wir stellen Bedingungen"
So wie Ármin Langer die muslimisch-jüdische Initiative Salaam-Schalom gegründet hat, hat auch Rabbi Teichtal immer wieder gemeinsame Aktionen mit Muslimen veranstaltet. In der Neuköllner Karl-Marx-Straße, unweit der Sonnenallee, putzte er vor einem Jahr zusammen mit dem gläubigen Berliner SPD-Fraktionsvorsitzenden Rahed Saleh Stolpersteine deportierter jüdischer Berliner. Er weiß genau, dass es völlig undenkbar für Muslime wäre, auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor ein gigantisches muslimisches Symbol zu entzünden, wie Teichtal es mit der Chanukka getan hat. Und ihm ist auch bewusst, wie in der Debatte über Beschneidungen Juden und Muslime plötzlich auf einer Seite standen, ziemlich allein auf weiter Flur.
Flüchtlinge kommen hierher und sagen: Was geht mich der Holocaust an? Da müssen wir als ganze Gesellschaft – nicht nur die Juden – ihnen sagen: Ihr seid hier willkommen. Aber wir stellen Bedingungen, und eine lautet: Respekt
"Es ist gut, Menschen zu helfen, die vor Krieg fliehen", sagt Teichtal. "Niemand weiß das besser als die Juden. Aber die Flüchtlinge kommen eben aus Ländern, in denen der Antisemitismus zur Alltagskultur gehört. Sie kommen hierher und sagen: Was geht mich der Holocaust an? Da müssen wir als ganze Gesellschaft – nicht nur die Juden – ihnen sagen: Ihr seid hier willkommen. Aber wir stellen Bedingungen, und eine lautet: Respekt."
Haben Juden und Muslime wirklich ein gemeinsames Anliegen, nach all dem, was in Frankreich zuletzt geschehen ist, was auf Europas Schulhöfen tagtäglich vor sich geht?
In einem Kreuzberger Hinterhof sitzt eine kleine Gruppe von Muslimen und sagt Ja, und das seit 13 Jahren. Dass es das überhaupt gibt, eine von Muslimen ins Leben gerufene "Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus" (KIgA), ist an sich schon eine Sensation. Nirgendwo sonst in Europa kennt man etwas Vergleichbares. Dervis Hizarci, der seit einem Jahr KIgA-Vorstandsvorsitzender ist, beschreibt, wie man als gläubiger Muslim dazu kommen kann, sich ausgerechnet mit Antisemitismus zu beschäftigen – und nicht, wie es die muslimischen Verbände tun, mit Rassismus. "Von meinem Imam wurden mir die Juden immer als 'Brudervolk des Buches' vorgestellt. Wir hatten gemeinsame Interessen: nicht nur bei der Beschneidungsdebatte oder wenn es ums Schächten geht. Uns verbindet auch die Erfahrung von Diskriminierung mit religiösem Bezug."
Wie kommt es dann, dass unter muslimischen Jugendlichen "Jude" ein Schimpfwort ist, dass Lehrer sich dreimal überlegen, ob sie mit ihren Schülern Anne Frank lesen wollen?
Hizarci hat kürzlich eine Erfahrung gemacht, die ihn lächeln lässt und die jedermann ein bisschen trösten könnte, der über die Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas grübelt. Ein junger Mann, der sich "Abdullah Business" (Name geändert) nennt, betreibt eine Muckibude auf der Sonnenallee. "Wenn Sie dem nachts begegnen, wechseln Sie die Straßenseite", meint Hizarci. Aber er folgt Abdullah Business auf Facebook. Und da hat Teichtal gesehen, wie dieser palästinensische Junge, für den das nicht ungefährlich ist, seinem Cousin, nachdem der einen ausfälligen Kommentar geschrieben hatte, antwortete: "Ey Alter! Was du da gerade gesagt hast, ist voll antisemitisch!"
Es ist kalt geworden beim Laufen. Nördlich der Sonnenallee, im frisch gentrifizierten Schillerkiez, gibt es ein israelisches Hipster-Café, eigentlich mehr eine Ladenwohnung mit Plattenladen. Es sieht verlockend gemütlich aus, die Gäste werden von ihren Laptops angestrahlt wie in einem Krippenspiel. Alle Möbel sind selbst gezimmert, irgendwo stehen zwei Plattenspieler zum Auflegen. Es läuft Elektro. Das Café Gordon verdankt seinen Namen einer Straße in der Mitte von Tel Aviv, die auf den Strand zuläuft. Man könnte sich entspannen. Jemand lacht, ein anderer ist sogar ein bisschen eingenickt. Alles ließe sich regeln, Israelis, Palästinenser, Juden, Araber – geht doch! Hinter der Glastheke liegen die zuckersüßen Rugelach, und aus der Küche zischt es, weil dort Schakschuka gebrutzelt wird, ein Pfannengericht aus Paprika, Tomate, Zwiebeln und Ei.
Der Besitzer, Doron Eisenberg, erzählt, er habe niemals Ärger mit Muslimen gehabt, kein Antisemitismus weit und breit, auch wenn die hebräischen Buchstaben weithin über die Straße zu sehen sind und obwohl auch ein palästinensischer Verein eine Ladenwohnung um die Ecke hat. Auch seine Großeltern waren Orthodoxe, auch seine Familie hat Menschen im Holocaust verloren, er hätte gerne mit Rabbi Teichtal gesprochen. Aber der kann nicht bei ihm essen. Was Eisenberg kocht, ist nicht koscher.
Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio
Korrekturhinweis: In der Printversion dieses Textes war fälschlich die Rede von der Neuköllner Karl-Marx-Allee gewesen. Wir haben den Fehler online korrigiert. Die Redaktion.