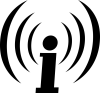In Kalabrien sind die Menschen gut zu den Flüchtlingen. Wenn da nur nicht die Mafia wäre.
Die Migranten nennen ihn liebevoll „Papa Afrika“. Aber eigentlich heißt er Batholomeo Mercuri, ist Diakon und von Beruf Möbelhändler. Doch für seine Schutzbefohlenen im Zeltdorf beim aufgelassenen Industriegebiet von San Ferdinando nahe Rosarno in Kalabrien ist er wie ein Vater, weil er ihnen im Einvernehmen mit der Kommune durch seine Unterschrift und einen Stempel den „festen Wohnsitz“ in ihren Zelten attestiert.
Den brauchen die etwa 400 derzeit hier lebenden Afrikaner für ihr laufendes Asylverfahren und mögliche Arbeitsverträge. Eigentlich müsste die Gemeinde aktiv werden. „Doch dort rührt sich niemand; der Ort ist quasi tot, der Staat schwach; die Kirche tut nichts. Da müssen Einzelinitiativen ran“, sagt „Papa Afrika“.
Schwarze Wolken hängen über dem Lager. Warmer Regen macht die Luft feucht und schwer. Der immergrüne üppig blühende violette, rote und weiße Oleander, der rund ums Lager als Hecke wuchert, zeugt von der Fruchtbarkeit und dem Reichtum der mediterranen Natur. Die paar Palmen dazwischen aber sind von einer Krankheit befallen, und Farbe bringen neben dem Oleander nur die blauen oder weißen Zelte, die hier vor fünf Jahren vom Innenministerium aufgestellt wurden. Sie sind aber mittlerweile grau und undicht. Plastik verhängt die Löcher.
„Es soll demnächst neue Zelte geben“, sagt „Papa Afrika“. Das täte gewiss auch dem achtzehn Monate alten Emanuel gut, der gerade lachend zwischen seinen ghanaischen Eltern hin und her läuft. Sein gelbes Plastikauto hat er vor dem Zelteingang geparkt. Bisher besitzt Emanuel sonst kaum Spielzeug; außer einer Puppe und leeren Dosen, in denen mal Bohnen oder Tomatenmark waren, wie man sie im von den Migranten organisierten Lädchen am Lagereingang kaufen kann.
Seit Jahrzehnten hoch verschuldet
„Papa Afrika“ schwört auf seine schwarzen Freunde aus Ghana, Mali, Burkina Faso, Senegal und Nigeria. „Sie bringen so viel Einsatzkraft und so viel Stolz mit“, sagt er. Das seien fast alles Menschen, die diesem alternden Italien nutzen könnten, aus dem so viele junge Italiener abwandern.
Neben dem Zeltlager gibt es noch ein Containerdorf mit 300 Ausländern; zudem ein nie fertiggestelltes Fabrikgebäude, in dem eine unbekannte Anzahl Männer Schutz gefunden hat. Mehr als zehn Prozent der gut 4000 Einwohner von San Ferdinando sind Migranten; zur Erntezeit der Orangen im Winter sogar deutlich mehr. Sie alle brauchen Hilfe. Aber der Ort ist seit Jahrzehnten hoch verschuldet und selbst hilflos.
Schon die jährlich 50.000 Euro zur Bezahlung von Strom und Wasser für die Flüchtlinge erhöhten den Schuldenberg, sagt ein Angestellter im Rathaus, der namentlich nicht zitiert werden will. Dabei sei der im 19. Jahrhundert gegründete Badeort der Markgrafen von Nunziante einst Zierde am Golf von Gioia Tauro gewesen. Man war stolz darauf, als erster Ort Kalabriens Clementinen exportieren zu können.
„Längst integriert“
Sommergäste belebten die Promenade am Mittelmeer und brachten weiteren Wohlstand nach San Ferdinando. „Dann vertrieb der Bau des Container-Terminals von Gioia Tauro unsere Touristen und ist selbst zum wirtschaftlichen Desaster geworden.“ Jetzt werde San Ferdinando schon das dritte Mal von einem Kommissar des Innenministeriums verwaltet, weil frühere Bürgermeister im Dienst der kalabrischen Mafia standen. Der Blick auf das Rathaus zeigt bildlich das Desaster: Die Fassade wurde nie fertig. Unverputzte Ziegel, wo wohl Marmor geplant war.
Bei all den Klagen über den Notstand im Ort fällt vom Stadtbeamten kein böses Wort über die Migranten, auch wenn er bedauert, „dass wir mit der Mülltrennung beginnen sollen, die aber nicht von den Migranten verlangen können.“ Vielmehr berichtet der Stadtangestellte von einzelnen Flüchtlingen, die in seiner Familie „wunderbar helfen“ oder im Ort „längst integriert“ sind. Solange in Süditalien aber eine Arbeitslosigkeit von im Schnitt zwanzig Prozent herrsche, würden diese Leute gewiss versuchen weiterzuziehen.
Das ist schwerer geworden. Solange die italienischen Behörden die Migranten nach Norden „durchwinkten“, fühlte sich die Obrigkeit kaum dazu aufgerufen, für bessere Lebensverhältnisse zu sorgen. Und weil es ohnehin kaum Arbeit gibt, wanderten die meisten schnell weiter. Mittlerweile aber herrscht in Italien ein strenges Kontrollsystem.
Rücksichtsloser Verdrängungsmarkt
An den „Hotspots“ in den sizilianischen und kalabrischen Häfen werden die Migranten unter Aufsicht der EU-Agentur Frontex identifiziert. Dort müssen sie ihren Asylantrag stellen. Danach dürfen sie sich zwar frei bewegen, müssen aber, wenn sie nicht aus dem Asylverfahren fallen wollen, einen festen Wohnsitz nachweisen, wie er ihnen von „Papa Afrika“ vermittelt wird.
Trotz der traditionell hohen Arbeitslosigkeit in Kalabrien bestand in der Region um Rosarno stets Bedarf an Saisonarbeitern, wenn im Winter die Orangen reifen und gepflückt werden müssen. Früher besorgten das Albaner und Rumänen, heute tun das eben diese Schwarzafrikaner.
Als San Ferdinando mit dem Export von Clementinen wohlhabend wurde, ging es auch Gastarbeitern gut. Heute herrscht ein rücksichtsloser internationaler Verdrängungsmarkt. Wenn Kalabriens Orangen überhaupt noch gepflückt werden, kann der Produzent auf acht Cent pro Kilogramm hoffen, und die Pflücker gehen fast leer aus.
Der Aufstand schärfte das Bewusstsein
Im Januar 2011 probten daraufhin die schwarzen „Sklaven von Rosarno“ den Aufstand. Es kam zu Straßenschlachten, nachdem fünf Migranten angeschossen worden waren, weil sie offenbar kein Schutzgeld an jene sie ausbeutenden Mittelsmänner, die „Caporali“, zahlen wollten. Plötzlich erfuhr man, dass die Pflücker bis zur Hälfte ihres Tageslohns von 25 Euro abgeben mussten, und dass viele Zitrusplantagen der kalabrischen Mafia ’Ndrangheta gehören, die Land und Arbeitsmarkt kontrolliere.
Dieser Aufstand schärfte das Bewusstsein der Italiener und beschämte die Bevölkerung um Rosarno, so dass der Staat heute bei all seiner Unfähigkeit zumindest die Freiwilligen – wie „Papa Afrika“ – nicht mehr bürokratisch behindert. Auch gibt es mehr gesellschaftliche Institutionen als noch 2011, die Pflückern helfen.
Celeste Logiacco gehört zur FLAI CGIL, der Landarbeitergewerkschaft. Sie ist oft im Zeltlager zu Besuch und hat sich längst mit Emanuels Mutter angefreundet. Im Lager traf sie auch Jacop Atta aus Ghana, heute ihr Vollzeitmitarbeiter in der Gewerkschaft, der als Übersetzer hilft, wenn die Gewerkschafterin die Tagelöhner auf ihre Arbeitsrechte hinweist.
„Eine neue Synergie“
„Um die Caporali auszuschalten, zeigen wir den Arbeitern Musterverträge des Staates; bisweilen vermitteln wir Rechtsanwälte“, sagt Celeste und beklagt, dass gleichwohl noch immer „Caporali“ bisweilen für den Transport zur Plantage die Hälfte eines Tageslohns kassieren wollten und dass es weiter Arbeitgeber gäbe, die Pflücker zu Minilöhnen schuften lassen, auch wenn ihnen mindestens 40 Euro pro Arbeitstag zustehen.
„Dagegen entwickelt sich eine neue Synergie zwischen anständigen Arbeitgebern, staatlichen Stellen und Arbeitnehmern.“ 2014 schuf das Regionalparlament von Kalabrien sogar ein Gesetz zur Sicherung der Saisonarbeiterrechte.
Auch „Libera“ hilft den Pflückern. Diese mit dem Staat zusammenarbeitende Kooperative bewirtschaftet Plantagen und Betriebe, die von der Mafia enteignet wurden. Antonio Napoli von der Kooperative Valle del Marro im nahen Polistena berichtet, dass die Betriebe nur wirtschaftlich arbeiten könnten, wenn sie Produkte besonders guter Qualität herstellen und Konsumenten finden, die „dafür auch mehr zu bezahlen bereit sind“.
„Mafia nicht mehr Herrin über das Territorium“
Napoli gibt der Mafia Mitschuld daran, dass der Markt aus den Fugen geriet. Die ’Ndrangheta habe nicht nur über Jahre den Arbeitsmarkt mit kontrolliert, sondern sich auch mit aufgeblähten Erträgen, „mit Orangen, die nur auf Papier geerntet wurden“, hohe EU-Prämien gesichert.
„Heute ist die Mafia nicht mehr Herrin über das Territorium“, sagt Napoli. Langsam befreie sich die Gesellschaft darum von deren Druck, auch wenn es weiter vorkomme, dass sie „ehrlichen Unternehmern“, die ihr kein Schutzgeld zahlen wollen, Olivenbäume in Brand steckt oder abholzt. Oder es verschwinden Traktoren und Benzin; bisweilen macht die ’Ndrangheta Maschinen unbrauchbar, indem sie Zucker in den Treibstofftank schütte. Doch allmählich werde das Bündnis der Unternehmer gegen die Verbrechersyndikate stärker.
Der „Palazzo dei Versace“, benannt nach dem einst mächtigsten Mafiaclan Polistenas, wurde vor Jahren enteignet und 2013 der Stiftung „Emergency“ übergeben, die im mehrstöckigen Gebäude eine Ambulanz unterhält, wo zu 40 Prozent Italiener und zu 60 Prozent Ausländer gratis eine medizinische Grundversorgung erhalten: „Die Italiener kommen mit Herz- und Kreislaufproblemen, haben Zucker oder Altersbeschwerden“, sagt Chefin Alessia Prizzitano. „Die Ausländer hingegen klagen oft über Rückenschmerzen von der Arbeit und Magenprobleme, die meist Stressfolgen sind.
„Italien und Europa versagen“
Zu den „Emergency“-Angestellten gehören vier Migranten, die als „Mediatoren“ helfen. Psychische Beratung leistet „Emergency“ auch: „Diese Menschen mussten sich auf ihrem Weg nach Europa wie Sklaven unter ihren Ausbeutern in Libyen ducken und verlieren oft ihr Selbstwertgefühl, wenn sie auch noch am Ziel ihrer Hoffnung feststellen, dass man sie und ihre Arbeit nicht schätzt.“
Weil es kaum einen öffentlichen Nahverkehr gibt, sorgt eine weitere private Initiative für den geregelten Transport der Migranten von ihren Lagern zu „Emergency“. Aber all diese Hilfe könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass „Italien und Europa versagen“, kritisiert der Soziologe Fabio Mostaccio von der Universität Messina. Die EU müsse auf dem gesamten Produktions- und Verkaufsweg rechtliche Verlässlichkeit und Transparenz durchsetzen: Rosarno stehe nicht für ein Problem mit Ausländern, sondern für eine gesamteuropäisch mafiöse Marktpolitik.
von Jörg Bremer,
San Ferdinando