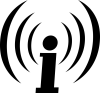Die EU-Außengrenzen werden zunehmend gegen Flüchtlinge abgeschottet - Gated Nations Teil 5
Die Schiffskatastrophe vor der italienischen Insel Lampedusa, bei der Anfang Oktober hunderte Menschen ihr Leben verloren haben (Leben und Sterben auf Lampedusa), hat ein Schlaglicht auf die restriktive bis repressive EU-Politik gegenüber Flüchtlingen geworfen. Ein genauerer Blick auf das EU-Grenzregime zeigt: Die Union schottet sich nach außen systematisch und mit immer größerem technischen Aufwand ab. Experten kritisieren dieses Vorgehen und fordern zugleich eine politische Debatte über neue Migrationsbewegungen.
Der Schock über die Katastrophe(n) von Lampedusa saß noch tief, als führende EU-Politiker Anfang Dezember den Start eines neuen Programms zum Grenzschutz bekanntgaben. Das Überwachungssystem Eurosur solle gegen Drogenhandel und Schleuser eingesetzt werden, hieß es aus Brüssel, wo man durchaus aus eingestand, dass auch die Abwehr illegaler Migranten zu den Zielen gehört.
Neben den gut 14.000 Kilometern EU-Außengrenzen zu Lande konzentriert sich die Grenzsicherung vor allem auf die Meergebiete im Süden der Union. Über das Mittelmeer versuchen von jeher die meisten Menschen in den reichen Euroraum zu gelangen. Neben vorübergehenden Flüchtlingswellen - etwa aufgrund der bewaffneten Auseinandersetzungen in Syrien - sind es vor allem Wirtschaftsflüchtlinge aus Afrika, Verlierer der postkolonialen Ordnung und neoliberalen Globalisierung, die in Europa eine bessere Zukunft suchen. Gleiches gilt für die Migrationsströme aus dem Osten.
Gegen sie rüstet sich die EU mit zunehmendem Aufwand. Das Grenzüberwachungssystem Eurosur wird zunächst 18 Staaten an den Außengrenzen einbinden. Später sollen elf weitere Länder der EU und Partnerstaaten hinzukommen. Im Rahmen des zunächst 244 Millionen teuren Programms werden in einer ersten Phase so genannte Nationale Kontaktpunkte (NCP) eingerichtet, Lagezentren, die später mit der Grenzschutzagentur Frontex mit Sitz in Warschau verbunden werden. Das Eurosur-Programm sei "eine echte europäische Lösung", schwärmte die Innenkommissarin der EU, Cecilia Malström, bei der Präsentation.
Mit Drohnen und Satelliten
Koordiniert wird die Kontrolle der EU-Außengrenzen seit 2005 von der Grenzschutzagentur Frontex. Die Einrichtung unter Leitung des Finnen Ilkka Laitinen setzt in zunehmendem Maße auf hochentwickelte Überwachungstechnologie.
So berichtete Matthias Monroy schon Anfang vergangenen Jahres auf Telepolis über eine Luftfahrtschau der EU-Agentur in der griechischen Hafenstadt Aktio (EU will mehr Drohnen gegen Migranten einsetzen). Dabei seien Drohnen verschiedener Hersteller getestet worden, so Monroy, denn Frontex wolle auch "Unmanned Air Vehicles" (UAV) zur Flüchtlingsabwehr einsetzen. In Griechenland seien zudem unbemannte Flugzeuge der sogenannte "Medium Altitude Long Endurance" (MALE) gezeigt worden, die maximal zehn Kilometer hoch fliegen können. "Ausdrücklich erwünscht waren aber auch kleinere Drohnen, sofern sie über eine längere Flugzeit verfügen", so Monroy.
Es geht Frontex aber auch darum, bestehende Überwachungsinfrastruktur auszunutzen. Nach einem Bericht der "Zeit" nutzen die EU-Grenzschützer zunehmend auch die Dienste der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) (http://www.esa.int/ESA). Diese habe rund 30 Satelliten im Rahmen des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zusammengeschlossen.
Offiziell - so heißt es - sollen Veränderungen der Umwelt beobachtet werden. Dabei werden die Satelliten aber zu sicherheitspolitischen Zwecken eingesetzt, beklagen Kritiker von Frontex und Eurosur. "Zeit"-Autorin Astrid Ludwig führt zwei dieser Programme auf. Das Projekt "Service Activations for Growing Eurosur Success" (SAGRES) solle Schiffe verfolgen und Drittstaaten überwachen. Das Vorhaben "Low time critical Border Surveillance" (LOBOS) beobachtet ebenso die Küsten und Gewässer von EU-Anrainerstaaten.
In beiden Fällen werden die Aufnahmen der ESA-Satelliten genutzt. Zu dem Netzwerk gehören auch zwei deutsche Satelliten sowie US-Trabanten. Diese seien mit einer Technik ausgestattet, die in der Vergangenheit lediglich in Spionagesatelliten verwendet worden sei, so Ludwig.
Tausende von Toten im Mittelmeer und Atlantischen Ozean
Seit dem Kentern der Flüchtlingsschiffe vor Lampedusa steht das bislang von der Öffentlichkeit weitgehend verborgene Thema stärker auf der politischen Agenda. EU-Innenkommissarin Malström versuchte umgehend, auf die Kritik einzugehen. Es gehe bei dem Eurosur-Programm und der Grenzüberwachung auch darum, Flüchtlingen in Seenot zu helfen. Politisch eine verständliche Reaktion, nachdem alleine am 3. Oktober nach bisherigen Schätzungen 390 Menschen vor Lampedusa ertrunken waren.
In der Sache ist Malström allerdings wenig glaubwürdig. Schon 2008 wurde zwar die "Senkung der Todesrate" als eines der Ziele des Eurosur-Programms genannt. Vor allem aber hieß es in der Beschreibung des damals neu entworfenen Vorhabens: "Ziel dieses Systems ist es, die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die Zahl der Drittstaatsangehörigen zu reduzieren, die illegal in das Hoheitsgebiet der EU gelangen, indem ein größeres Situationsbewusstsein für die Lage an den Außengrenzen entwickelt und die Reaktionsfähigkeit der Nachrichtendienste und Grenzschutzbehörden verbessert wird."
Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl weist auf die mörderischen Folgen der Abschottungspolitik hin. Dabei werden für den Zeitraum 1988 bis 2007 folgende Zahlen genannt: "8.114 Tote im Mittelmeer und Atlantischen Ozean, 2.486 im Kanal von Sizilien, 3.986 zwischen Nordafrika und Spanien, in der Meerenge von Gibraltar und bei den Kanaren, 885 in der Ägäis." Für Menschen auf der Flucht seien die Außengrenzen Europas längst zum Massengrab geworden.
Ein Grund dafür ist vor allem die sogenannte Pushback-Politik, das Zurückdrängen von Flüchtlingsbooten auf hoher See. Ein Sprecher von Kommissarin Malström sagte zwar, dieses aggressive Vorgehen sei "nicht erlaubt" und stünde im Widerspruch zu internationalen und EU-Verpflichtungen. Nach Beobachtungen von Menschenrechtsorganisationen kommen entsprechende Vorfälle aber immer wieder vor. Diese These, dass die zunehmende Überwachung die Flüchtlinge schützen solle, wird damit ad absurdum geführt.
Ruf nach neuer Flüchtlingspolitik
Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen fordern daher seit geraumer Zeit nicht nur eine Debatte über die Folgen der repressiven Grenzpolitik, sondern auch der über die Haltung zu Flüchtlingen. Vor allem an den südlichen Außengrenzen wird die Lage immer brenzliger, weil Flüchtlinge nach dem mehrheitlichen Willen der EU-Innenminister in dem Einreisestaat verbleiben sollen.
In Griechenland mit seinen schwer zu überwachenden Seegrenzen hat das zu einer Einreisewelle und in Zeiten der wirtschaftlichen Krise zu schweren gesellschaftlichen Folgeproblemen geführt. Ähnlich in der Republik Zypern: Über die Demarkationslinie dort kommen fast täglich Flüchtlinge über den türkisch besetzten Norden in den EU-Staat. Die Immigranten - illegale und legale - machten schon 2009 inzwischen knapp 15 Prozent der Bevölkerung in der Republik Zypern aus. Zunehmende Fremdenfeindlichkeit ist auch hier die Folge.
Pro Asyl, eine der renommiertesten Flüchtlingsorganisationen in Deutschland, sieht als einzige mögliche Reaktion die geregelte Öffnung der Grenzen. Die Toten vor Lampedusa seien eine Folge der "immer effektiveren Abriegelung der europäischen Außengrenzen", kritisiert die Organisation. Zuletzt habe die EU vor allem die Landgrenze zur Türkei für Schutzsuchende neben schnellen Eingreiftruppen mit Hubschraubern, Spürhunden, Wärmebildkameras, Nachtsichtgeräten und anderen Sensoren auch mit einem kilometerlangen Grenzzaun und einem 30 m breiten Graben abgeriegelt (Frontex geht in die Luft). "Damit wurde einer der wichtigsten Fluchtwege nach Europa verschlossen", führt Pro Asyl aus. Die Folge sei, dass Flüchtlinge nun wieder verstärkt auf den noch gefährlicheren Weg über das offene Meer ausweichen.
Wer das Massensterben beenden wolle, müsse Flüchtlingen den legalen und gefahrenfreien Weg nach Europa eröffnen. So lebten in Deutschland zahlreiche Flüchtlinge eritreischer und somalischer Herkunft. Sie müssten zusehen, wie Angehörigen und Freunde verzweifelt vor den geschlossenen Grenzen Europas stehen und deshalb lebensgefährliche Fluchtrouten auf sich nehmen müssen. Eine der Fluchtrouten eritreischer Flüchtlinge führe durch den Sinai. Dort würden hunderte eritreische Flüchtlinge gekidnappt und gefoltert, bis ihre Verwandten Lösegeld entrichten. "Auch dies ist eine Folge der europäischen Abschottungspolitik", kommentiert Pro Asyl.