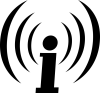In München hat sich der Protest gegen Gentrifizierung verbürgerlicht. Von Katrin Hildebrand.
Neunmal hatte Kenneth Halliwell zugeschlagen. Mit dem Hammer, immer auf den Kopf. Dann schluckte er eine Überdosis Barbiturate, starb innerhalb einer halben Minute, während sein Opfer mit gespaltenem Schädel dahinsiechte. Erst Stunden später, am 9. August 1967, hörte der Dramatiker Joe Orton auf zu atmen. 16 Jahre waren die Künstler ein Paar gewesen. Acht Jahre hatten sie gemeinsam in einer winzigen Einzimmerwohnung im Londoner Stadtteil Islington gelebt und gearbeitet. Ausgerechnet in Islington, dem Viertel, in dem die Gentrifizierung der Großstädte der Legende nach um 1950 ihren Anfang nahm.
München hat zwar erst 1957 die Millionengrenze überschritten. Dennoch ist die Bayernmetropole das London des kleinen Mieters. Islington heißt hier Haidhausen, Notting Hill ist Schwabing. Zwar jammern mittlerweile sogar die Berliner über Massenandrang bei Wohnungsbesichtigungen. Doch während in der Hauptstadt Studenten und arme Leute leiden, der Durchschnittshempel allerdings noch immer Platz für ein Gästezimmer in seiner Neuköllner Lifestylebude hat, findet in München kaum ein Ingenieur, Inbegriff des deutschen Mittelstands, eine Bleibe, sei sie nun erschwinglich oder nicht. Und wenn er bereits eine hat, muß er ob der drastischen Mieterhöhungen fürchten, daß er bald in eine der schlafenden Vorstädte ziehen wird.
Schon in den 1960ern standen Pärchen, Singles, Spießer, Künstler, Beamte und Sekretärinnen drei Stockwerke Schlange, um mal einen Blick auf die schier unerreichbaren Zwei-Zimmer-Küche-Bad zu werfen, wie Edgar Reitz voller Ironie in seiner München-Chronik »Die zweite Heimat« zeigt. Wer heute Glück hat und beim Wohnungsroulette einen Raum bekommt, traut sich nicht mehr, Auswärtigen den Mietpreis zu verraten: Die halten einen wahlweise für einen Décadent, einen Vollidioten, der sich von seinem geifernden Vermieter über den Tisch ziehen läßt, oder einen degenerierten Nerd, weil man es nicht geschafft hat, sich über Spezln, sprich: Connections eine Billigwohnung zu erschleichen. Wer sich auf den »freien« Markt, also unter fremde Menschen, raus aus der eigenen stinkenden Sippe, wagen muß, wird von seinen linksalternativen Freunden, also jenen, die sonst über Bestechung und CSU-Vetternwirtschaft herziehen, stillschweigend belächelt.
Überhaupt hat die klassische Linke ihr Kritikmonopol am Münchner Wohnungsmarkt längst aufgegeben. Nur alle paar Jahre versucht sie erfolglos, ein Versprechen des früheren Polizeipräsidenten Manfred Schreiber zu konterkarrieren. Der sagte 1981: »In München – das garantiere ich – bleibt kein Haus länger als 24 Stunden besetzt.« In einer Stadt allerdings, in der nicht nur (mundartlich Gratler genannte) arme Schlucker und (im Kleinbürgersprech) »Asoziale« um Obdach bangen müssen, krakeelt längst der Mittelstand nach Rettung. Spätestens, wenn er merkt, daß er sich reproduzieren will und das sterile Wohnzimmerensemble einem Wickeltisch Platz machen muß. Eine Künstlerinitiative mit Namen Goldgrund probte 2013 mehrmals den Aufstand. Im März renovierte (!) sie über Nacht eine Wohnung in einem leerstehenden, vom Abriß bedrohten Wohnhaus der Stadt. Im Oktober lud sie zur Party in ein weiteres leeres Gebäude, das luxussaniert werden soll. Hinter den Aktionen stecken ein Journalist, ein Filmemacher und der Kabarettbetreiber Till Hofmann, aber auch Lokalprominenz wie die Sportfreunde Stiller, Ex-FC-Bayern- Profi Mehmet Scholl und die Humoristen Gerhard Polt und Max Uthoff. Zwar sprachen die Zeitungen damals von »Hausbesetzung Deluxe«, doch das böse Wort verboten sich die Gesellschaftskritiker der alternativen Mitte. Ihre Sause firmierte als »temporäre Kunstaktion«, ebenso wie ihre Fake-Immobilien-Organisation Goldgrund als Kunstsatire auf den in München boomenden Luxuswohnungsmarkt zu verstehen ist.
Während Oberbürgermeister Christian Ude als Reaktion auf solcherlei Events die Stadtverwaltung Ende November aufforderte, Leerstand abzuriegeln oder gar als bewohnt zu tarnen, werfen die Aktivisten – statt mit Pflastersteinen auf Polizisten – mit Phrasen in Richtung Presse. Gegenüber dem »Focus« kritisierten sie den Mißbrauch leerstehender Häuser als »Spekulationsobjekt« sowie den Umstand, daß es überall nur darum gehe, ein »Maximum an Profit herauszuschlagen«. Wohl noch nichts vom Kapitalismus gehört?
Max Uthoff, ab 2014 Mitgastgeber der ZDFKabarettsendung »Die Anstalt«, sehnte sogar den Mob herbei: »Wenn alle Einwohner des Glockenbach- und Gärtnerplatzviertels jeden Tag am The Seven (einem für Privatwohnungen luxussanierten ehemaligen städtischen Heizkraftwerk; K. H.) vorbeigehen und rüberbuhen würden, würde den Bewohnern vielleicht klarwerden, daß sie hier nicht gewollt sind.« Der »Münchner Merkur« wiederum berichtete, wie die Aktivisten im Doppelstockbus durch München kurvten und sich von den »schmierigen Immobilien-Haien Mark Bench und Dirk von Stahligk«, zwei verkleideten Schauspielern mit Schlips und »gemeißeltem Grinsen«, Luxushäuser und vom Verkauf bedrohte Mietwohnungen präsentieren ließen.
Daß das Aufbegehren gegen Mißstände wie in diesem Fall nahezu automatisch in Ressentiments umschlägt, ist nichts Neues. Das ändert jedoch nichts an der grausen Tatsache, daß dümmlicher Protest jede Art von Verneinung des Bestehenden unmöglich zu machen scheint. Kritik als solche, die Ratio als Irratio entlarvt und nicht gleich mit allem, das die Stimme erhebt, in Solidarität marschiert, muß wieder mal marginal bleiben – und den Miseren, seien sie materiell oder ideologisch, voller Ohnmacht zusehen. Denn so existentiell bedrohlich die Wohnungsnöte vieler Menschen sind, die in München leben wollen oder müssen, so real verfallen die kleinbürgerlich-alternativen Kritiker der Krise in pathische Projektion: Ihre Attacken auf Spekulanten, also auf Vertreter jener Zunft, die nicht, wie es schon der NSDAP-Politiker Gottfried Feder anprangerte, für ihr Auskommen rechtschaffen buckeln, sondern das Geld für sich arbeiten lassen, erinnern ebenso wie die Antibankerhetze an die alte Mär vom »guten deutschen schaffenden« im Gegensatz zum »schlechten jüdischen raffenden« Kapital.
Der bayerische Schriftsteller Ludwig Thoma schimpfte vor über 100 Jahren bereits über den Wandel im Stadtbild. Mit ähnlichen Argumenten. Auch damals entstanden in München viele Luxuswohnungen – die Stadt war am Zuzug Wohlhabender interessiert –, während Arbeiterfamilien ähnlich wie Joe Orton und Kenneth Halliwell in winzigen Löchern aufeinanderhockten. Als um den neu gebauten Ostbahnhof jedoch ein Viertel auf dem Reißbrett entstand, um jenen Arbeitern günstig Obdach zu bieten, verschwand der dörfliche Charakter der alten Gemeinde Haidhausen, die damals längst zu München gehörte. Thoma wetterte: »Jetzt ist … die Aussicht von einer öden Reihe hoher Mietskasernen versperrt, und wo die gepflegten Rosen … blühten, sind gepflasterte Höfe, darüber Küchenaltanen, auf denen man Teppiche ausklopft. Ein Stück Altmünchen nach dem anderen wurde dem Verkehr, den großstädtischen Bedürfnissen, dem Zeitgeist oder richtiger, der Spekulation geopfert.« Thoma hatte sein literarisches Leben als Kritiker der Kleinbürger, Preußen und Provinzler begonnen und als Antidemokrat und Antisemit beendet. Bei ihm sind die Spekulanten Urheber der unerwünschten Verstädterung eines angeblich idyllischen Dorfes, das in Wahrheit eine von Choleraepidemien heimgesuchte Elendssiedlung für Tagelöhner und Bettler war. In Thomas Wahrnehmung schufen »die Spekulanten« zwar erschwinglichen Wohnraum, dieser aber fiel in Ungnade – wegen seiner häßlichen Architektur sowie als Repräsentant der Verwandlung Münchens in einen Moloch. Den heutigen Gentrifizierungskritikern gelten die Spekulanten dagegen als Verhinderer erschwinglichen Wohnraums und als Schöpfer luxuriöser, sprich: schöner, aber viel zu teurer Apartements. Wie man’s auch dreht: Schuld sind in der pathischen Projektion immer die gleichen.
Ludwig Thomas Trauer um etwas Vergangenes, das sich bei näherem Hinsehen als gar nicht so erhaltenswert entpuppt, kommt einem Begriff des amerikanischen Schriftstellers Tom Wolfe sehr nahe, der die Gentrifizierer als »Kloakennostalgiker« beschreibt. Gentrifizierung, also der Akt, in ein altes Viertel zu ziehen, das (noch) unterhalb der eigenen sozialen Schicht anzusiedeln ist, ist immer rückwärtsgewandt, da man – wie in Londons Stadtbezirken der 1950er und 60er – historische Arbeiterhäuser, Relikte einer anderen Ära und einer anderen Klasse, ihres Drecks entledigt, liebevoll renoviert und durch den Chic der eigenen Schicht aufwertet, statt in ein Neubauviertel mit zeitgenössischer Architektur zu ziehen. Trotz seiner Nostalgie schafft dieser Akt jedoch auch etwas Neues, nämlich die soziale und ökonomische Aufwertung des Alten, sprich eine Teuerung, sowie die Neubesiedelung eines alten Viertels. Der Charme der Gentrifizierung: das vermeintlich Unzivilisierte der Umgebung, etwa die in Winzwohnungen hockenden »Arbeiter«, der Müll auf der Straße und die Alkoholiker im Stüberl am Eck, kann aus dem trauten Heim heraus gefahrlos beobachtet werden, zumindest in Vierteln, die sich für Gentrifizierung eignen, also einigermaßen sicher, ruhig und ökologisch aufwertbar sind. Kloakennostalgie ist somit eine Umschreibung für Elendsspotting aus sicherer Warte.
Daß sich dieser Prozeß beliebig oft wiederholen kann, zeigt Münchens aktuelle Gentrifizierungswelle: Obwohl die Stadt erst nach dem zweiten Weltkrieg boomte, erlebt sie bereits ihre zweite Aufhübschungsepisode, eine Art Postgentrifizierung. In den sechziger und siebziger Jahren drängelten die Künstler und dann die Kleinbürger in ehemalige Dörfer wie Schwabing oder Glasscherbenviertel wie Haidhausen. Mittlerweile leben in Schwabing die mittelständischen Schickimickis, in Haidhausen die Ökofamilien, die die Biomärkte leer kaufen und ihre Kinder statt zum Turnen zum Keramikmalen abkommandieren. Doch nun müssen allmählich auch sie um ihre Bleibe fürchten. Wurden früher – wie in Londons Viertel Islington – die Arbeiter durch die Middle Class verdrängt, geschieht dasselbe nun mit der Mittelklasse durch die Spitzenverdiener, deren ästhetisch-ideologische Maßstäbe bislang noch wenig beleuchtet wurden und sich von denen der alten Gentrifizierer sicherlich unterscheiden. Die ehemaligen Gentrifizierer werden also selber gentrifiziert. Die Mittelschicht wird aus den schönen, gewachsenen, sogenannten echten Stadtvierteln Münchens vertrieben. Dazu paßt, daß sich der Protest gegen diesen Wandel verbürgerlicht hat. Kunstaktionen wie die von Goldgrund sind der letzte Schrei. So zierte den ganzen Sommer über eine Installation des Künstlers Alexander Laner den schmucken Wittelsbacherplatz am Rande der Altstadt: eine in einen Denkmalsockel eingelassene Miniwohnung mit Dachterrasse, die man tageweise mieten und bewohnen durfte.
Doch selbst wenn das passierte, was die freie Marktwirtschaft, so es sie denn gäbe, verspricht, wenn die Nachfrage das Angebot erhöhte und an den Stadträndern Münchens neue Mietskasernen entstünden: Den akademischalternativen Mittelstand würde das nicht befriedigen. Schließlich soll ein Viertel nicht »sauber, glatt«, also keinesfalls neu gebaut sein, wie Gentrifizierungsgegner Uthoff im »Focus« betont. Da denkt er genauso wie die alten Gentrifizierer. In einem frisch hingeklotzten Plattenbauviertel samt Riesen-Aldi gelänge es nämlich nicht, das ästhetische Prinzip dieser Schicht zu realisieren: Laut dem englischen Kulturhistoriker Joe Moran will der mittelständische Gentrifizierer verlorene Schönheit wiederbeleben und ein buntes urbanes Dorf schaffen, was nur funktioniert, wenn Altbausubstanz und kleine Läden – und nicht der Riesen-Aldi – vorhanden sind. Für diese Menschen besteht in München kaum Hoffnung. Der Gratler hingegen und der Bürger, der auf seine Herkunft verzichten mag, haben noch eine Chance: Wer auf Ästhetik und gewachsene Viertel pfeift und Dorfläden in der Stadt zum Kotzen findet, möge einfach für gnadenloses Wachstum plädieren. Plattenbauten m Stadtrand, Mietskasernen im Naturschutzgebiet, Sozialwohnungen auf der Theresienwiese. Das Oktoberfest wird ausgelagert. Lieber häßlich und stillos leben als im kleinen Käfig aufeinanderhocken wie Joe Orton und Kenneth Halliwell. Wie das endet, wissen wir ja.
Reinhard Bauer/Ernst Piper: Kleine Geschichte Münchens. DTV, München 2008, 356 Seiten, 16,90 Euro
Hermann Wilhelm: Haidhausen. Münchner Vorstadt im Lauf der Zeit. München-Verlag, München 2009, 189 Seiten, 24,80 Euro
Joe Moran: »Early Cultures of Gentrification in London, 1955–1980«. In: »Journal of Urban History«, 34/ 2007
Katrin Hildebrand wohnt und arbeitet auf engem Raum in einem längst gentrifizierten Stadtteil Münchens