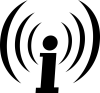Zu wenig Bewerber, zu viele Abbrecher, zu kurze Dienstzeit: Nach der Aussetzung der Wehrpflicht hat die Bundeswehr ein massives Nachwuchsproblem. Minister de Maizière redet die Lage schön.
Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) hat es derzeit nicht leicht. Seit dem Debakel mit dem Euro Hawk scheint das Pech an seinen Händen zu kleben. Nahezu jede Woche kommen neue Fehlleistungen seines Hauses ans Licht. Und dies, obwohl das Verteidigungsministerium nicht mehr in seiner "alten", viel gescholtenen Struktur arbeitet, sondern im Rahmen der Neuausrichtung der Bundeswehr seit April 2012 die von der "Weise-Kommission" und de Maizière selbst konzipierte Zielstruktur eingenommen hat.
Nun tut sich ein neues Problem auf, das in seiner Dimension allerdings einer Katastrophe gleich kommt. Es geht um die Personalentwicklung und deren planerische Bewältigung durch die Bundeswehrführung.
In einer Regierungserklärung vom 16. Mai erklärte der Verteidigungsminister hierzu apodiktisch: "Die geplanten Strukturen der Bundeswehr sind demographiefest." Was ja nichts anderes heißt, als dass die Personalplanung der Bundeswehr die teilweise dramatische Bevölkerungsentwicklung in Deutschland vorausschauend bewältigt hat.
Feststellungen des Ministers sind falsch
Doch davon kann keine Rede sein. Die zur Illustration dieses positiven Lagebildes in einem Vortrag in Celle am 22. Mai von de Maizière getroffenen Feststellungen, wonach die Ziele der Neuausrichtung der Bundeswehr im Bereich Personal schon bald erreicht sein würden –"quantitativ und qualitativ, über alle Statusgruppen hinweg" – sind allesamt falsch. Die Bundeswehr kann ihren Bedarf eben nicht, wie der Minister formulierte, "umfassend decken".
Von besonderer Dramatik ist die Situation bei den freiwillig Wehrdienstleistenden. Hier sieht die vom Parlament beschlossene Personalplanung vor, dass die 170.000 Berufs- und Zeitsoldaten durch 5000 bis 15.000 freiwillig Wehrdienstleistende ergänzt werden. Diese Dienstform wurde nach dem Ende der Wehrpflicht neu geschaffen und erlaubt Frauen und Männern, sich für 12 bis 23 Monate zu verpflichten.
Um ein angemessenes qualitatives Niveau zu garantieren, sieht die Bundeswehr für diese Personalkategorie ein Bewerberaufkommen vor, das doppelt so groß sein sollte wie die Anzahl der offenen Stellen. Letztere wiederum hängen davon ab, für welche Dienstzeit sich die akzeptierten Kandidaten verpflichten.
Legt man die Zahlen des Jahres 2012 zugrunde, dann liegt die durchschnittliche Verpflichtungsdauer bei 15 Monaten. Daraus ergibt sich ein jährlicher Ergänzungsbedarf zwischen 4000 (bei 5000 freiwillig Wehrdienstleistenden) und 12.000 (bei 15.000 freiwillig Wehrdienstleistenden). Will man mit zwei Bewerbern pro Stelle planen, bedeutet dies ein Bewerberaufkommen von 8000 bis 24.000 Personen.
Die Jahrgänge werden schrumpfen
Da sich jedoch schon wenige Monate nach der Einführung dieses neuen Dienstkonzepts abzeichnete, dass die Bewerberzahlen in jedem Fall – und mit sinkender Tendenz – deutlich unter dem erforderlichen Soll liegen würden, stellte die Bundeswehrführung schon ab 2012 nur noch Mittel für 12.500 freiwillige Wehrdienstleistende in den Haushalt ein. Hierfür waren etwas mehr als 20.000 Bewerber erforderlich, die nach Aussagen der Bundeswehr in den Jahren 2011 und 2012 auch zur Verfügung standen.
So weit, so gut. Doch damit beginnen die Probleme erst. Zum einen haben 25 bis 30 Prozent der neu Eingestellten das Dienstverhältnis innerhalb der ersten drei Monate gekündigt. Die Zahl der faktisch freiwillig Wehrdienstleistenden sank deshalb auf knapp 9000. Hinzu kommt, dass für das Jahr 2012 noch die Restbestände von zwei doppelten Abiturjahrgängen als potenzielle Bewerber zur Verfügung standen. Das wird in den kommenden Jahren nicht mehr der Fall sei.
Die Zahlen für die beiden ersten Quartale des Jahres 2013 sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache. Im Januar 2013 konnten nur noch 1607 Personen verpflichtet werden. 2012 waren es zu diesem Stichtag immerhin noch 2720 gewesen. Im April 2013 traten nur noch 615 Wehrdienstleistende ihren Dienst an – im Vergleich zu 1460 Freiwilligen im April 2012. Im Juli 2013 meldeten sich 1884 Freiwillige zum Wehrdienst. Das ist immerhin nur ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr (1892).
Jedenfalls hat sich die Bundeswehrführung angesichts dieser Entwicklung klammheimlich auf die sinkenden Bewerberzahlen eingestellt und lautstark verkündet, die Bundeswehrreform sei auf eine Größenordnung von 5000 freiwilligen Wehrdienstleistenden hin konzipiert. Es ist daher auch nur noch von einem Bewerberaufkommen von maximal 10.000 die Rede. Der Bedarf sei somit "hinreichend gedeckt"; die Zahlen ließen "optimistisch in die Zukunft" blicken.
Eine klassische Milchmädchenrechnung
Doch dies ist eine klassische Milchmädchenrechnung. Etwas mehr als die Hälfte der freiwillig Wehrdienstleistenden haben sich für weniger als 15 Monate verpflichtet. Sie scheiden daher nach Ausbildung und Qualifikation für eine Teilnahme an Auslandseinsätzen aus. Das Konzept bringt daher nicht, wie ursprünglich vorgesehen – und von der "Weise-Kommission" nachhaltig befürwortet – zusätzliches Personal für Auslandseinsätze und damit eine Entlastung für die ebenfalls auf Rand genähte Truppe der Zeit- und Berufssoldaten.
Im Klartext: Nur etwa 2000 bis 3000 freiwillig Wehrdienstleistende erfüllen die vorgegebenen Voraussetzungen für eine sinnvolle Verwendung. Damit hat sich das Konzept des freiwilligen Wehrdienstes erledigt.
Niemand kann unter Nutzen-Kosten-Gesichtspunkten eine vergleichsweise kostspielige Infrastruktur erhalten, wenn am Ende ein Bagatellgewinn steht. Die viel zitierte "Kultur der Freiwilligkeit" hat offensichtlich ihre Grenzen - zumindest was einen militärischen Dienst anlangt. Hinzu kommt, dass der Bedarf der Wirtschaft an qualifizierten Berufsanfängern ständig steigt. Derzeit sind bereits mehr als 100.000 Stellen unbesetzt. In der Konkurrenz zur freien Wirtschaft aber hat die Bundeswehr kaum eine Chance.
Bundeswehr braucht 60.000 Bewerber pro Jahr
Doch de Maizière hat nicht nur massive unlösbare Probleme mit den freiwillig Wehrdienstleistenden. Auch im Bereich der Berufs- und Zeitsoldaten fehlt es an qualifiziertem Personal. Um eine Personalstärke von 170.000 Soldaten dauerhaft aufrecht erhalten zu können, hat die Bundeswehr einen jährlichen Ergänzungsbedarf von 16.000 Soldatinnen und Soldaten.
Da man aus guten Gründen davon ausgeht, dass die erforderliche Qualitätssicherung drei Bewerber pro freier Stelle erfordert, braucht es ein Bewerberaufkommen von rund 50.000 Soldatinnen und Soldaten.
Zusammen mit den 10.000 Bewerbern, die derzeit noch für das Konzept des freiwilligen Wehrdienstes angestrebt werden, ergibt sich für die Bundeswehr insgesamt ein Bedarf von 60.000 Bewerbern pro Jahr. Und dies bei künftigen Jahrgangsstärken von 650.000 jungen Frauen und Männern. Gewonnen werden müssen diese Bewerber aus je 325.000 Frauen und 325.000 Männern – jedoch nicht zu gleichen Teilen.
Da die Bundeswehr aus dem Frauenanteil nur Verwendungen für zehn Prozent anbieten kann, müssen aus dem gleich großen Männeranteil 90 Prozent der Bewerber generiert werden. Das aber heißt, dass mindestens jeder sechste junge Mann sich freiwillig bei der Bundeswehr bewerben müsste. Das ist nach allen Erfahrungen utopisch. In der absichtsvoll verschleiernden Rhetorik de Maizières heißt dies "ehrgeizig, aber möglich".
Für die Laufbahn der Mannschaften, Unteroffiziere und Feldwebel fehlen circa 20.000 bis 30.000 Bewerber pro Jahr, wenn die Bundeswehr ihr bisheriges Modell der qualitativen Bedarfsdeckung weiterhin anwenden will, wonach für eine offene Stelle drei Bewerber benötigt werden.
Lösung: Berufsarmee mit 150.000 Soldaten
Würde die Bundeswehr sich mit zwei Bewerbern pro offener Stelle zufrieden geben – ein Albtraum für jeden Personalchef – würde eintreten, was der Generalinspekteur schon zu Guttenbergs Zeiten vorhersah: die Bundeswehr müsste in erheblichem Umfang Personal einstellen, das sie bisher wegen Qualitätsdefiziten nie eingestellt hätte.
Die gegenwärtige Personalplanung der Bundeswehr ist unrealistisch und alles andere als "demographiefest". Die Alternative für die Zukunft heißt auf der einen Seite ersatzlose Streichung des freiwilligen Wehrdienstes. Für den Bereich der Berufs- und Zeitsoldaten gibt es darüber hinaus zwei Möglichkeiten: entweder kleiner oder schlechter.
Die Reaktion der Bundeswehrführung müsste vor diesem Hintergrund eigentlich klar sein. Die Bundeswehr, die das faktische Fehl von 20.000 bis 30.000 Bewerbern für die Laufbahn der Mannschaften, Unteroffiziere und Feldwebel nicht qualitätsneutral ausgleichen kann, muss auf circa 150.000 Soldatinnen und Soldaten verkleinert werden.
Das entspräche im Übrigen auch der finanziellen Lage. Die Bundeswehr ist inzwischen so klamm, dass sie nur noch 21,4 Prozent ihres Etats für Verteidigungsinvestitionen ausgeben kann. Das ist konkurrenzlos wenig – sowohl im internationalen Vergleich als auch gegenüber früheren Jahren.
Der Autor Hans Rühle war von 1982 bis 1988 Leiter des Planungsstabes im Bundesministerium der Verteidigung.