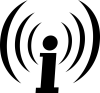Thomas Schmid in der Frankfurter Rundschau
In kleinen Städten wie Tataouine begann vor zwei Jahren der arabische Frühling. Jetzt herrschen in Tunesien die Islamisten – und haben den Winter zurückgebracht. Die Jugendlichen, von denen die Revolution ausging, haben von ihr kaum profitiert.
Es ist eine Augenweide: Tücher in leuchtenden Farben. Datteln, Safran und getrocknete Pfefferschoten, aus denen die scharfe Harissa-Paste hergestellt wird. Mit ihr würzen die Tunesier Fleisch, Suppe und Nudeln. In einer Mauernische zwischen zwei Ständen sitzt ein Mann, eingehüllt in einen Burnus, einen braunen Wollmantel mit Kapuze, das traditionelle Gewand der Berber, das an eine Mönchskutte erinnert. Er zerkrümelt braune Blätter, füllt den Kautabak in Plastikbeutelchen ab. Der Souk, der prächtige Markt, strahlt in allen Farben. Ansonsten ist Tataouine eine recht trostlose Stadt, eintönig, grau, staubig, kein Ort, an dem man verweilen mag.
Tataouine liegt im Süden Tunesiens, 50 Kilometer vom Meer entfernt, am Rand der Wüste. Nicht von Tunis, der Hauptstadt im Norden, sondern von solchen Städten im Landesinnern und im vernachlässigten Süden ging die Jasmin-Revolution aus, die heute vor zwei Jahren – am 14. Januar 2011 – den langjährigen Diktator Zine el Abidine Ben Ali ins Exil trieb und den gesamten arabischen Raum erschütterte: In Ägypten stürzte der Pharao Husni Mubarak, in Libyen der Führer Muammar Gaddafi, und in Syrien setzt Baschar al-Assad, im Kampf um seine Macht, schon die Luftwaffe ein.
Auch in Tataouine gingen Jugendliche auf die Straße und forderten Arbeit, Freiheit und „karama“, ein Leben in Würde, ein Ende der „hogra“, der täglichen Erniedrigung durch Schikanen einer allmächtigen Bürokratie. Auch Tataouine bezahlte seinen Blutzoll. Drei Jugendliche wurden an den letzten beiden Tagen der Diktatur, am 13. und am 14. Januar, von der Polizei erschossen. Die „Märtyrer der Revolution“ heißen Nadhir Moumen, Mohamed Ben Salah und Mohamed Dehim, sie waren 26, 20 und 19 Jahre alt. Die Namen kennt jeder in der Stadt.
Milizen der Partei
„Wir dürfen sie nicht vergessen“, sagt Zorghani Chrif, der im Zentrum von Tataouine das „Excellence“ führt, eine verrauchte Kaffeestube, „ohne Jugendliche wie sie würden wir hier nicht zusammen sitzen und frei reden.“ Chrif, 40, ein bulliger Mann mit Schnäuzer und sorgfältig gestutztem Kinnbart, hat nach der Flucht des Diktators zusammen mit einigen Freunden sofort ein „Komitee zum Schutz der Stadt“ gebildet. Der Bürgermeister war getürmt, die öffentliche Verwaltung war zusammengebrochen und die Polizei war von der Bildfläche verschwunden. Es bestand die Gefahr von Plünderungen. „Wir schützten die öffentlichen Gebäude, den Marktplatz, Parteiversammlungen“, erinnert sich Chrif, „und auch Hochzeiten – die werden bei uns in Tataouine ja auf der Straße gefeiert.“
Aus dem „Komitee zum Schutz der Stadt“ wurde schon bald eine „Liga zum Schutz der Revolution“, die nun Ende Dezember per Gerichtsbeschluss seine Tätigkeit für zwei Monate einstellen musste – wegen Ereignissen, über die noch zu berichten sein wird. Chrif wäre es lieber gewesen, wenn die Liga gleich für immer verboten worden wäre. Im Laufe des vergangenen Jahres haben die Islamisten sie unterwandert und schließlich wurde sie faktisch zur Miliz der Ennahdha, die im Oktober 2011 die Wahlen gewonnen hat. Landesweit hatte die islamistischer Partei 37 Prozent erhalten, in Tataouine waren es 60 Prozent. „Der Süden Tunesiens ist traditionell konservativ“, sagt Chrif, „die Leute sind tief religiös, und deshalb haben sie Ennahdha gewählt. Auch weil die Islamisten unter der Diktatur am meisten geblutet haben. Hamad Jebali, seit einem Jahr Ministerpräsident, war 16 Jahre im Gefängnis, elf davon in strenger Einzelhaft.
Inzwischen unterhält Ennahdha in allen 24 Regierungsbezirken „Ligen zum Schutz der Revolution“, die sich oft als Schlägerbanden zur Einschüchterung der Opposition entpuppen. Aber nur in Tataouine schritt die Justiz ein. Und der Präsident der örtlichen Liga, Said Chebli, Religionslehrer am Gymnasium, sitzt jetzt in Haft. Das hat mit dem Mord an Lotfi Nagued zu tun. Vielleicht war es, juristisch betrachtet, auch nur Totschlag. Innenminister Ali Lârayedh sprach von einem Herzinfarkt, Staatspräsident Moncef Marzouki, ein ehemaliger Menschenrechtler, von Lynchjustiz und der 86-jährige Caid Essebsi, bis zu den Wahlen Übergangspremier und heute Chef von Nida Tounes, der inzwischen wohl größten Oppositionspartei, vom „ersten politischen Mord seit der Revolution“.
Mit Fäusten, Holzprügeln und Eisenstangen traktiert
Lotfi, 55 Jahre alt, war Stammgast im „Excellence“. Taher Nagued, Cousin und gleichzeitig Schwager des Opfers, kommt auch oft her. „Er saß immer am Tisch da hinten“, sagt er. An jenem Oktobertag aber, es ist bald drei Monate her, war Lotfi nicht hier. Also zogen die rund 200 Anhänger der Liga zum Schutz der Revolution, die wegen Lotfi vor dem „Excellence“ aufmarschiert waren, weiter zum Büro des Bauernverbandes, dessen lokaler Vorsitzender Lotfi war.“
Kaum hat der Schwager seine Erzählung begonnen, setzt sich im fast leeren Lokal ein Mann in schwarzer Lederjacke just an den Nebentisch. Einer mit zu großen Ohren. „Folgen Sie mir “, sagt Taher und steht auf. Er geht hoch auf die Dachterasse, hier kann man ungestört reden. Auch das erzählt einiges über Tunesien, zwei Jahre nach der Revolution.
„Dort vor dem Büro des Bauernverbandes“, setzt er auf der Dachterrasse seine Erzählung fort, „waren inzwischen über tausend Personen zusammengekommen. Sie schrien „Allahu akbar“ (Gott ist groß) und warfen Steine.“ Er habe alles genau gesehen, es war zwölf Uhr mittags und der Mob war keine hundert Meter von seinem Arbeitsplatz, einem Jugendzentrum, entfernt.
„Ich rief die Polizeidirektion an. Man sagte mir, die Polizei sei schon längst vor Ort. Aber sie war nicht da. Ich rief den Armeekommandanten an. Er versprach, Soldaten zu schicken. Sie kamen schließlich, stiegen aber aus ihrem Bus gar nicht aus, als Demonstranten das Büro bereits gestürmt hatten und Lotfi auf die Straße zerrten.“
Er muss auf der Treppe gestürzt sein, wurde mit Fäusten, Holzprügeln und Eisenstangen traktiert. Er war wohl schon im Koma, als er ins Krankenhaus gebracht wurde und dort, kaum angekommen, um 13.30 Uhr verstarb.
Nur eine Frau
Lotfi Nagued war nicht nur Präsident des lokalen Bauernverbandes, sondern auch Chef der örtlichen Sektion von „Nida Tounes“, einer Sammlungsbewegung, die versucht, ein Bündnis der laizistischen Kräfte zu schmieden. „Nida Tounes“ fordert die Auflösung der „Ligen zum Schutz der Revolution“, ein demokratischer Staat dürfe Parteimilizen nicht tolerieren, dürfe nicht hinnehmen, dass islamistische Schlägerbanden die Opposition einschüchtern.
Die örtliche Zentrale von Ennahdha liegt in einem unauffälligen grauen Gebäude unweit des farbenfrohen Marktes. Koranverse schmücken die Wand im Empfangsraum. Mohammed Boumkhla gehört der lokalen Führung der islamistischen Partei an. Er behauptet, die Ligen seien eine von Ennahdha unabhängige Organisation. Aber man habe eben gemeinsame Interessen. Der Politiker, der zur Zeit der Diktatur oft im Gefängnis gesessen hat, wendet sich vehement gegen eine Auflösung der Ligen, weil die Revolution des Schutzes bedürfe – vor den Angriffen jener, die „den Prozess“ destabilisieren wollen. Vor den Angriffen von „Nida Tounes“, die von Kräften der aufgelösten Partei des geflüchteten Diktators Ben Ali gesteuert werde. Im übrigen sei noch gar nicht geklärt, ob Lotfi bloß die Treppe hinuntergestürzt oder erschlagen worden sei.
Houga Nagued, 38, Lotfis Frau, schüttelt über solche Unverfrorenheit resigniert den Kopf. Noch immer wird sie von Islamisten eingeschüchtert – weil sie nicht schweigen mag. Doch wen interessiert es, dass sie anonyme Anrufe erhält, dass ihr ein Auto im Schritttempo folgt, wenn sie die Einkäufe nach Hause trägt? Kein Polizist, kein Ermittlungsrichter hat sie je vernommen. Der Cousin wurde angehört. Aber mit ihr hat niemand geredet, sie ist ja nur eine Frau. Dabei hätte sie einiges über die zahlreichen Drohungen berichten können. Zwei Wochen vor dem Tod ihres Mannes erschien auf Facebook die Nachricht: „Lotfi, den Galgen für dich haben wir nun aufgestellt – das ist die letzte Warnung.“ Sie hat ihren Mann gebeten, sich von der Politik zurückzuziehen. Doch der habe gelacht und gesagt, er lasse sich nicht einschüchtern.
Höchste Arbeitslosenrate Tunesiens
Dann holt Houga eine CD, legt sie in den Computer. Sie zeigt ein verwackeltes Video, das den Sturm auf das Büro ihres Mannes zeigt. Lotfi selbst sieht man auf dem Film nicht, nur Männer, die schreien, auf jemanden einprügeln, mit Füßen treten. Am Boden muss er gelegen haben, halb tot. Ihr kommen die Tränen, sie verscheucht ihre Kinder. Sie sollen das nicht zu sehen, diese entfesselte Gewalt, der ihr Vater zum Opfer fiel. „Hätte Lotfi doch auf mich gehört!“
Nun steht sie allein mit Nour, Mohamed, Achraf, Farouk, Saif und Fahad, ihren sechs Kindern im Alter zwischen zwei und zwölf Jahren. Einkünfte hat sie keine. Jeder der vier Brüder gibt ihr monatlich hundert Dinar, bleiben nach Abzug der Miete noch 250 Dinar, umgerechnet 125 Euro.
Fast 20 Jahre lang hatte Lotfi in Frankreich gearbeitet, ein kleines Restaurant in Paris geführt. 1995 war er zurückgekommen, hatte ein Jahr später geheiratet, ein Hamam, ein Badehaus, gekauft. Zuletzt wollte er außerhalb von Tataouine einen Vergnügungspark einrichten. Er war ein umtriebiger Mensch, hat nach Ausbruch des Krieges gegen Gaddafi die Hilfe für die libyschen Flüchtlinge organisiert. 30 000 waren damals, vor zwei Jahren, bei Familien im grenznahen Tataouine untergekommen, das selbst nur 60 000 Einwohner zählt. Houda geht zum Schrank, holt eine Urkunde und einen fein ziselierten Messingteller, auf dem Lotfis Name und der Dank der Flüchtlinge eingraviert sind. „Hätte er sich bloß nicht in die Politik eingemischt!“
Lotfi war ein Revolutionär der ersten Stunde. Wie Chrif, der Kaffeehausbesitzer, gehörte auch er dem „Komitee zum Schutz der Stadt“ an, das sich gleich nach der Jasmin-Revolution vor zwei Jahren gebildet hatte. „Wir waren acht Mitglieder“, sagt Ali Mourou, der heute als Schulinspektor arbeitet, „wir wollten eine Rückkehr des alten Regimes verhindern.“ Zwei Monate nach der Flucht des Diktators wurde Mourou zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Das Amt hatte er anderthalb Jahre inne, bis zum vergangenen Juli. Heute glaubt er, dass die Revolution scheitern wird, wenn es nicht gelingt, die wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Tatouine ist die Stadt mit der höchsten Arbeitslosenrate Tunesiens, landesweit sind es 18 Prozent, in Tataouine 52 Prozent.
Armut im Reichtum
Der Süden und das Landesinnere, die Wiege der Revolution, sind wirtschaftlich weiterhin abgehängt. „Ennahdha will alles kontrollieren, alles beherrschen“, sagt Mourou, „die Islamisten haben die Gesellschaft quasi unter Beschlag genommen. Aber sie haben keine Verwaltungserfahrung, keine Kompetenz, keine Vision.“ Und so hat der Schulinspektor eine Bürgerinitiative gegründet. Sie heißt schlicht „Für Tataouine“ und hat sich zum Ziel gesetzt, wirtschaftliche Perspektiven für die Stadt und die Region aufzuzeigen.
Bislang hat Tataouine vor allem auf den Wüstentourismus gesetzt. Doch das hat schon vor der Revolution nicht mehr funktioniert. Seit 2008 braucht man für einen Trip in die Sahara eine Sondererlaubnis. Man muss einen militärischen Geleitschutz bezahlen. Sind 2007 noch über 45 000 Touristen in die tunesische Wüste aufgebrochen, waren es letztes Jahr gerade noch 676. Am Tourismus hingen viele Arbeitsplätze.
Jobs sind rar in Tataouine. Im Regierungsbezirk liegen zwar die Öl- und Gasvorkommen Tunesiens. „Doch raffiniert wird das Öl im Norden, und verflüssigt wird das Gas an der Küste, und dort vor allem sind Arbeitsplätze entstanden “, sagt Mourou, „wir haben weltweit die zweit- oder drittgrößten Vorkommen an hochwertigem Gips, aber nur zwei kleine Fabriken, die zusammen 50 Arbeiter beschäftigen.“
In der reichsten Gegend Tunesiens sind die Menschen am ärmsten. Die Revolution hat die Islamisten, die an ihr keinen Anteil hatten, an die Macht gebracht. Die Jugendlichen aber, die alles riskierten, haben kaum etwas erreicht. Das ist ungerecht, aber das ist ja oft so bei Revolutionen.