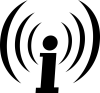In sozialen Kooperationen jenseits kapitalistischer Verwertung sieht Michael Hardt einen Garanten für den Fortbestand der Demokratie.
Marine Le Pen könnte am Sonntag französische Präsidentin
werden, Erdogan hat bereits sein Referendum gewonnen. Gleichzeitig haben
wir den Brexit, Donald Trump im Weißen Haus und Wladimir Putin in
Moskau an der Macht. Werden diese ganzen rechten Kräfte die Welt in ein
Desaster stoßen?
Dies sind zwar ganz unterschiedliche Politiker, aber man kann sie in der
Tat in einen Topf werfen. Aus einer US-Perspektive heraus muss man sich
vor allem daran erinnern, dass es ein globales Phänomen ist und Trump
ein Symptom von etwas Größerem, das eine wahrliche Gefahr darstellt.
Worin sehen Sie die Gefahr?
Alle diese Politiker und Bewegungen stehen für Merkmale, die man
traditionell mit dem Faschismus assoziiert. Dies zeigt sich etwa in den
Angriffen auf Medien und Justiz, die Androhungen massenhafter
Ausweisungen von Migranten, die Forderung nach »Rassenreinheit« als
Bedingung für nationale Zugehörigkeit und die Angriffe auf die
lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender und queeren
Gemeinschaften und vieles mehr. Doch die vermutlich größte
Gemeinsamkeit, die diese rechten Kräfte vereint, ist die Kombination aus
Neoliberalismus und Nationalismus. Es ist eine Mischung, die vor
einigen Jahren noch als unmöglich erschien und jetzt dazu genutzt wird,
gegen die etablierte politische Klasse und sogar gegen die Verwaltung zu
hetzen.
Was kann man gegen diese rechten Bedrohungen allerorten tun?
So wie die rechten Bewegungen eine globale Gefahr sind, müssen wir als
erstes eine genauso globale Protestbewegung dagegen aufbauen. Die
Verbindungen zwischen den feministischen Demonstrationen am 8. Mai in
Polen, Italien, Argentinien und den USA sind ein Beispiel, wie dies
laufen könnte. Und zweitens müssen wir einsehen, dass kein Kampf für
sich allein genommen genug ist. Friedensbewegungen, Arbeitskämpfe,
feministische, queere und antirassistische Bewegungen sind alle
notwendig. Sie müssen Wege finden, sich gemeinsam in einer Koalition zu
artikulieren. Und letztlich reichen Protest und Opposition nicht aus.
Wir müssen wirkliche soziale Alternativen entwickeln.
Es gibt also nicht das eine revolutionäre Subjekt, das die kleinen
und großen Putins und Trumps dieser Welt zu Fall bringen wird?
(Lacht) Nein. Wir müssen grundsätzlicher darüber nachdenken, welche
Subjektivitäten im Kampf gegen die ganzen Rechtspopulisten und für die
Befreiung federführend sein können. Da reicht es nicht aus, nur an die
industrielle Arbeiterklasse zu denken. Es ist auch nicht einfach eine
Frage des Rassismus oder Sexismus. Wir müssen es schaffen, alle Kämpfe
gegen alle Unterdrückungsformen zu erfassen und zu artikulieren.
Ist es das, was Sie und Antonio Negri mit dem Konzept der Multitude meinen?
Ja. Revolutionäre Bewegungen brauchen sich nicht auf eine einzige
Identität zu stützen. Im Gegenteil: Sie sind stärker, wenn sie die
ganzen sozialen Verschiedenheiten der Multitude zusammen artikulieren
können.
Heißt das, dass die ökonomische Frage keine Rolle mehr spielt?
Klassenkämpfe bleiben weiterhin wichtig. Aber es sind nicht die einzigen Kämpfe, die wir führen müssen.
Ist das nicht auch so, weil die Arbeiterklasse nicht nur weiß,
männlich und heterosexuell ist, sondern auch schwarz, weiblich und
queer?
So kann man es ganz praktisch sehen. Es hat aber vor allem auch noch eine andere Seite.
Welche Seite wäre das?
Es gibt nicht den einen Hauptwiderspruch, unter den sich alle anderen
subsumieren lassen. Es ist nicht so, dass der Klassenkampf oder der
Kampf gegen Sexismus oder gegen Rassismus zuerst geführt werden muss und
alle anderen Kämpfe sich dem unterordnen müssen. Das Wichtigste ist zu
verstehen, dass alle diese Bewegungen gleich wichtig und nur stark sind,
wenn sie gemeinsam geführt werden.
Die traditionellen Marxisten machen also einen Fehler, wenn sie
alles unter dem Mantel der Klassenkämpfe vereinheitlichen wollen?
Das war ein Fehler der Marxistinnen und Marxisten in der Vergangenheit.
Heutzutage denken die meisten Marxistinnen und Marxisten die
Grundprinzipien der Multitude mit. Sie sehen die praktische und
theoretische Notwendigkeit, dass man die unterschiedlichen Achsen der
Unterdrückung und die Kämpfe dagegen miteinander verbinden muss.
Zudem ist der Bezug auf eine einheitliche Identität etwas, das rechtspopulistischen Bewegungen eigen ist.
Ein wichtiges Element der rechten Bewegungen in Nordamerika und Europa
ist deren Wunsch nach einem Zurück in eine Vergangenheit, in der es nur
eine einzige, rein nationale Identität gab. Dies zeigt sich in deren
Forderung nach Ausweisung von Migranten. Doch die Vergangenheit, die sie
sich da zurückwünschen, gibt es nur in ihren Köpfen, sie widerspricht
jeglichen historischen Realitäten.
Wenn Sie sagen, dass alle Kämpfe zusammengehen sollen, könnte dies
auch für die sozialen Bewegungen bedeuten, im Kampf gegen den
Rechtspopulismus eine strategische oder taktische Allianz mit
neoliberalen Kräften einzugehen?
Diese Frage kann man nicht allgemeingültig beantworten. Es war natürlich
sinnvoll, bei den Präsidentschaftswahlen für Hillary Clinton und gegen
Donald Trump zu stimmen. Da traten zwei neoliberale, aber sehr
unterschiedliche Personen gegeneinander an. In diesem Sinne war ein Ja
für Clinton zwar noch keine Allianz mit ihr, aber trotzdem wäre man mit
ihr als Präsidentin besser dran als jetzt unter Trump. Insofern ist es
auch äußerst wichtig geworden zu analysieren, welche Verbindungen es
zwischen dem Neoliberalismus und ex-trem rechten und oft auch
faschistischen Tendenzen gibt.
Was ist mit Wahlen? Könnte es für die sozialen Bewegungen nicht
auch sinnvoll sein, an Wahlen teilzunehmen oder sogar ein Teil von
Regierungen zu werden?
Die Teilnahme an Wahlen kann durchaus positive Auswirkungen haben, vor
allem wenn man sie nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu sozialen
Bewegungen ansieht. Die jüngsten Wahlkampfexperimente in Spanien - von
Podemos bis zu den Regionalwahlen in Barcelona und Madrid - haben so
funktioniert. Doch man sollte im Hinterkopf behalten, dass progressive
Parteien oft in ihrer Macht beschränkt werden, wenn sie die Wahlen
gewonnen haben. Das Scheitern der SYRIZA-Regierung in der griechischen
Schuldenkrise während des Sommers 2015 ist ein schmerzhaftes Beispiel
dafür.
Fehlen der Linken nicht auch charismatische
Führungspersönlichkeiten, wie es die großen Bewegungen des 20.
Jahrhunderts etwa mit Fidel Castro, Martin Luther King oder Rudi
Dutschke hatten?
In den vergangenen 40 Jahren haben die sozialen Bewegungen und die
Freiheitsbewegungen sich gegen charismatische Führer und eine zen-trale
Führung gewendet. Das haben sie auch richtig gemacht. Sie taten dies im
Namen der Demokratie und Partizipation.
Diesen Punkt machten Sie mit Toni Negri auch in Ihrem letzten Buch
»Demokratie! Wofür wir kämpfen« stark. Da schrieben Sie am Ende: »Wenn
es keine Anführer und Parteilinien gibt, dann bedeutet dies keineswegs
Anarchie, verstanden als Chaos und Aufruhr. Wenn wir glauben würden,
dass sich politische Projekte nur mit Hilfe von Führern und zentralen
Strukturen organisieren lassen, dann wäre dies ein bedauernswerter
Mangel an politischer Fantasie!«
Das sind zwei schöne Sätze, die immer noch gelten. Aber man darf den
Widerstand gegen eine zentrale Führung und einen Führer nicht mit der
Ablehnung von Organisationen und Institutionen an sich verwechseln. Zu
glauben, dass der Horizontalismus ein Selbstzweck sei, ist ein Fehler.
Wie meinen Sie das?
Zuletzt begann 2011 ein großer Bewegungszyklus. Es war die Zeit der
großen Platzbesetzungen. Sie begann in Nordafrika, Ägypten und Tunesien,
aber kam auch nach Europa, Spanien, Griechenland, die USA mit Occupy
Wall Street, Brasilien und in die Türkei mit den Gezi-Park-Protesten.
Doch diese Bewegungen hatten neben ihrer Ausrichtung aufs Lokale eins
gemein: die irgendwann um sich greifende Enttäuschung über die mangelnde
Langlebigkeit, und dass es ihnen nicht möglich war, wirkliche soziale
Transformationen in die Wege zu leiten.
Und was diesen Bewegungen Ihrer Meinung nach fehlte, war eine Führung?
Toni Negri und ich beschäftigen uns in unserem neuen Buch mit der
Notwendigkeit, wirklich demokratische Strukturen aufzubauen, mit denen
gleichzeitig Aufgaben erfüllt werden können, die bisher normalerweise
von Führungspersonen erledigt werden. Die entscheidende Frage ist also,
wie man effektive und langlebige Organisationen aufbauen kann, die eben
nicht auf charismatische Führer oder eine zentrale Führung von oben
herab angewiesen sind.
Der Schwachpunkt der gegenwärtigen Bewegungen ist für Sie das, was Sie deren Horizontalismus nennen. Was verstehen Sie darunter?
Die Art von Horizontalismus, die ich dabei im Kopf habe, könnte man am
besten anhand der Platzbesetzungen und anderen Formen des Widerstandes
aufzeigen. Kurz gesagt waren das führungslose Bewegungen. Ich lehne
dabei nicht deren Wunsch nach Demokratie ab, aber diese Bewegungen waren
nicht erfolgreich. Manchmal waren sie zwar vorübergehend sehr mächtig,
aber sie waren eben immer nur sehr kurzlebig und nie kontinuierlich.
Heißt das, dass soziale Bewegungen neue Hierarchien brauchen?
Die Ablehnung eines solchen Horizontalismus bedeutet kein Zurück zu
alten zentralistischen und hierarchischen Strukturen. Toni Negri und ich
schlagen stattdessen vor, das Verhältnis von Taktik und Strategie auf
den Kopf zu stellen. Die Taktik für die Führung und die Strategie für
die Multitude. Dies könnte helfen, ein Projekt zu entwickeln, um aus der
gegenwärtigen Sackgasse zu kommen, die nur Hierarchien oder
Horizontalismus zulässt. Stattdessen müssen wir jetzt über eine radikal
andere Zukunft nachdenken. Was heute gefragt ist, sind die Kreativität
und Vorstellungskraft der Bewegungen, um eine wirkliche Alternative zu
entwickeln.
Was meinen Sie damit?
Traditionellerweise war es in revolutionären Bewegungen so, dass die
großen, wichtigen und langfristigen Entscheidungen von der Führung
getroffen wurden. Den anderen blieb nur die taktische Umsetzung dieser
Entscheidungen. Um dies zu legitimieren, wurde immer behauptet, dass die
Partei für die Strategie zuständig sein müsse, weil die Gewerkschaften
und andere kämpfenden Kräfte nicht das große Ganze im Blick haben
könnten und sich deswegen auf ihre kleineren taktischen Rollen
beschränken sollten.
Dem ist wohl nicht so …
Die Multitude ist sehr wohl in der Lage, demokratisch langfristige und
strategische Entscheidungen zu fällen. So muss es auch sein. Wichtige
Entscheidungen müssen so basisdemokratisch, wie es nur geht, getroffen
werden.
Birgt Ihr Vorschlag, einer Führung nur noch taktische und
strategische Entscheidungen die Multitude fällen zu lassen, nicht auch
noch Gefahren. Schließlich könnte man zum Beispiel Trumps Entscheidung,
Assad zu bombardieren, zunächst als relativ unbedeutende, taktische
Angelegenheit interpretieren, die auf lange Sicht aber massive Folgen
haben konnte. Wo ist da der Unterschied zwischen Taktik und Strategie?
Es stimmt, dass die Unterscheidung zwischen Taktik und Strategie aus dem
Militär kommt. Es ist sogar eine sehr alte Tradition, so zu
unterscheiden. Das alte griechische Wort Strategie bezeichnet die
Feldherrnkunst, der Stratege, oder Strategos, ist der General, der das
Heer im Feld lenkt. Doch um Ihre Frage zu beantworten, würde ich gerne
vom Beispiel Trump weggehen.
Gerne.
Meine Freunde in den sozialen Bewegungen sind nämlich genauso skeptisch.
Sie sagen, dass es sich nett anhöre, aber es nicht möglich sei, Macht
zu begrenzen. Wenn man einer Führungsebene etwas zugestehen würde, dann
wäre ihr das nie genug. Sie würde immer mehr Macht an sich reißen.
Was entgegnen Sie Ihren Freunden auf diese Angst?
Die entscheidende Frage bleibt, wie es der Multitude gelingt, wirklich
demokratische Strukturen zu schaffen, in denen sie die Verantwortung für
strategische Entscheidungen übernehmen kann. Gelingt ihr dies, dann
wird sie auch die Macht einer Führung auf taktische Fragen beschränken
können.
Aber besteht nicht auch die Gefahr, dass sich die taktische Ebene
zur Herrschaft eines bürokratischen Apparats verselbstständigt, wie es
einst im real existierenden Sozialismus der Fall war?
Gegen genau solche Sachen argumentieren Toni Negri und ich. Die
Entscheidungsstrukturen der sowjetischen Bürokratie waren genauso von
oben herab und zentralistisch wie die in kapitalistischen Staaten.
Stattdessen geht es darum, demokratische Mechanismen zu schaffen, wie es
sie auf beiden Seiten im Kalten Krieg nicht gab. Dabei geht es nicht
darum, per se alle Institutionen abzulehnen. Sondern es geht um die
Schaffung von nicht-zentralistischen und nicht-bürokratischen
Institutionen. Und das ist für mich alles andere als ein absurdes
Unterfangen. Tatsächlich bewegen sich die sozialen Bewegungen sogar
bereits in diese Richtung.
Das hört sich nach der Schaffung von Institutionen an, die von der
Multitude für die Multitude sind, ähnlich wie man früher von der Klasse
an sich und für sich gesprochen hat.
Das könnte man durchaus so sehen. Es gibt auch eine lange Tradition, die
Demokratie als die Regierung von den Menschen für die Menschen ansieht.
Diese Phrase wurde vor allem in der frühen US-Geschichte verwendet.
Doch das politische System der Vereinigten Staaten hat in Wirklichkeit
äußerst wenig mit diesem Prinzip zu tun.
Sie zögern, diese Redewendung von der Klasse oder Multitude an und für sich zu verwenden.
Dieses Konzept impliziert im traditionellen hegel-marxistischen Sinn,
dass es so etwas wie ein richtiges Bewusstsein brauche, um den
Kapitalismus und alle anderen Herrschaftsverhältnisse zu durchschauen.
Als ob es einen Lehrer brauche, der der Multitude erst zeigen müsse, was
ihre wahren Interessen sind.
Welche Rolle könnten digitale Medien und Künstliche Intelligenz in
Ihren neuen radikaldemokratischen Institutionen spielen? Könnten
Meinungsbildungsprozesse nicht über Onlinebefragungen ablaufen und der
Rest, der dann noch an taktischen Führungsaufgaben bleibt, von einem
Algorithmus übernommen werden?
Digitale Werkzeuge können die kollektive Entscheidungsfindung wunderbar
vereinfachen. Bei den Platzbewegungen von 2011 wurde bereits vielerorts
mit Umfragen über Soziale Netzwerke als Mittel zur Entscheidungsfindung
experimentiert. Doch diese Werkzeuge können nur helfen. Algorithmen
können eine demokratische Entscheidung nicht ersetzen.
Wie könnten diese Strukturen, die Ihrer Meinung nach jetzt aufgebaut werden müssen, dann ausschauen?
Eine Sache, auf die sich Toni Negri und ich uns bei der Arbeit zu
unserem neuen Buch hinsichtlich dieser Frage konzentriert haben, ist das
Konzept der Kooperation. Schließlich gibt es in immer mehr Bereichen
soziale Kooperationen, die außerhalb des Kommandos des Kapitals liegen.
Das Kapital versucht immer mehr, sich die Werte der Produkte dieser
sozialen Kooperationen anzueignen. Andererseits kann ein Verständnis,
wie diese Kooperationen funktionieren, dabei helfen, neue demokratische
Strukturen zu schaffen. Negri und ich rufen deshalb auf, sich das
fixierte Kapital wieder anzueignen.
Wie meinen Sie das?
Es gibt immer mehr Beispiele, wie digitale Algorithmen benutzt werden,
um menschliche Intelligenz auszubeuten und zu akkumulieren. Ein
Beispiel, wie das Kapital da auf soziale Kooperation außerhalb seines
Bereiches zurückgreift, ist der Page-Rank-Algorithmus von Google. Mit
seiner Hilfe bewertet der Konzern Internetseiten nach ihrer Popularität
und Wichtigkeit. Er ist sozusagen das Herzstück der Suchmaschine. Doch
ohne die ganzen Daten, die die Menschen tagtäglich ins Netz stellen,
wäre dieser Algorithmus wertlos. Und die Google-Nutzer werden nicht
bezahlt, obwohl sie mit ihrer Intelligenz und den Verbindungen und
Suchanfragen, die sie im Netz erstellen, zum ökonomischen Wert des
Konzerns beitragen. Dies zeigt, wie häufig versteckte Arbeit Werte
schafft. Insofern könnte die Wiederaneignung dieses Werkzeuges durch die
Multitude durchaus ein schönes Projekt sein.
Das klingt so, als ob die Ausbeutung heutzutage nicht mehr in
miefigen Sweatshops stattfindet, sondern in schicken Coworking Spaces.
Das trifft nur für die obersten Schichten der Arbeitskräfte zu.
Zumindest von Traditionalisten wurde Ihnen vorgeworfen, mit Ihrem
Konzept der immateriellen Arbeit, die Marxsche Arbeitswerttheorie über
den Haufen geworfen zu haben.
Die kapitalistische Produktionsweise kann nur mithilfe der Ausbeutung
von Arbeit funktionieren. Da ist es egal, ob das Produkt der Arbeit eine
materielle oder immaterielle Ware ist. Die Prinzipien der
kapitalistischen Produktionsweise gelten auch für die immaterielle
Arbeit. Egal ob sie darin besteht, kreativ in einem Raum zu sitzen und
Ideen zu produzieren oder sogenannte Klick-Arbeiten durchzuführen, die
routinierte digitale Tätigkeiten sind. Das Entscheidende am Konzept der
immateriellen Arbeit ist, dass die Schaffung von Wissen oder Care- und
Sorgearbeiten immer auch Werte produzieren, egal ob diese Arbeiten
bezahlt werden oder nicht. Und bei der Aufdeckung dieser versteckten
Arbeiten stehen Toni Negri und ich in der Tradition der marxistischen
Forschung.
Gleichzeitig wird es für die Konzerne tendenziell immer
schwieriger, Profite zu machen, weil die Grenzkosten für immaterielle
Waren, also die Kosten um ein weiteres Exemplar herzustellen, gleich
null sind. Sie können also unendlich oft reproduziert werden, ohne dass
es etwas kostet.
Viel wichtiger als der ökonomische ist dabei der demokratische Aspekt.
Die digitale Sphäre verweist mit ihrer unendlichen Reproduzierbarkeit
auf ein Gemeinsames, das außerhalb privaten und staatlichen Besitzes
ist. Denn das Wesentliche am Eigentum ist, dass es immer ein Monopol und
eine Kontrolle über etwas darstellt. Genau dieses Monopol gilt es zu
brechen. Und die Sphäre der gemeinschaftlichen Produktion schafft immer
einen Raum für Widerstand gegen das Kapital sowie zur Entwicklung von
Alternativen.
Die Revolution findet also im Digitalen statt?
Es geht nicht allein um die digitale Welt. Es geht auch nicht allein
darum, ob etwas unter gemeinschaftlicher Kontrolle produziert wurde.
Mindestens genauso wichtig ist der Umgang mit den natürlichen Ressourcen
- der Erde und ihren Ökosystemen. Auch dieser muss demokratisch und
gemeinschaftlich bestimmt werden.
Das erste große Buch, das Sie zusammen mit Toni Negri geschrieben
haben, »Empire«, gilt als die Bibel der globalisierungskritischen
Bewegung, mit Ihrem letzten Buch gaben Sie den Bewegungen der Plätze
einen Ausdruck. Könnte ein neuer Bewegungszyklus der Träger der Gedanken
Ihres neuen Buches sein?
Das hoffe ich. Die globalisierungskritische Bewegung startete, als wir
»Empire« schon geschrieben, aber noch nicht veröffentlicht hatten. Ich
erinnere mich noch daran, als wir das Buch abgegeben hatten und dann die
Proteste von Seattle kamen. »Die verstehen besser, was abgeht, als wir
es tun«, dachte ich damals. Manchmal haben die Menschen auf der Straße
nämlich denen in den Bibliotheken etwas voraus. Man braucht zwar beide,
aber wirkliche Innovationen entstehen allein in den Diskussionen und
Aktionen der sozialen Bewegungen.
Im Juli wird in Hamburg das G20-Treffen stattfinden. Donald Trump,
Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin werden anwesend sein wie
Gastgeberin Angela Merkel. Mit ihnen kommt aber auch der Protest gegen
sie in die Stadt. Wird Hamburg im Juli ein Ort sein, wo eine Alternative
zum entsetzlichen Status quo sichtbar werden kann?
Mindestens seit dem WTO-Treffen 1999 in Seattle waren Proteste gegen
Gipfeltreffen extrem wichtig für die Bewegungen, um ihren Widerstand
gegen die nationalen und globalen Machtstrukturen sichtbar zu machen.
Die Proteste gegen das G20-Treffen in Hamburg werden womöglich noch
wichtiger als andere Proteste der vergangenen Jahre sein, weil sich hier
die erfolgreichen Rechtspopulisten mit den Neoliberalen verbinden. Aber
so wichtig natürlich diese Demonstration des Widerstands ist, sie ist
nicht genug. Notwendig ist es, Strukturen zu schaffen, die über den Juli
hinaus bestehen bleiben. Jetzt ist die Zeit, Großes zu tun.
Michael Hardt
Michael Hardt ist US-amerikanischer Literaturtheoretiker an der Duke University in Durham, North Carolina. Gemeinsam mit Antonio Negri veröffentlichte er 2000 das Buch »Empire«. Die Autoren versuchten in diesem Bestseller, die aktuelle Weltordnung zu beschreiben, in der die Macht unser Leben durchzieht. Dem Empire steht die »Multitude« gegenüber, eine Art gewandeltes Proletariat, ein neuartiges widerständiges Subjekt oder die Bewegung der Vielen. Negri und Hardt schreiben derzeit an einem Buch mit dem Titel »Assembly«, das im Oktober erscheinen soll. Hardt redet diesen Samstag in der Berliner Volksbühne. Mit ihm sprach Simon Poelchau.