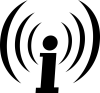Katharina König erlebte im Jena der neunziger Jahre, wie Neonazis Jagd auf sie und ihre FreundInnen machten. Heute sitzt sie für die Partei Die Linke im Thüringer Landtag und kämpft im Parlament gegen die rechte Szene. Ein Gespräch über die Wichtigkeit antifaschistischer Arbeit angesichts des Rechtsrutschs in Europa und der neonazistischen Mordserie des NSU.
Von Jan Jirát (Interview) und Anne Morgenstern (Fotos)
WOZ: Katharina König, Sie stammen aus Jena in Thüringen. Wie Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe, die Hauptmitglieder des Nationalsozialistischen Untergrunds, der zwischen 2000 und 2007 mutmasslich zehn Menschen ermordete. Sie gehören derselben Generation an wie dieses NSU-Kerntrio. Kannten Sie die drei vor deren Untertauchen 1998?
Katharina König: Ja. In der Form, dass wir uns
gegenüberstanden. Alle, die sich in Jena Mitte der neunziger Jahre gegen
rechts engagierten, kannten sie. Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe waren
in der lokalen Neonaziszene aktiv, die ab 1995 regelrecht Jagd auf Linke
und Antifaschisten machte.
Jagd?
Die linksalternative Szene traf sich damals in der JG, der Jungen
Gemeinde Stadtmitte. Es war einer der wenigen Orte, an denen die
Neonazis keinen Zutritt hatten. Jeden Dienstag fand ein Plenum statt,
und ab 22 Uhr warteten die Neonazis in der Nähe der JG, um Leute auf dem
Nachhauseweg abzupassen. Auf die Männer gingen sie mit
Baseballschlägern los, Frauen wurden beispielsweise glühende Zigaretten
ins Décolleté gedrückt.
Wie haben Sie sich vor solchen Angriffen geschützt?
Mein Vorteil war, dass ich direkt im Stadtzentrum wohnte. Die Leute aus
den Aussenquartieren wie Lobeda oder Winzerla, wo auch das NSU-Kerntrio
herkam, waren akuter bedroht. Ab und an bezahlte die JG eine Taxifahrt.
Grundsätzlich galt, möglichst nie alleine unterwegs zu sein. Als die
Jagden begannen, fingen auch wir an, uns zum Schutz zu bewaffnen. Einige
hatten Schreckschusswaffen, es gab Selbstverteidigungskurse, und wir
lernten, im Fall eines Angriffs «Feuer!» zu rufen. Auf Hilfeschreie
reagieren die Leute nicht, auf «Feuer!» schon.
Sind Sie selbst auch tätlich angegriffen worden?
Ja, mehrfach. Das erste Mal, als ich vierzehn Jahre alt war und mich
drei Neonazis nach einem Besuch eines Fussballstadions attackierten:
zwei Männer und eine Frau. Die Männer hielten mich fest, während die
junge Frau mit ihren Springerstiefeln auf mein Gesicht eindrosch. Davon
stammt die Narbe unter meinem Auge. Es war ein gezielter Angriff, weil
ich die Tochter von Lothar König bin. Mein Vater ist eine Hassfigur der
rechten Szene. Als Jugendpfarrer leitet er seit 1990 die JG Stadtmitte,
schon lange setzt er sich vehement gegen Neonazis ein.
Haben Sie Anzeige erstattet?
Ja, gleich am nächsten Tag. Ich nannte der Polizei auch den Namen der
Frau, die auf mich eingeprügelt hatte, ich kannte sie. Zu einer Anklage
oder Verurteilung ist es nie gekommen. Der Angriff fand am helllichten
Tag vor dem Stadion statt, eine Menge Leute gingen an uns vorbei,
niemand hat eingegriffen. Diese tiefe Ignoranz und Gleichgültigkeit
gegenüber rechter Gewalt waren typisch für die neunziger Jahre.
Wie ist das erklärbar?
Die Wiedervereinigung führte Anfang der Neunziger zu grossen Umbrüchen
in Ostdeutschland: Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Wiederaufbau,
Einführung der D-Mark, die Möglichkeit, überallhin zu reisen. Niemand
wollte sich ernsthaft mit den vorhandenen Übeln beschäftigen. Als das
Jugendmagazin der «Süddeutschen Zeitung» ein paar Jahre nach der Wende
über die Neonaziszene in Jena berichtete, wollte niemand in der Stadt
etwas davon wissen: «Es gibt keine Nazis hier!» und «Wir sind nicht
rechts!», hiess es. Dieses Abwehrverhalten ist dadurch erklärbar, dass
fast alle ostdeutschen Städte Angst hatten, im Standortwettbewerb um
Firmen und Arbeitsplätze zu verlieren.
Klingt nicht nach einer entspannten Jugend …
Doch, verrückterweise war sie es! Es geht heute oft vergessen, wie
aufregend diese Zeit war. Wir organisierten zum Beispiel sonntags mitten
im Kreisverkehr eine Volksküche. Um uns herum die Autos, und wir
kochten auf einem Lagerfeuer Suppe. Die war zwar furchtbar – aber dieses
Gefühl, zusammen die Stadt zu erobern, war grossartig.
Sie sind bis heute überzeugte Antifaschistin. Die Antifa gilt – zumindest in der Schweiz – bis weit ins linke Milieu hinein als linksextremes Pendant zu den Neonazis. Was verstehen Sie unter dem Begriff «Antifa»?
Es ist die glaubwürdigste Instanz im Kampf gegen rechts. Ihr Widerstand
gegen Neonazis bis hin zu den Rechtskonservativen beruht nicht auf einem
Bauchgefühl. Die Grundlage ist ein – gerade auch historisches –
Bewusstsein darüber, was es heisst, den Rechten Macht und Raum zu
lassen. Eine ganz wichtige Praxis der Antifa ist die Recherche: Niemand
weiss besser über rechte Strukturen Bescheid als die Antifa. Deshalb
sage ich Journalisten immer: Vertraut der Antifa.
Für viele ist die Antifa nur ein linker Schlägertrupp …
Ich habe Ihnen die Verhältnisse in den neunziger Jahren in Jena bereits
geschildert. Und wir wissen nicht erst seit dem NSU, dass Neonazis nicht
davor zurückschrecken, andere Menschen umzubringen. Gewalt ist Teil
ihrer Ideologie. Ist ja schön, wenn die Leute denken, man könne mit
Nazis reden. Und wenn die Leute mit Kreide «Jena ist bunt» auf die
Strasse schreiben. Das reicht aber nicht. Ich bin überzeugt davon, dass
Neonazis Grenzen gesetzt werden müssen. Ein Beispiel: In
Rostock-Lichtenhagen fand im August 1992 ein mehrtägiger neonazistischer
Angriff auf eine Asylunterkunft statt. Die Polizei zog ab, während
Hunderte von Schaulustigen den Neonazis applaudierten. Widerstand
leisteten Antifaschisten aus ganz Deutschland, die sich unter
Lebensgefahr dafür einsetzten, dass die Menschen in der Unterkunft nicht
sterben.
Die migrantische Community in Deutschland konnte auch die Antifa nicht genug schützen, wie die NSU-Mordserie aufgezeigt hat …
Leider ja. Antifaschisten hätten es 2004 nach dem Nagelbombenanschlag in
der Kölner Keupstrasse mitbekommen können. Die Anwohner, mehrheitlich
aus migrantischem Milieu, sagten damals: «Das waren Neonazis.» Das
Gleiche gilt für Kassel, wo im April 2006 nach den Morden an Mehmet
Kubasik und kurz darauf an Halit Yozgat eine Demo unter dem Motto «Kein
10. Opfer» mit mehreren Tausend Menschen aus der migrantischen Community
stattfand. Die Mordserie hat einen weissen Fleck der Antifa-Arbeit
aufgezeigt: Die weissdeutsch geprägte Bewegung ignorierte das
migrantische Wissen über rechtsextreme Strukturen völlig. Diesen Vorwurf
muss ich auch mir selbst machen. Es ist eine wichtige Lehre aus dem
NSU: Es braucht den Austausch mit der migrantischen Community.
Sie sind eine der bekanntesten Antifaschistinnen in Deutschland. Löst es in der Naziszene spezifische Reaktionen aus, dass Sie eine Frau sind?
Zunächst einmal bin ich die Tochter von Lothar König, einer Hassfigur
der Neonazis. Zweitens nütze ich mein öffentliches Amt als
Landtagsabgeordnete, um kontinuierlich neonazistische Strukturen und
Namen von aktiven Neonazis offenzulegen. Und schliesslich passt eine
starke, selbstbewusste Frau nicht in deren Ideologie. Immer wieder höre
ich an Demos: «Das ist doch keine Frau, die hat weder eine weibliche
Figur noch ein weibliches Gesicht noch gibts irgendeinen Mann, der sich
für die interessiert.» Indem sie mir unterstellen, ich sei keine Frau,
sondern ein Objekt, ein Tier oder eine Hexe, schaffen sie die Grundlage,
zu sagen: Ihr könnt die töten.
Im letzten Herbst hat eine Schweizer Neonaziband einen Mordaufruf gegen Sie veröffentlicht …
Als der Mordaufruf publik wurde, rief mich Monchi an, der Sänger der
antifaschistischen Band Feine Sahne Fischfilet. Er sagte mir:
«Katharina, ich bin ja selber Sänger und schreibe Lieder. So was
schreibt man nicht mal einfach so auf. In einem Song stecken Herz und
Kraft drin. Nimm das nicht zu sehr auf die leichte Schulter.» Es lässt
mich nicht kalt, aber was ist die Alternative? Ich fände es viel
schlimmer, mein Verhalten aufgrund eines Lieds oder eines Drohbriefs zu
ändern. Dann hätten die Neonazis ihr Ziel erreicht.
Tragen Sie eigentlich die alte Schreckschusspistole noch bei sich?
Nein. Ich schütze mich heute, indem ich nachts nicht alleine Zug fahre.
Die Fahrt von Saalfeld, wo mein politisches Kreisbüro ist, zurück nach
Jena führt nämlich an Kahla vorbei, einer Nazistadt. Ansonsten finde
ich, dass Öffentlichkeit den besten Schutz bietet.
Was genau ist eine Nazistadt?
Eine Stadt, in der es keinen öffentlich wahrnehmbaren Widerspruch oder
gar Widerstand gegen Neonazis gibt. In der eine Mehrheit mit
Gleichgültigkeit oder Angst reagiert. In Kahla besitzen die Neonazis
mehrere Häuser, was zur Verfestigung und Etablierung ihrer Strukturen
führt. Sie haben Leute, die sich gegen rechts engagierten, so heftig
schikaniert, dass diese die Stadt verliessen.
Wie kommt eine Stadt da wieder raus?
In Kahla gibt es seit kurzem wieder eine Polizeistation. Es dauert also
nicht mehr zwanzig, sondern nur fünf Minuten, ehe jemand vor Ort ist.
Die Polizei fährt Streife. Diese Form niederschwelliger Repression kann
helfen, die Machtlosigkeit zu verringern. Das reicht aber nicht. Um die
Zivil- und Stadtgesellschaft zu stärken, braucht es Orte – und gerade
für Jugendliche auch alternative Angebote: Jugendräume, Kulturzentren,
kirchliche Angebote. Das kostet Geld und Zeit.
Gibt es positive Beispiele, wo die Neonazis tatsächlich aus der Stadt verdrängt wurden?
Jena ist ein positives Beispiel. Nach den harten neunziger Jahren folgte
eine Veränderung. Im Jahr 2000 rief der damalige Bundeskanzler Gerhard
Schröder nach einem Brandanschlag auf eine Düsseldorfer Synagoge zum
«Aufstand der Anständigen» auf. Plötzlich stellten sich Politiker und
Künstler klar gegen Neonazis, Bürgerbewegungen entstanden.
Antifaschismus wurde fast Mainstream. Als hier in Jena im Sommer 2005
das neonazistische «Fest der Völker» stattfand, gingen 8000 Leute
dagegen auf die Strasse. Es gab eine Blockade um 4.30 Uhr früh auf dem
Platz, wo das Rechtsrockfestival stattfinden sollte. Ein toller Mix aus
Antifa, Schülern, Politikern bis in die CDU hinein, Kirchenmitgliedern …
Die Nazis mussten ihr Fest am Stadtrand abhalten. Das hat
zusammengeschweisst.
Hält diese breite Allianz bis heute an?
Weitestgehend. Jena ist heute eine linke und alternative Stadt. Es gibt
durchaus Kritik an der Antifa, aber man geht nicht auf Distanz zu ihr.
Die Antifa wird nicht mehr als Teil des Problems, sondern als Teil der
Lösung wahrgenommen. Die Leute wissen, wer die Recherche- und
Aufklärungsarbeit über die rechte Szene macht. Sie wissen, wer die
Proteste seit zwei Jahrzehnten organisiert und betreut. Anders in der
Thüringer Landeshauptstadt Erfurt: Wenn da die AfD eine Demo
organisiert, gehen Tausende mit ihr auf die Strasse, und es gibt
vielleicht 500 Gegendemonstranten.
Sie haben die antifaschistische Band Feine Sahne Fischfilet erwähnt. Auf deren aktuellem Album, «Bleiben oder gehen», geht es darum, dass Antifa in Berlin ein Lifestyle, in einem Kaff in Mecklenburg-Vorpommern hingegen ein Überlebenskampf ist.
Ein wichtiger Punkt! Saalfelder Antifaschisten leben teils in einer
akuten Bedrohungssituation. In der Neonaziszene reicht man deren
Adressen herum. Im Herbst 2015 griffen Neonazis kurz nacheinander junge
Mädchen an. Die werden damit mehr oder weniger alleingelassen.
Vielleicht kommen ein paar Leute aus Jena rüber, aber das wars dann
auch. Es reicht nicht, kluge Texte im Netz zu veröffentlichen und sauber
zu recherchieren. Konkrete Solidarität ist wichtig. Aber statt nach
Saalfeld ums Eck zu gehen, fahren die Leute eher nach Hamburg zum
G20-Protest. Dabei ist das Alltägliche mindestens genauso wichtig wie
das «Klassentreffen» in Hamburg. Wenn die Unterstützung für die
Antifaschisten in Saalfeld oder Kahla ausbleibt, sagen sich jene, die
sich an so einem Ort zur Wehr setzen, irgendwann: «Ich schaff das nicht
mehr.» Das zu verhindern, darum gehts.
Wie kam es, dass Sie als Antifaschistin bei der Partei Die Linke eingestiegen sind – und somit im Parlamentarismus landeten?
Das ist eine lange Geschichte. Über Silvester 2003 war ich in Israel und
bekam nachts um zwei Uhr einen Anruf: Leute des Aktionsbündnisses gegen
Rechts aus Jena, dem ich seit Mitte der Neunziger angehöre. Nüchtern
war keiner mehr. «Katharina, wir brauchen Frauen!», sagten sie. «Ja,
gut, bloss für was?» – «Es sind Kommunalwahlen in Jena, wir treten mit
einer eigenen Bürgerinitiative an, willst du nicht mitmachen?» Aus Spass
habe ich Ja gesagt. Und es blieb zunächst ein Spass. Wir gründeten die
Neue Mitte, bestehend aus den ÖKS, den Ökologisch-Kulturellen
Sozialisten, der SOFF, der Sozialen Friedensfront, der BAF, der
Bürgerlich-Anarchistischen Front, und dem ALK, dem Autonomen
Linksradikalen Kommando, dem ich angehörte. Die Lokalpresse nahm das
total ernst. So sehr, dass die Grünen wegen der Fünfprozenthürde Angst
bekamen und uns Listenplätze anboten. Dann bot uns auch Die Linke, die
damals noch Partei des Demokratischen Sozialismus hiess, Listenplätze
an. So stand ich plötzlich auf Platz drei der PDS-Liste und landete im
Jenaer Stadtrat.
2009 folgte der Sprung in den Thüringer Landrat. Dort sitzen Sie auch im Ausschuss, der sich mit dem NSU beschäftigt. Der Ausschuss darf geheime Ermittlungsakten und Geheimdienstinformationen einsehen. Was für Erkenntnisse haben Sie gewonnen?
Ich habe daraus vor allem Einblicke in das Innenleben des
Verfassungsschutzes bekommen, des Inlandsgeheimdiensts. Für Einblicke in
die Neonaziszene halte ich nach wie vor die Antifa für die
verlässlichste Quelle. Der Verfassungsschutz setzt auf sogenannte
V-Männer und V-Frauen, also Leute aus der Szene selbst, denen sie Geld
geben, damit sie Informationen an die Staatsorgane verraten. Eine
Praxis, die meiner Ansicht nach durch die Aufarbeitung in den
NSU-Ausschüssen als kolossal gescheitert bezeichnet werden muss.
Besonders in Thüringen. Der wichtigste V-Mann des Thüringer
Verfassungsschutzes war Tino Brandt, und der hat das Geld für seine
vorgebliche Spitzeltätigkeit nachweislich für den Aufbau von
neonazistischen Strukturen eingesetzt – Strukturen, in denen sich auch
das NSU-Kerntrio bewegte, bevor es 1998 abgetaucht ist. Die
Selbstenttarnung der NSU hat aber nicht zur Abschaffung der
V-Leute-Praxis geführt oder gar zu einer Grundsatzdebatte über den
Verfassungsschutz. Im Gegenteil: Der Verfassungsschutz ging gestärkt aus
der Aufarbeitung des NSU hervor. Er hat heute mehr Kompetenzen, mehr
Personal und eine verbesserte gesetzliche Grundlage.
Wie ist das möglich?
Es gab ein kurzes Zeitfenster nach der Selbstenttarnung des NSU Ende
2011, wo eine Schwächung oder gar Abschaffung des Verfassungsschutzes
möglich war. Damals sind die mannigfaltigen Verwicklungen von V-Männern
in den NSU-Komplex publik geworden. Aber der politische Druck war dann
doch zu gering. Ausserdem ist es angesichts der aktuellen Weltlage und
der Terrorgefahr wohl nicht mehrheitsfähig, den Dienst ganz aufzulösen.
Schliesslich wäre die Auflösung das Eingeständnis einer verfehlten
Politik.
Angela Merkels Versprechen der lückenlosen Aufklärung scheint sich in Luft aufgelöst zu haben: Viele Fragen im NSU-Komplex bleiben offen. Die Bundesgeneralstaatsanwaltschaft geht noch immer davon aus, dass der NSU nur aus Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt bestand, auch wenn alles darauf hindeutet, dass die drei Unterstützung aus der Szene erhielten.
Ich glaube, Frau Merkel hat das ernst gemeint. Aber vermutlich wusste
nicht mal die Bundeskanzlerin, was für ein Eigenleben diese Dienste
haben. Und was da alles in Gang gesetzt wurde, um zu verhindern, dass
irgendjemand Einblick bekommt. Bis heute fehlt eine übergeordnete und
unabhängige Stelle, die alle Akten und Dokumente aus den vielen
Ausschüssen sichtet und auswertet. Der Bundesausschuss könnte das
leisten, aber dafür hat er schlicht viel zu wenig Kapazitäten. Und in
der nächsten Legislatur wird es keinen weiteren NSU-Bundesausschuss mehr
geben. Da wette ich um tausend Euro.
Ende September finden die Bundestagswahlen statt. Wäre das nicht was für Sie, ein Wechsel nach Berlin?
Um Gottes willen, nein! Was will ich denn dort. Für mich ist es schon
schwierig, in Erfurt im Landtag zu sitzen, das ist weit genug entfernt
von den Strukturen der ausserparlamentarischen Opposition, denen ich
verbunden bin. Ich will hier in Jena und Saalfeld bleiben.
Katharina König
In Erfurt wurde Katharina König (39) als Tochter des Pfarrers Lothar König geboren und wuchs in Jena auf. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr in Israel studierte sie Semitische Philologie, Islam- und Politikwissenschaften sowie Sozialarbeit in Jena. Von 2002 bis 2009 arbeitete sie als Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin. 2004 wurde sie für die damalige PDS (heute Die Linke) in den Jenaer Stadtrat gewählt, 2009 zog sie in den Thüringer Landtag ein.
NSU-Komplex
Mehrere Spuren führen in die Schweiz
Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Yozgat, Michèle Kiesewetter. Das sind die Namen der mutmasslichen Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU). Als Täter der Mordserie zwischen 2000 und 2007 gelten Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, als Mittäterin soll auch Beate Zschäpe beteiligt gewesen sein.
Die rechtsextreme Terrororganisation NSU flog im November 2011 auf, als sich Mundlos und Böhnhardt nach einem Banküberfall im thüringischen Eisenach mutmasslich selbst erschossen – nach vierzehn Jahren im Untergrund. Zschäpe tauchte nach der Enttarnung zunächst unter, stellte sich aber schliesslich der Polizei. Sie steht seit Mai 2013 in München vor Gericht. Offiziell wird das NSU-Kerntrio als weitgehend isolierte Zelle dargestellt, doch die Indizien sprechen dafür, dass ein Netz an aktiven UnterstützerInnen aus der neonazistischen Szene bestand.
Im NSU-Komplex gibt es auch mehrere Verbindungen in die Schweiz, die hierzulande bisher kaum mediale Beachtung fanden:
- Am 11. April 1998 fing das Landeskriminalamt Thüringen einen Anruf aus einer Telefonzelle in Concise im Kanton Waadt ab. Der Anrufer war mutmasslich Mundlos, der einer Kontaktperson in Jena Unterstützungsleistungen für das seit Januar 1998 untergetauchte Kerntrio in Auftrag gab. Am selben Tag fand in Concise ein neonazistisches Konzert mit etwa 300 BesucherInnen statt – bis heute sind mögliche Verbindungen des Trios zu damals aktiven Neonazis in der Romandie nie eingehend untersucht worden.
- Bei allen zehn Morden, die dem NSU angelastet werden, kam dieselbe Ceska-Pistole zum Einsatz. Sie gelangte mutmasslich über den Schweizer Hans-Ulrich M., der sie im Frühjahr 1996 erworben hatte, nach Jena: zunächst ins Milieu der organisierten Kriminalität, später in die lokale Neonaziszene, von dort zum NSU-Kerntrio. Der Schweizer H. war seit Anfang der neunziger Jahre mit Enrico T. befreundet, der im kriminellen Milieu Jenas aktiv war und Böhnhardt kannte. Bis heute ist nicht lückenlos geklärt, wie die Pistole beim Kerntrio landete.
- Ralf Marschner, Deckname «Primus», war von 1992 bis 2002 als V-Mann in der Neonaziszene rund um Zwickau in Sachsen tätig. Er soll gemäss Recherchen der «Welt» Anfang der nuller Jahre Mundlos in seiner damaligen Baufirma beschäftigt haben. 2013 wurde «Primus» als V-Mann entlarvt, war zu jener Zeit aber bereits abgetaucht – in die Schweiz, wo er noch immer lebt. Er ist von den Strafverfolgungsbehörden zwar befragt worden, im NSU-Prozess musste er aber nicht aussagen. Die Schweiz hat 2016 ein Auslieferungsgesuch Deutschlands (wegen Insolvenzverschleppung) abgelehnt.
Jan Jirát
Folgende Publikationen helfen, die Mordserie und deren Hintergründe einzuordnen: «Heimatschutz. Der Staat und die Mordserie des NSU» von Stefan Aust und Dirk Laabs; der Blog «NSU Watch» (link is external); das aktuelle «Lautstark» der Antifa Bern, eine Sonderausgabe zum NSU-Komplex und den Schweizbezügen, ist dieser WOZ-Ausgabe beigelegt.