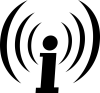Libyen soll zum Bollwerk gegen Armutsflüchtlinge aufgerüstet werden. Doch in dem Bürgerkriegsland am Mittelmeer werden Flüchtlinge unter verheerenden Umständen weggesperrt.
Von Susanne Koelbl
Das Auffanglager liegt in einem weißen Gebäudekomplex nahe dem Zentrum von Tripolis. Zwei Kontrollpunkte der libyschen Polizei sind zu passieren. Der Gefängnisdirektor Ramadán Rais ist ein Mann mittleren Alters, unter Präsident Muammar al-Gaddafi war er Drogenfahnder. Heute bekämpft er Migranten."Was wollen die hier?," fragt Rais. "Wir haben doch schon selbst nichts zu essen."
Seit dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 herrschen in Libyen Zustände wie im Bürgerkrieg. Das Land hat zwei Regierungen und drei verschiedene Machtzentren, die sich bekämpfen. Die rund 700.000 Flüchtlinge aus Nigeria, Niger, Somalia, Sudan, Äthiopien und Eritrea sind in dem Chaos alles andere als willkommen und werden in gefängnisähnlichen Zentren eingesperrt.
Trotzdem will die EU künftig enger mit den Behörden in Libyen zusammenarbeiten, um die Zahl der Migranten, die übers Mittelmeerkommen, einzudämmen. Etwa 200.000 Menschen aus Afrika erreichen jedes Jahr die italienische Küste. Sie sollen zurückgeschickt werden. Völlig unklar ist, wie Europa in Libyen Menschenrechtsstandards, medizinische Versorgung und Ernährung der entkräfteten Flüchtlinge sichern will. Wegen der Kämpfe wagt sich kaum eine Hilfsorganisation in das Land.
Gefängnisdirektor Rais geht über den Hof, vorbei an der Gefängnisküche. Ein Koch rührt in meterhohen Bottichen. Weizennudeln schwimmen in trübem Wasser, Weizennudeln gibt es morgen wieder, so wie gestern und vorgestern. Dazu erhalten die Inhaftierten Wasser, sonst nichts. Der Staat hat kein Geld für die Versorgung von Flüchtlingen, sagt Rais.
Der Gefängnischef öffnet das Schloss vor einem schweren Stahlgitter. Dahinter kauern etwa 350 Männer auf dem Fußboden. Die meisten sind jung, manche noch halbe Kinder, ausgemergelt und dürr, Schorfwunden auf der Haut. Die Krätze geht um, einige leiden an Tuberkulose. Ab und zu kommt der Arzt einer internationalen Organisation vorbei, um die schwersten Fälle zu behandeln. Doch die örtlichen Krankenhäuser weigern sich fast immer, mittellose Migranten aufzunehmen.
Die Menschen, so sagt Rais, könnten noch von Glück reden, hier gelandet zu sein: "Viele sterben doch entweder in der Sahara oder auf dem Meer." Die meisten Inhaftierten wurden von Sicherheitskräften auf der Straße aufgegriffen, oder die Küstenwache hat sie von einem sinkenden Boot aus dem Meer gezogen.
Der nigerianische Hilfslehrer Osaikhuwunuomwan Goodness Alex, 22, ist einer dieser Unglücklichen. Er sei "durch die Hölle gegangen", um am Ende in Libyen in einem Gefängnis zu landen, sagt der junge Mann. Nach der Abschiebung, zurück in Nigeria, schrieb er seine Geschichte auf und schickte sie an SPIEGEL ONLINE.
"In Europa haben sie alles, was du willst"
Die Odyssee beginnt immer auf die gleiche Weise, irgendwo in Afrika. Ein Fremder zeigt Prospekte herum. Das sind die Werber. Auf ihren Bildern ist das Leben der Deutschen zu sehen: Schulen, Krankenhäuser, Universitäten, Straßen, Autos. "Alles kostenlos", sagt der Werber, "in Europa haben sie alles, was du willst." Einmal nur müsse der Kunde bezahlen, für die Reise durch die Sahara nach Libyen und die Überfahrt nach Italien.
Dann, so sagen sie, übernehmen die Europäer, mit ihren funktionierenden Organisationen und effektiven Staatsystemen. Selbst den Ärmsten würden die besten Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, schwärmen die Werber.
Für umgerechnet 30 bis 40 Euro Vermittlungsgebühr reichen sie Reisewillige an Schlepper weiter. Es ist der Anfang der langen Kette des Menschenschmuggels durch die Sahara, ein gefährlicher Trip, in dessen Verlauf immer neue Zahlungen fällig werden.
Frauen erzählen von Erniedrigungen, sexuellen Übergriffen, Unterernährung
Kaum eine der Frauen schafft es nach Libyen, ohne auf dem Weg vergewaltigt zu werden. Weibliche Flüchtlinge arbeiten ihre Passage oft bei einem Schlepper ab, ganz junge Mädchen bleiben dann monatelang in dessen Besitz, oder sogar Jahre.
Im Frauentrakt des Internierungslager von Sabratha berichten weibliche Häftlinge, wie sie in Libyen von der Polizei aufgegriffen wurden, sie erzählen von Schlägen und Erniedrigungen, sexuellen Übergriffen und Unterernährung. Man gebe ihnen ausschließlich Weißbrot zu essen und oft Salzwasser zu trinken, behauptet eine junge Frau aus Eritrea und hält den gefüllten Becher hin. Das Wasser schmeckt salzig.
Ein Wächter betritt den Raum, die Frau verstummt und flüstert zum Abschied: "Wenn ihr draußen seid, schlagen sie uns wieder, weil wir gesprochen haben."
In der Sahara hatte unser Fahrer die Orientierung verloren, anstatt vier Tage irrten wir zwölf Tage herum und hatten kaum zu trinken. Wir gerieten an eine illegale Zollstelle, und eines unserer Mädchen wurde dort so lange vergewaltigt, bis sie starb.
Der Fahrer hielt in einem Ort namens Samba, in Niger, und bat uns zu warten. Wir sahen ihn nie wieder. Dafür kamen Bewaffnete. Sie kidnappten uns und zwangen uns in ein Privatgefängnis. Unser eigener Fahrer, ein Nigerianer wie wir, hatte uns verkauft. Die Entführer schlugen uns, bis wir bewusstlos waren, sie hingen uns an den Armen auf, vergewaltigten Mädchen und Jungen, in alle Körperöffnungen. Während sie uns folterten, riefen sie unsere Familien an, hielten den Telefonhörer an unser Gesicht, damit unsere Eltern unsere Schreie hören und Geld schicken würden.
Wir ergriffen die erste Chance, um von dort zu fliehen, wir waren Hunderte. Die Entführer schossen uns hinterher, 60 oder 70 von uns blieben liegen.
Ich und meine Freundin Precious Snake gehörten zu denen, die mit dem Leben davonkamen, und irgendwann gelangten wir nach Libyen.
Am Rande der Stadt Tripoli kamen wir in einem Getto unter, die Polizei wagte sich dort kaum hinein. Außerhalb des Gettos lauerten Kriminelle, die Migranten entführen und verkaufen. Mädchen werden als Prostituierte versklavt, Männer als Arbeiter.
Schließlich wagten wir den letzten Schritt, die Bootsfahrt nach Italien. Der Schlepper, der uns an den Strand von Tejara brachte, war der fieseste Typ, den ich je gesehen habe, grob und voller Hass. Er sagte, es gehe gleich los, noch in dieser Nacht. Schon wieder eine Lüge.
Der Mann brachte uns in das Haus eines Marineoffiziers mit bewaffneten Polizisten und Soldaten. Wir wurden auf engstem Raum zusammengepfercht, Hunderte Menschen, nicht einmal genug Platz für alle, um zu schlafen.
Nachts kamen die Wachen und nahmen sich die Mädchen, die ihnen gefielen. Tagsüber suchten sie Männer aus, die für sie arbeiten sollten.
Weil ich so groß bin, wurde ich oft ausgesucht. Sie bezahlten uns nicht, dennoch war mir die Abwechslung willkommen. Ich kam raus, konnte mich strecken und bewegen, am Ende gaben sie uns Brot und Wasser. Wir verbrachten einen ganzen Monat dort und wuschen uns nicht ein einziges Mal. Wer versuchte zu fliehen, wurde erschossen. Sprechen war verboten, Mobiltelefone nicht erlaubt. Kaum ein Tag verging, an dem nicht eine Leiche herausgetragen wurde.
Endlich ging es dann doch los. Was für eine Freude. Wir würden morgens in Italien sein. Doch unser Boot hatte ein Leck und der Kapitän aus Gambia nicht einmal ein Telefon für den Notfall. Wir kehrten um, doch die Libyer zwangen uns zurück aufs Boot, mit vorgehaltenen Waffen.
Wir mussten unser Glück erneut versuchen und starteten. In den Morgenstunden war das Benzin aus. Vier Tage trieben wir auf See. Von 135 Passagieren starben 30 an Wassermangel, auch meine Freundin Precious Snake. Sie starb in meinen Armen. Die Überlebenden beschlossen, die Toten über Bord zu werfen, um Ballast loszuwerden. Das Schlauchboot hatte schon viel Luft verloren.
Kurz darauf wurden wir von einer Welle erfasst und Richtung Küste getrieben. Endlich sahen wir Leute, Soldaten, die Küstenwache. Die wenigsten von uns können schwimmen. Wir riefen und machten Zeichen, bis sie aufmerksam wurden. Sie brachten uns erst nach Bengasi, dann nach Misrata zu einer Station der Internationalen Organisation für Migration. Seit Monaten wurde ich dort das erste Mal wieder wie ein Mensch behandelt. Dafür werde ich dieser Organisation immer dankbar sein. Sie half mir, zurück nach Nigeria zu gelangen und mein altes Leben aufzunehmen. Warum erzähle ich das? Weil ich nicht will, dass sich meine Brüder und Schwestern auf diesen Pfad über Libyen nach Europa machen, um dort ihr Leben zu verbessern, egal wie verzweifelt sie sind. Das ist nicht die Lösung. Das Gesetz soll den Menschenhändlern und diesen korrupten Sicherheitsleuten in Libyen das Handwerk legen."