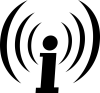Sächsische Landeshauptstadt zeigt sich in bei der Debatte um den 13. Februar wieder tief gespalten
Als wenige Tage vor dem 13. Februar neben der wieder aufgebauten Frauenkirche auf dem Neumarkt in Dresden die Installation »Monument« des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni eingeweiht wurde, wurde erbittert gestritten, ob das Kunstwerk aus drei hochkant aufgestellten Bussen zu dem historischen Platz passt – und ob es einen Bezug zum Gedenken an die Zerstörung der Stadt heute vor 72 Jahren hat. Die einen merkten an, dass es im Dresden des Jahres 1945 so aussah wie heute im syrischen Aleppo, wo eine solche Barrikade aus Bussen vor Scharfschützen schützen sollte. Andere sprachen von »Schrott«, von Verschandelung des weitgehend originalgetreu nachgebauten Platzes – und bügelten Einwände mit einer in imperativem Ton geäußerten Frage ab: »Sind Sie überhaupt Dresdner?!«
Es ist eine Frage, die an eine Wurzel des andauernden Streits um das Dresdner Gedenken rührt. Sie postuliert: Mitreden, das Leid fühlen und nicht zuletzt die Angriffe um den 13. Februar 1945 bewerten kann nur, wer Einheimischer ist, und zwar von Geburt. Wer also einen quasi vererbten Sinn hat für das besondere, einzigartig Dresdnerische: die Schönheit der Stadt im Flusstal, die höchstens der von Florenz gleiche, aber auch das Grauen der Zerstörung, das sich, so unterstellt die Frage vom Neumarkt, eigentlich mit nichts vergleichen lässt – zumindest aber nicht mit der Verheerung von Aleppo.
Es hatte zuletzt so ausgesehen, als sei das Dresdner Gedenken über diesen Punkt hinausgelangt. Zwar hatte das Militärhistorische Museum Dresden in einer beeindruckenden Schau vor zwei Jahren noch einmal erklärt, wie nicht nur NS-Propaganda, sondern auch spätere literarische Darstellungen – man denke an »Schlachthof Nummer 5« von Kurt Vonnegut – bewirkte, dass »Dresden« zum Inbegriff, zur Chiffre für kriegerische Zerstörung und Angriffe auf Zivilisten wurde. Die Schau hatte aber auch gezeigt, dass Städte wie Köln weit häufiger bombardiert wurden, dass es in Hamburg mehr Tote gab, dass Würzburg gründlicher verheert wurde. Es hatte sich – zumindest in Teilen der Stadtbevölkerung und in offiziellen Reden – die Einsicht durchgesetzt, dass zwar die Angriffe auf Dresden furchtbar waren und Trauer um die 25 000 Opfer berechtigt ist; dass es aber andere Städte gibt, die ähnliche Schicksale haben – vor allem: Schicksale, die ihnen von Deutschen zugefügt wurden. Die Zerstörung Dresdens, das schien Konsens geworden, hat eine Vorgeschichte.
Sie sei, formulierte die frühere CDU-Oberbürgermeisterin Helma Orosz, Resultat eines Krieges, der von Deutschland ausgegangen und im Februar 1945 dorthin zurückgekehrt war. Dass die Stadt an der Elbe in der Maschinerie des Krieges und im NS-Regime, das ihn losgetreten hatte, eine feste Größe war, stellt nicht zuletzt der seit sechs Jahren stattfindende »Mahngang Täterspuren« immer wieder klar. Er rief etwa in Erinnerung, dass Dresden schon im September 1933 Schauplatz einer Ausstellung »Entarteter Kunst« war. Um so geschichtsvergessener wirkt es, wenn Wutbürger die Busse vom Neumarkt mit eben diesem Etikett diffamieren.
Vielleicht sind derlei Ausfälle Beleg dafür, dass sich die alten Gräben beim Streit um das Dresdner Gedenken wieder öffnen – oder dass sie nie wirklich zugeschüttet waren. Der Satz, wonach Dresden »keine unschuldige Stadt« war, schien lange eine kaum zu bestreitende Feststellung; seine Wiederholung im Jahr 2017 trug Rathauschef Dirk Hilbert jedoch eine Welle von Hass bis hin zu Morddrohungen ein. Die wütenden Reaktionen nicht nur der Pegida-Klientel auf das »Monument« vom Neumarkt wie auf die Installation »Lampedusa 361«, die auf dem Platz vor der Semperoper einen Flüchtlingsfriedhof nachbildet, haben nicht (nur) einen anderen Begriff von Kunst zum Anlass, sondern ein abweichendes Verständnis davon, wessen am 13. Februar in Dresden gedacht wird.
Viele Dresdner erinnern an dem Tag an die Unmenschlichkeit des damaligen Kriegs ebenso wie heutiger Kriege und ihre Opfer. »Unser Gedenken findet im Hier und Jetzt statt«, sagte Hilbert mit Blick auf die inzwischen traditionelle Menschenkette. Zunehmend wieder lauter äußern sich aber auch die, denen der Tod in Syrien oder an den Küsten des Mittelmeers weit weniger nahe geht als jener im Dresdner »Feuersturm«.
Die Dresdner Fokussierung allein auf die Dresdner Opfer hatte es Nazis jahrelang leicht gemacht, das Gedenken für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Die Verdrehung der Geschichte gipfelte im infamen Wort vom »Bombenholocaust«, der die Angriffe auf Dresden mit der planmäßigen Vernichtung der Juden gleichsetzte. Dass die Braunen zuletzt kaum noch einen Fuß auf die Dresdner Straßen bekamen, war Blockaden geschuldet, aber auch einem differenzierten Diskurs über die eigene Geschichte.
Die Nazis haben sich von den Niederlagen bis heute nicht erholt. Andere aber sind an ihre Stelle gerückt und suchen das Rad wieder zurückzudrehen. Als der AfD-Scharfmacher Björn Höcke im Dresdner Brauhaus Watzke die »180-Grad-Wende« im Umgang mit der deutschen Geschichte forderte und in Anspielung auf das Holocaustmahnmal vom »Denkmal der Schande« sprach, redete er auch über den 13. Februar. Die Bombenangriffe seien »Kriegsverbrechen« gewesen, sagte er, vergleichbar mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Sie hätten, postulierte Höcke, das Ziel gehabt, »uns«, die Deutschen, »mit Stumpf und Stiel auszurotten«. Den Wiederaufbau der Frauenkirche stilisierte er zum »Funken deutschen Selbstbehauptungswillens«.
Den Dresdner »Verteidigern des Abendlandes« hat er damit aus der Seele gesprochen. Wie gut sie ihm zugehört haben, zeigten sie bei ihrem Feldzug gegen das Aleppo-Mahnmal an der Frauenkirche. Auf ihre mitgebrachten Pappschilder hatten sie dick und schwarz das Schlüsselwort der Rede Höckes gepinselt: »Schande«.