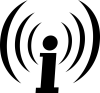Ein zaudernder Regierungschef, ahnungslose Minister, überforderte Gefängnisleiter: Der Suizid des Terroristen Al-Bakr wirft ein Licht auf Sachsens größtes Problem.
Von Christian Fuchs, Anne Hähnig und Stefan Schirmer.
Seinen Abschied vom Amt des Bundesratspräsidenten hat sich Stanislaw Tillich glanzvoller vorgestellt. Müde und grau steht Sachsens Ministerpräsident am vergangenen Freitag im Preußischen Herrenhaus in Berlin, wo der Bundesrat seinen Sitz hat. Ein Jahr lang hat er bei jedem Staatsakt in der ersten Reihe gesessen, neben der Kanzlerin. Er ist im Regierungsflugzeug mit schwarz-rot-goldenen Streifen um die Welt gereist: nach Mexiko, Kuba, Singapur, Südkorea. Sogar vom Papst wurde er ehrenvoll empfangen.
Schaut man sich Bilder der Reisen an, ahnt man, wie sehr Tillich diese Zeit genossen hat. Ein offizielles Video, das sein Jahr als Präsident würdigen soll, zeigt ihn als einen Politiker auf dem Gipfel der Macht. Doch als er am Tag des Abschieds zu reden beginnt, wirkt er fassungslos über den revidierten Text, den er gleich vortragen muss, der jüngsten Ereignisse wegen: Seine Regierung in Sachsen müsse "Fehler ausmerzen und aus Fehlern lernen". Fehler, dieses Wort hasst er. Tillich liest es so betonungslos vor, als könne er die Pannen dadurch verschwinden lassen.
Tillich ist so angespannt, dass er vom internationalen "Tourismus" spricht, als er "Terrorismus" sagen will. Tillich, der eben noch wie ein Retter um den Globus flog, ist durch den Tod eines mutmaßlichen Terroristen wieder auf sein ureigenes Amt zurückgeworfen worden: Chef einer Landesregierung, über die sich ganz Deutschland wundert.
Spiegel Online überschrieb einen Artikel mit den Worten "Der behäbige Herr Tillich".
Bild titelte: "Kann nich, will nich, Tillich".
Im Bundesrat verabschiedet sich der Ministerpräsident eines Landes, das innerhalb weniger Tage durch einen Polizei- und Justizskandal schwer beschädigt wurde. Am Samstag vorletzter Woche hatten Polizisten in Chemnitz versucht, den Terrorverdächtigen Jaber al-Bakr zu fassen – zunächst erfolglos. Was der schwer bewaffneten Staatsmacht in Sachsen misslang, glückte einen Tag später ausgerechnet drei Syrern, die nur mit einem Verlängerungskabel, einem Seil und dem Mut der Verzweifelten ausgerüstet waren: Sie fesselten Al-Bakr und lieferten ihn der Polizei aus. Am Mittwoch vergangener Woche schaffte es Al-Bakr aber, sich in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Leipzig umzubringen.
Was ist da los? Sachsen, das sich nach der Wiedervereinigung zum neuen Musterländle im Osten entwickelt hatte, mit besten Wirtschaftsdaten und Pisa-Noten, steht nun als Pannenstaat da. Als Land, dessen Polizei- und Justizbehörden nicht funktionieren – und mit diesem Versagen die ganze Republik in Gefahr bringen. Wer sich den Fall Al-Bakr näher anschaut, der erkennt, dass die Pannen, die den Ministerpräsidenten am Rednerpult des Bundesrats holpern lassen, kein Zufallsprodukt sind. Zu ihnen kam es, weil sich Personen und Institutionen auf allen Ebenen in eine hilflose Arroganz hineingesteigert haben. In Sachsen haben sich Selbstgefälligkeit, Dilettantismus und Naivität verselbstständigt. So ist ein krankes System entstanden, das seine Fehler verstärkt und reproduziert. Aus Furcht, etwas falsch zu machen, will keiner die Verantwortung übernehmen: von einzelnen Beamten über Anstaltschefs und Behördenleiter bis hoch zu Ministern und dem Ministerpräsidenten selbst.
Die Gefängnischefs
In einem Besprechungsraum des sächsischen Justizministeriums in Dresden gibt es eine Ahnengalerie. In Schwarz-Weiß hängen die Bilder von 28 meist streng blickenden Herren an der Wand, angefangen mit Julius Traugott Jacob von Könneritz, dem sächsischen Minister der Justiz von 1831 bis 1846. Drittletzter in der Reihe ist Thomas de Maizière – der heutige Bundesinnenminister war hier von 2002 bis 2004 der Chef im Haus. Der aktuelle sächsische Justizminister fehlt in der Galerie. Dass Sebastian Gemkow von der CDU jemals aus dem Amt ausscheidet und sein Porträt neben die Bilder der anderen gehängt wird, scheint nicht vorgesehen: Neben dem Porträt seines Vorgängers ist kein Platz mehr, da ist die Tür.
Sachsens Justiz ist nicht nur stolz auf ihre Minister, sondern auch auf ihre Gefangenen: Holzfiguren, die Häftlinge gefertigt haben, werden im Foyer des Ministeriums in Vitrinen ausgestellt. Man kann sie auch kaufen, etwa den Räuchermann "Gefangener mit Eimer und Besen" zu 25,80 Euro.
Jaber al-Bakr, geboren am 10. Januar 1994 in Saasaa bei Damaskus, war für 52 Stunden als Gefangener der JVA in Leipzig der wichtigste Untersuchungshäftling Deutschlands – bis er sich durch Strangulieren mit einem T-Shirt das Leben nahm.
Zwei Tage nach dem Suizid sitzt die Führungsspitze des Gefängnisses vor der Wand mit der Minister-Galerie: zwei Männer, die versuchen, sich zu erklären. Der eine, Rolf Jacob, ist der Anstaltsleiter und war im Urlaub, als Al-Bakr in der Zelle saß. Der andere, Jörg Hoppach, ist Jacobs Stellvertreter und war in jenen 52 Stunden im Dienst. Es ist das erste Mal, dass er sich den Fragen von Journalisten stellt. Hoppach ist ein Mensch, der die Routine mag. Jacob legt sich gern auch mal abends um acht ins Bett, wie am Tag des Suizids.
Jacob sagt etwas trotzig, einige kritische Kommentare zu den Umständen von Al-Bakrs Tod seien "von Unwissen geschlagen". Hoppach schweigt. Ein grauhaariger Mann in grauem Anzug. Er sitzt da fast ohne Körperspannung, ganz offensichtlich fühlt er sich unwohl bei diesem Gespräch. Es ist sofort klar, dass er der Untergebene ist. Wie es ihm geht? Lange Pause. "Nicht gut", sagt Hoppach. "Man versucht, seine Arbeit gut zu machen, hat so viel Aufwand reingesteckt, aber im Ergebnis – ist es anders." Das ist das eine Grundgefühl: Niedergeschlagenheit. Aber es gibt noch ein anderes: das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden.
Hoppach, Jahrgang 1956, langweilte sich viele Jahre in seinem Job. Das war in den achtziger Jahren im DDR-Justizvollzug. Hoppach hatte die Anstalten im Raum Leipzig zu kontrollieren, doch er mochte die Aufgabe nicht. Er fing ein Fernstudium an – und als die Mauer gefallen war, freundete er sich doch noch mit dem Gefängniswesen an. In den Wirren der Wendezeit brachte er es bis zum stellvertretenden Anstaltsleiter. Das ist er bis heute, seit 25 Jahren. Zu DDR-Zeiten, sagt Hoppach, sei der Strafvollzug sehr militärisch geprägt gewesen. Heute sehe man in den Gefangenen Bürger hinter Gittern. Hoppachs Credo lautet, er sagt das mehrfach an diesem Tag: jeden Gefangenen behandeln wie alle anderen, wie einen Menschen.
Es ist genau das, was Hoppach zum Verhängnis wurde: dass er Al-Bakr behandelte wie jeden anderen Gefangenen. Doch dass dieser Syrer ein besonderer Häftling war, muss dem stellvertretenden JVA-Leiter schon bei der Ankunft des Insassen klar gewesen sein. Am Montag voriger Woche, um 15.35 Uhr, Hoppach las gerade Akten, klingelte sein Telefon: die Pforte. "Der Terrorist steht jetzt hier drin", sagte der Kollege zu Hoppach. Das kam überraschend. Manchmal passiert es, dass Untersuchungshäftlinge vorab angekündigt werden. Vor allem, wenn sie schwere und politisch relevante Straftaten begangen haben sollen. Bei Jaber al-Bakr war es anders. Er wurde einfach gebracht. Fragt man Hoppach, was er in diesem Moment dachte, dann antwortet er: "Ich dachte, einen Terroristen hatten wir noch nie. Dann sah ich durchs Fenster die anderen, die ihn gebracht haben: das SEK, alle vermummt! Das war schon besonders."
Persönlich entgegengenommen hat Hoppach seinen neuen Gefangenen jedoch nicht: "Wir haben 2.500 Aufnahmen im Jahr. Glauben Sie, dass der Anstaltsleiter alle begrüßt?"
Gegen 17 Uhr besuchte Hoppach seinen prominenten Insassen in dessen Zelle, Haftraum 144. "Er war müde, aber in guter körperlicher Verfassung", sagt Hoppach. Ohne Dolmetscher, wie hat er sich mit ihm verständigt? "Über Zeichensprache und ein paar Wortbrocken, die er verstanden hat."
Für denselben Abend forderte Hoppach keinen Dolmetscher an. Er sah keine Notwendigkeit. Am nächsten Tag würde ein Dolmetscher kommen, dann würde Al-Bakr mit seinem Anwalt reden und mit der Psychologin. "Es gab die ganz normale Aufnahmeprozedur", sagt Hoppach. Was er zum damaligen Zeitpunkt über Al-Bakr wusste, das hatte er vor allem aus der Zeitung, einiges stand auch im Haftbefehl. "Mir war klar, dass ihm vorgeworfen wurde, einen Anschlag geplant zu haben. Konkreteres dazu war mir nicht bekannt."
Dabei steht im Haftbefehl, den die ZEIT einsehen konnte, bei Al-Bakr sei Sprengstoff von der Art und Menge gefunden worden, dass daraus ein Sprengstoffgürtel hergestellt werden könne.
Im Haftbefehl steht noch etwas. Die Haftrichterin hatte den Punkt "Gefahr der Selbsttötung" angekreuzt. Als Grund gab sie an: "Der Beschuldigte erklärt, er werde jegliche Nahrungsaufnahme verweigern und auch keine Getränke zu sich nehmen."
Diesen Hungerstreik deutete Hoppach so, dass Al-Bakr bessere Haftbedingungen für sich herausschlagen wollte. Dass er für sich eine Zukunft sehe. "Der hat nicht gesagt: Ich will mich tothungern", erklärt Hoppach.
Wobei er und seine Mitarbeiter ja nicht gut hätten nachfragen können. Es gibt mit Ausnahme eines Arztes keinen Beamten in der JVA Leipzig, der Arabisch spricht oder aus dem arabischen Raum kommt. Zwar hat sich der Anstaltsleiter einmal dafür eingesetzt, Auszubildende mit Migrationshintergrund einzustellen. Doch solches Personal habe sich bislang nicht gefunden, sagt Jacob.
Also muss die JVA jedes Mal einen freiberuflichen Dolmetscher engagieren. Fest angestellte Dolmetscher gibt es in keiner JVA in Sachsen – und in den meisten übrigen Bundesländern auch nicht. Die Anstaltsleiter versuchen, an allem zu sparen: So sollen die Dolmetscher, wenn sie in die JVA kommen, nicht nur für den Arzt, sondern auch für den Sozialarbeiter und den Psychologen übersetzen, in einem Aufwasch.
Am Montagabend, als Al-Bakr in seiner Zelle in Leipzig saß, klingelte bei Hassan Zeinel Abidine und auch bei seiner Kollegin Yvonne Helal das Telefon. Beide haben Dolmetschen studiert und sprechen fließend Arabisch und Deutsch. Oft übersetzen sie bei Konferenzen, für irakische Minister und die sächsische Regierung. Als der Anrufer aus dem Gefängnis ihnen erklärte, er habe einen Auftrag für sie, lehnten beide sofort ab, für die JVA arbeiten sie nicht mehr. Sächsische Haftanstalten zahlen Übersetzern nur 50 Euro pro Stunde, weit unter dem Satz, den das amtliche Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz für Aufträge bei Gericht und Behörden vorsieht. Im Gesetz sind mindestens 70 Euro pro Stunde festgeschrieben. Der Übersetzer Abidine bekommt von manchen Auftraggebern sogar das Doppelte.
Die Arbeit in der Haftanstalt sei psychologisch belastend und gefährlich, sagt Abidine. "Jede Sekunde könnte mich der Straftäter anspringen." Und für so einen Einsatz soll er mit einem Mini-Salär abgespeist werden? Während die Justiz im benachbarten Sachsen-Anhalt, einem sehr armen Bundesland, das gesetzlich festgelegte Honorar bezahlt? Abidines Kollegin Yvonne Helal sagt, nicht nur sie selbst und Abidine, auch viele andere erfahrene Dolmetscher in Leipzig arbeiteten nicht mehr für den Knast.
Rolf Jacob, der Leiter der JVA, gibt zu: "Es ist wohl was dran an dem Vorwurf, dass die Honorare zu gering sind." Besonders zerknirscht wirkt er nicht. "Bisher haben wir immer Dolmetscher gefunden."
Einen Tag nach Al-Bakrs Festnahme erschien sein Anwalt in der JVA, der Strafverteidiger Alexander Hübner. Er war in Begleitung eines eigenen Dolmetschers. Hübner sagt: "Al-Bakr war ein junger Mann, der nicht wusste, wie es weitergeht, der Angst hatte. Aber wir haben versucht, einiges zu besprechen, und sind guter Dinge auseinandergegangen."
Auch die Anstaltspsychologin befragte Al-Bakr am Dienstag mithilfe eines zweiten, inzwischen engagierten Dolmetschers, wie die JVA-Chefs sagen. Sie sei 52 Jahre alt und sehr erfahren, im Vollzug arbeite sie seit 2001. Mehr wird über sie nicht preisgegeben, und mit Journalisten will sie nicht sprechen. Klar ist, dass die Psychologin etwa eine Stunde lang mit Al-Bakr redete. Er sei zunächst verschlossen gewesen, berichtete sie, dann aber zunehmend offener geworden. Ein zweiter Gesprächstermin wurde vereinbart: für Freitag, also drei Tage später. Mit dem Hungerstreik verfolge Al-Bakr wohl ein Ziel, schlussfolgerte die Psychologin: Er wolle entweder entlassen oder in die Türkei abgeschoben werden. Zwar bestehe latente Suizidgefahr, und Al-Bakrs Zelle müsse regelmäßig kontrolliert werden. Aber in den sogenannten BgH – den besonders gesicherten Haftraum – müsse der Gefangene nicht. Rund um die Uhr, ohne Unterbrechung, müsse er nicht beobachtet werden.
Im Besprechungszimmer mit der Ahnengalerie erzählt Rolf Jacob, dass er mit der Psychologin über all das noch einmal gesprochen habe. Sie habe ihm gesagt, sie würde heute nicht anders entscheiden. Zweifel an sich selber? Keine.
In den Stunden nach dem Gespräch mit der Psychologin gab es weitere Warnsignale, die das Personal fehldeutete. Einmal riss Al-Bakr in seiner Zelle die Lampe aus der Decke. Eine flache, fest verschraubte Leuchte. Ein anderes Mal manipulierte er eine Steckdose und stopfte Klopapier hinein. Der stellvertretende Anstaltsleiter Jörg Hoppach deutete das so: Al-Bakr versuchte, die Mitarbeiter im Knast auszutricksen. Der Gefangene wollte herausfinden, ob man in der JVA für Chaos sorgen kann, Chaos, das sich möglicherweise für einen Ausbruch nutzen ließe. Hoppach sagt: "Die Einschätzung, die wir getroffen haben, lautete: Der Mann ist gefährlich. Er versucht, uns zu testen." Gelegentlich komme es vor, dass Gefangene ihre Zelle anzünden – so erreichten sie, verlegt zu werden. Hoppach hielt sich an die Vorschriften, erkannte aber nicht, dass die Vorschriften nicht genügten für diesen besonderen Gefangenen.
Eigentlich sind die Behörden in Sachsen stolz auf ihre Gefängnisse. Weil es dort so menschlich zugeht. In Justizkreisen ist Sachsens Vollzug bekannt dafür, besonders viele Mal- und Theaterkurse anzubieten und die Insassen seltener als anderswo in den besonders gesicherten Haftraum zu schicken. Willi Schmid, der Abteilungsleiter für Justizvollzug im sächsischen Justizministerium, genießt unter seinen Kollegen den Ruf, ein liberaler Mann zu sein. Er kam aus Baden-Württemberg nach Sachsen und konnte hier seine Vorstellungen von einem sensiblen Umgang mit den Häftlingen umsetzen. Gegenüber seinen Mitarbeitern soll Schmid einen ruppigen Ton pflegen, gegenüber Gefangenen, heißt es, fordere er Sensibilität.
Was den Leipzigern im Fall Al-Bakr also vorgeworfen wird, ist das, worauf sie bislang stolz waren: nicht so hart zu den Gefangenen zu sein, deren Rechte im Zweifel lieber nicht zu beschneiden. Dieser Stolz hat auch mit einer Angst zu tun, die unter deutschen Gefängnischefs weit verbreitet ist. Sie ist größer als die Angst, dass sich jemand umbringen könnte. Es ist die Angst, als Folterer zu gelten.
Nicht wegen Suiziden kamen Anstalten in der Vergangenheit in die Schlagzeilen. Sondern wegen Foltervorwürfen. Im April 2015 machte diese Meldung die Runde: Die Anwälte des ehemaligen Arcandor-Chefs Thomas Middelhoff beschuldigten Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt Essen der Folter. Die Haftbedingungen seien unhaltbar, hieß es, Middelhoff leide unter Schlafentzug, sei über einen langen Zeitraum hinweg alle 15 Minuten kontrolliert worden. Man tat das aus Sorge, er könne einen Suizid begehen.
Der Aufklärer
Drei Tage nach Al-Bakrs Tod betritt Valentin Lippmann ein Café in der Dresdner Neustadt. Mit der einen Hand zieht der 25-Jährige einen Rollkoffer, die andere trägt einen Schlafsack und eine Aktenmappe. Er muss gleich zu einem Termin nach Jena. Dort wird er wieder einmal über Sachsens Versagen sprechen.
Valentin Lippmann ist so alt wie sein Bundesland. Drei Monate nach dessen Gründung kam er Anfang 1991 in Dresden zur Welt. Als er dort die Grundschule besuchte, galt Sachsen unter der Führung von Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) bereits als das solideste und aufstrebendste der neuen Länder. Zwar gab es schon damals irritierende Nachrichten aus der Region, so etwa 1991 die Meldungen vom Angriff auf eine Ausländerunterkunft in Hoyerswerda. Doch Sachsen, Kernland der Friedlichen Revolution von 1989, gab sich viel Mühe, im neuen Deutschland das Bayern des Ostens zu werden: konservativ regiert, wirtschaftlich überragend, Sieger bei Pisa-Tests.
Als Lippmann aufs Gymnasium ging, meisterten Sachsens Behörden die milliardenteuren Folgen der "Jahrhundertflut" 2002. Und als hätte noch der letzte Beweis gefehlt, wozu die Sachsen imstande sind, ließen sie aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs die Dresdner Frauenkirche wiederauferstehen. Alles penibel nach Budget- und Zeitplan.
Als Lippmann Student der Politikwissenschaft wurde, begann das öffentliche Bild vom soliden Sachsen zu kippen, spätestens als im November 2011 aufflog, dass die aus Thüringen stammenden Terroristen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) jahrelang unbehelligt im sächsischen Zwickau gelebt hatten, unentdeckt von den Behörden des Landes. Schon in den ersten Tagen des Entsetzens begann Thüringens Regierung damit, die eigenen Fehler öffentlich aufzuarbeiten. Nicht so die politische Führung in Sachsen.
Um den NSU soll es auch, wieder einmal, bei der Diskussion in Jena gehen, zu der Valentin Lippmann gleich aufbrechen will. Seit 2014 ist er Landtagsabgeordneter der Grünen, zuständig für Inneres. Ein Aktenfresser, der den Politikbetrieb mit Kleinen Anfragen löchert. Lippmann seufzt. "Ich werde nachher wieder zu erklären haben, was bei uns los ist", sagt er.
In Sachsen sei man seit Jahren nur noch "im Krisenbewältigungs-Modus", sagt Lippmann. "Wenn Pannen passieren, erleben wir bei Regierung, Polizei und Justiz immer den gleichen Dreischritt: Erst werden die eigenen Reihen geschlossen, dann Fehler negiert, schließlich Kritiker im Land als Nestbeschmutzer hingestellt." Ständig begegne ihm dieselbe selbstgefällige Haltung: "Wir machen im Zweifel alles richtig!" Die Folge sei fatal, sagt Lippmann: Wer nie Fehler zugebe, sei es aus Arroganz, sei es aus Angst ums Image, der könne nicht aus Fehlern lernen.
Fehler sind in den vergangenen Wochen und Monaten auch der Polizei passiert, viele Fehler. In Heidenau bei Dresden randalierten im August 2015 tagelang Rechtsradikale vor einem Baumarkt, in dem Asylbewerber untergebracht waren. Weil die Polizei unterbesetzt war, gelang es ihr zunächst nicht, die Lage zu beruhigen. Die Bilder der Kämpfe zwischen Beamten und Demonstranten erinnerten an einen Bürgerkrieg. 31 Polizisten wurden verletzt. Im Dorf Clausnitz im Erzgebirge bedrängten Demonstranten im Februar einen Bus, in dem Flüchtlinge saßen. "Wir sind das Volk!", brüllten sie. Statt die Demonstranten abzudrängen, zerrte die Polizei die Flüchtlinge aus dem Bus. In Bautzen jagten Neonazis im September Flüchtlinge durch die Stadt. Später bezeichnete der örtliche Polizeichef Uwe Kilz die Neonazis beschönigend als "eventbetonte" Jugendliche.
Dass Sachsens Polizei eigene Fehler zugebe, habe er in den vergangenen zwei Jahren nur ein einziges Mal mitbekommen, sagt Lippmann. Das war im November 2015, als der Leiter eines Dresdner Polizeireviers in einem Interview erklärt hatte, man dürfe sich über Krawalle von Asylgegnern in dem Stadtteil nicht wundern, schließlich hätten Flüchtlingshelfer sie mit einem Willkommensfest provoziert. Dafür entschuldigte sich Dresdens Polizeipräsident. Inzwischen hat Dresden einen neuen Polizeipräsidenten, Horst Kretzschmar. Er war im Dienst, als es bei der Feier zum Tag der Deutschen Einheit einigen Pegida-Anhängern gelang, unangemeldet vor der Frauenkirche zu demonstrieren und den Bundespräsidenten, die Kanzlerin und die geladenen Staatsgäste zu beschimpfen.
Sächsischer Starrsinn
Die Mentalität politischer Apparate in Sachsen – das erkannte schon Kurt Biedenkopf – ist von zwei widersprüchlich scheinenden Merkmalen geprägt: dem Minderwertigkeitskomplex und der Hybris. Die Selbstüberschätzung rührt auch daher, dass Sachsen neben Thüringen das einzige Ost-Bundesland mit historischer Identität ist, kein Bindestrichland wie Sachsen-Anhalt, kein Restpreußen wie Brandenburg. In Dresden residierte August der Starke und bescherte der Stadt bedeutende Kunstschätze. Man war hier mal wer und will auch noch wer sein.
Aber die Sachsen sprechen eben auch den in Deutschland unbeliebtesten Dialekt. Sie sind, in Dresden zumal, geografisch abgehängt vom Rest der Republik. Und jemand, der sich groß fühlt, aber für klein gehalten wird, der bildet – neben dem Größenwahn – auch oft einen Minderwertigkeitskomplex aus. Diese beiden Eigenschaften konkurrieren miteinander, können aber auch verschmelzen.
Kurt Biedenkopf wurde schon bald "König Kurt" genannt, den aufstrebenden Rechtsextremismus ignorierte er. Fehler machten in seinen Augen immer nur die anderen. Sachsens CDU handelt bis heute nach diesem Konzept.
Der Soziologe Raj Kollmorgen, Professor an der Hochschule Zittau/Görlitz, glaubt, "dass in Sachsens Politik und Verwaltung aus dem Minderwertigkeitskomplex und aus der Hybris etwas entstanden ist, das in diesen turbulenten Zeiten ein echtes Problem bedeutet: die Unfähigkeit, von anderen zu lernen".
Der Fall Al-Bakr zeige dies. "Von der sächsischen Regierung hört man immer wieder: Wir haben den Laden im Griff! Wir haben eine tolle Verwaltungsstruktur. Wir wissen, wie es läuft. Und wenn es Probleme gibt, dann können wir das selber lösen." Wenn dann ein Problem auftrete, so Kollmorgen, behaupte man einfach: "Es handelt sich hier um einen speziellen Fall, den wir noch nie hatten, aber wir haben trotzdem alles richtig gemacht."
Es gibt ein Vorbild für die sächsische CDU, das ist die bayerische CSU. Die Sachsen verkaufen sich als die Bayern des Ostens: Sachsen ist das finanziell gesündeste der neuen Bundesländer. Es hält sich zudem für das Land mit den besten Polizisten, dem besten Schulwesen, den schnellsten Feuerwehren.
Fragt man genauer nach, hört man Lehrer, die sich schlecht bezahlt und ausgelaugt fühlen, Polizisten, die Überstunde um Überstunde ansammeln, Feuerwehrleute, die sich beklagen, weil das Geld oft nur für die allernotwendigste Ausrüstung reicht. Sachsen versucht, Bayern zu spielen – aber es gelingt nicht.
Längst ist Sachsen Hohn und Spott ausgesetzt, weil den Behörden lauter peinliche Fehler passieren. Aus Angst, sich erneut zu blamieren, wagt man nicht, sich Hilfe zu holen. Die Behörden wurschteln sich durch, tappen in die nächste Falle – und versuchen, den Starrsinn als Souveränität zu verkaufen.
Der Justizminister
Am Morgen nach dem Tod des Terrorverdächtigen Al-Bakr stellte sich Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow in Dresden der Presse.
Eine Journalistin fragte: Übernehmen Sie die politische Verantwortung?
"Ja."
Treten Sie zurück?
"Nein."
Als Gemkow vor zwei Jahren ins Kabinett berufen wurde, wunderten sich nicht nur Juristen. Gemkow? Von ihm hatte man kaum etwas gehört. Gemkow war als Abgeordneter im Landtag ein Hinterbänkler gewesen. Er hatte nur wenige Jahre als Anwalt gearbeitet. Weder als Jurist noch als Abgeordneter hatte er sich in den Vordergrund gedrängt. Er wurde Minister, so erzählte man es sich unter Politikern in Dresden, weil der Regierungschef aus Proporzgründen noch jemanden aus Leipzig ins Kabinett berufen musste – der Heimat des Christdemokraten Sebastian Gemkow. "Jeder wusste, der hat halt keine Ahnung", sagt ein hochrangiger Beamter der sächsischen Justiz. Aber Gemkow habe das Beste daraus gemacht: Er erkläre seinen Leuten nicht die Welt, sondern er lasse sich die Welt erklären.
Gemkow, beim Amtsantritt erst 36, inzwischen 38 Jahre alt, ließ sich einen buschigen Vollbart wachsen, so wirkt er älter. Auch mit sehr unterschiedlichen Menschen kann er gut umgehen. Abteilungsleiter loben ihn dafür, dass er sich nicht einmischt.
Diese Strategie behielt der Minister bei, auch jetzt. Nun aber offenbart die Strategie Gemkows Schwäche: Er ist ein miserabler Krisenmanager. Genau genommen managt er gar nichts. Er versucht, die Krise an sich vorbeigleiten zu lassen.
Am Montag vergangener Woche, als Jaber al-Bakr verhaftet und in seine Zelle gebracht worden war, fragte Gemkow nicht persönlich in der JVA nach, wie es dem so wichtigen Häftling ging. Auch am Dienstag hatte der Minister keinen direkten Kontakt zur JVA. Erst an jenem Abend, als Al-Bakr tot in der Zelle lag, ließ sich Gemkow von der JVA-Leitung unterrichten, wie es zu dem Suizid gekommen war. Rolf Jacob erklärte dem Minister, fachlich sei alles richtig gemacht worden. Alles richtig gemacht – obwohl ein Insasse sich getötet hat? Ein Mann, der womöglich wertvolle Informationen über den IS und dessen Helfer in Deutschland preisgegeben hätte?
Gemkow übernahm einfach die Einschätzung seiner Beamten. Nur in einem einzigen Moment demonstrierte er Entschlossenheit: als er seinen Rücktritt ausschloss. Die Ereignisse umfassend aufzuklären sei auch eine Art, politische Verantwortung zu übernehmen, sagte er. Das ist in Wahrheit das Gegenteil von Politik. Statt zu agieren, versuchte sich Gemkow an der kleinstmöglichen Reaktion.
Der Innenminister
Mit Rücktrittsforderungen kennt sich Gemkows Ministerkollege Markus Ulbig gut aus. Im Gegensatz zu Gemkow ist Ulbig schon lange im Amt, seit 2009 ist er sächsischer Innenminister. Ein politischer Überlebenskünstler. Die jüngste Rücktrittsforderung handelte er sich an einem Montag Anfang Oktober ein. In Dresden trat Ulbig vor die Presse und verkündete aufgekratzt die Festnahme des Gesuchten Al-Bakr. Eine Szene wie aus einem Film über das DDR-Politbüro. Auf dem Podium saß einer und rief: Planziel übererfüllt! Das Publikum aber wusste längst, dass die Realität mit dem Plan wenig zu tun hatte.
Beim ersten Versuch, Al-Bakr in Chemnitz festzunehmen, war eine unbegreifliche Panne passiert. Ein Mann, wahrscheinlich der Gesuchte, hatte morgens gegen sieben Uhr den Plattenbau verlassen, vor dem Einsatzkräfte des Landeskriminalamts lauerten. Er konnte entwischen. Die Beamten, die ihm nachrannten, hätten eine mehr als 30 Kilogramm schwere Schutzausrüstung getragen, versuchten sich Ulbigs Leute herauszureden. Offenbar waren einfach zu wenige Polizisten für den Einsatz eingeteilt worden. Deshalb konnte kein zweiter Ring von Beamten rund um das gestürmte Objekt geschlossen werden, wie es sonst üblich ist. Der Innenminister Ulbig hingegen sprach von einem "großartigen Erfolg", denn schließlich war es ja doch noch gelungen, Al-Bakr festzunehmen. Allerdings nur mithilfe der drei Syrer.
Bei Auftritten vor der Presse wirkt Ulbig meist fahrig. Ganz so, als stehe er neben einer geöffneten Flugzeugluke und wisse, dass er gleich zu seinem allerersten Fallschirmsprung in die Tiefe geschubst wird. Im Innenausschuss des Landtags steht ihm oft der Schweiß auf der Stirn, wenn er zu Sachverhalten Stellung beziehen soll, zu denen ihm niemand etwas in die Akten geschrieben hat. Verfügt er über Autorität? "Er ist ja eher ein weicher Typ", sagt ein Polizeifunktionär und schweigt dann lange.
Markus Ulbig, gelernter Fernsehmechaniker, 1964 in Zinnwald geboren, war einmal eine Nachwuchshoffnung der sächsischen CDU. Immerhin hatte er sich als Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Pirna bewährt. Er engagierte sich auch im Kampf gegen Neonazis und fand damit sogar bundesweite Beachtung. So kam es, dass Regierungschef Tillich auf ihn verfiel, als er 2009 einen Innenminister für sein Kabinett suchte. Zumindest hatte Ulbig einmal kurz im Ministerium gearbeitet, in der Abteilung Städtebau. Von Polizei und Verfassungsschutz hingegen verstand er nichts. Ulbig kam zugute, dass damals im Landtag alle Experten der Innenpolitik ausgeschieden waren. Er war umringt von Abgeordneten, die sich selber erst einarbeiten mussten.
Deshalb hat die Polizei, politisch weitgehend unbeaufsichtigt, ein Eigenleben entwickelt. In Sachsen, so drückt es ein Kabinettsmitglied aus, sei die Polizei ein "Staat im Staate". Der Grünen-Innenpolitiker Lippmann formuliert es so: Es sei "ein politisches Steuerungsvakuum" entstanden, "das die sächsische Polizei nun eben selbst füllt. Freilich ohne dafür die Verantwortung zu übernehmen."
Wie könne es sein, fragt er, dass sich nach dem nächtlichen Anschlag auf eine Dresdner Moschee Ende September nicht gleich die politische Führung um den Fall kümmerte? Stattdessen habe der Dresdner Polizeipräsident mit dem türkischen Generalkonsul über den Schutz der Moschee verhandelt. Den Minister ließ man schlafen. Angeblich hatte man "vergessen", ihn zu informieren.
Der Generalbundesanwalt
Polizisten, die einen mutmaßlichen Attentäter entwischen lassen. Justizbeamte, die keine Vorstellung haben von der Entschlossenheit eines Terroristen. Minister, die keine Autorität in ihrem Zuständigkeitsbereich haben. Die Aufzählung kann einem Angst einjagen. Vielleicht sollte man einen Häftling wie Al-Bakr lieber jemandem überlassen, der sich mit Terroristen auskennt?
Nachdem Jaber al-Bakr sich das Leben genommen hatte, wurde schnell die Frage gestellt, warum der Generalbundesanwalt nicht sofort das Ermittlungsverfahren gegen den mutmaßlichen IS-Mann an sich gezogen hatte. Wäre ein Suizid unter der Obhut des Generalbundesanwalts womöglich verhindert worden? Man kennt schließlich die Fernsehbilder: Ein Terrorverdächtiger wird irgendwo in Deutschland verhaftet und unter großem Sicherheitsaufwand mit einem Helikopter der Bundespolizei zum Verhör nach Karlsruhe geflogen. Dort, denkt man, wird der Verdächtige sicher weggeschlossen – ohne Gefahr für sich selbst und andere.
Doch die Bilder trügen, in der Regel vergehen zwischen der Festnahme und dem Transport nach Karlsruhe viele Tage.
Im Fall Al-Bakr wurde ebenfalls erst einmal die örtliche Justiz tätig. So sieht das Gesetz es vor, auch bei einem Verdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Der Generalbundesanwalt darf die Ermittlungen erst an sich ziehen, wenn diese eine "besondere Bedeutung" haben. Das aber muss zunächst einmal geprüft werden. Seit Freitag, dem 7. Oktober, einen Tag vor der misslungenen Festnahme Al-Bakrs, wurde ständig zwischen Karlsruhe und Dresden telefoniert. Am Sonntagmorgen, da war Al-Bakr auf der Flucht, entschieden die Bundesanwälte aufgrund eines vorläufigen Gutachtens: Ja, dieser Fall habe eine "besondere Bedeutung". Die Ermittlungen lagen nun in Karlsruher Hand – die sächsische Polizei aber blieb weiter zuständig. Al-Bakr wurde mit einem sächsischen Haftbefehl gesucht. Als er in Leipzig festgenommen worden war, führte man ihn deshalb einer sächsischen Haftrichterin vor.
Es mag verwundern, aber die mächtige Generalbundesanwaltschaft, zuständig für besonders bedrohliche Straftaten gegen den Staat und seine Bürger, besitzt gar keine eigenen Gefängniszellen. Der Syrer wäre zwar zum Verhör nach Karlsruhe gebracht worden, aber er wäre dort nicht länger als ein, zwei Tage geblieben. Für diese kurze Zeit muss der Generalbundesanwalt einen freien Platz in einer nahe gelegenen Haftanstalt auftreiben. Anschließend wird der Gefangene meist dorthin zurückgebracht, wo der Prozess stattfinden wird. Im Fall Al-Bakr wäre der Häftling schnell wieder in Leipzig gewesen. Deswegen führt es in die Irre, wenn man den Generalbundesanwalt für das sächsische Justizversagen mitverantwortlich machen will. Wie man es auch dreht und wendet: Die Spur der Fehler führt nach Leipzig – und nach Dresden.
Der Ministerpräsident
Stanislaw Tillich gibt eher selten Interviews. In den Augen vieler Journalisten, die regelmäßig über die sächsische Landespolitik berichten, hat er etwas Abgehobenes, Unnahbares. Am Montag dieser Woche aber, wenige Tage nach der Selbsttötung des Syrers Al-Bakr, empfängt der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands in seinem Büro in der neobarocken Staatskanzlei.
Das Büro ist so groß, dass man darin Walzer tanzen könnte. Der Fußboden hell, die Möbel dunkel. Sie standen schon hier, als der Ministerpräsident noch Kurt Biedenkopf hieß. Kaum hat das Gespräch begonnen, wird es unterbrochen. Tillich greift nach seinem klingelnden Handy. Er sagt entschuldigend, da müsse er dringend rangehen, und entschwindet durch eine Seitentür.
Als er zurück ist, sagt Tillich: "Pardon, das war wichtig. Ich muss mich ja ein bisschen kümmern."
Tillich hat angekündigt, eine Kommission einzusetzen, die den Suizid in der JVA aufklären soll. "Wenn ich eine Expertenkommission einsetze, brauche ich Experten", sagt er. "Und ich habe mich dazu entschlossen, sie selber zu fragen." Der Regierungschef, soll das wohl heißen, hat die Sache jetzt persönlich in die Hand genommen.
Es ist, vielleicht, seine letzte Chance.
In Tillichs Staatskanzlei würden ständig Termine gemacht, deren einzige Botschaft lautet: Der Ministerpräsident ist nett. Das kritisierte schon der Politikwissenschaftler Harald Noeske. Zehn Jahre hatte er als Referatsleiter in der Dresdner Machtzentrale gearbeitet. Diese, schrieb er 2012 in seinem Buch Regieren in Sachsen, sei nicht viel mehr als ein "Organisationsbüro für die nächste Woche". Noeske prangerte die "mangelnde Professionalität" von Politik und Verwaltung an.
Unter Tillich habe die Regierung weitgehend "auf Autopilot geschaltet", sagt ein altgedienter CDU-Politiker aus Sachsen. "Tillich hält das Unangenehme von sich weg." Für ihn sei das Wichtigste, dass nichts Negatives an ihm hängen bleibe. So ist es auch bei vielen anderen Politikern und Managern, bei Tillich kommt hinzu, dass er sich keine Mühe gibt, das politische und intellektuelle Vakuum zu verbergen. Als in Zwickau der Unterschlupf des NSU-Trios entdeckt wurde, sprach Tillich vom "Thüringer Trio" – als gehe ihn die Sache nichts an. Nachdem die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung schon wochenlang durch Dresden marschiert war, forderte Tillich die Stadtverwaltung auf, etwas dagegen zu unternehmen. Ihm selbst fiel nichts ein.
Fragt man ihn nun, wie er auf die Krise in Sachsen reagieren will, antwortet Tillich so leise und monoton, dass man seine Worte kaum versteht. "Wir sind in einer schwierigen Situation", murmelt er. "Weil ein Bild entstanden ist, das den Bürgern dieses Landes nicht gerecht wird. Und wir sind, das kann man sagen, zutiefst betroffen."
Schon die Ausschreitungen in Heidenau und Clausnitz, die Geschehnisse in Bautzen – sie hätten ihn verändert, das erzählen Tillichs Vertraute. Er selbst sagt: "Es geht mir nahe, was da passiert ist." Und zählt auf, was er, angetrieben von seinem kleineren Koalitionspartner SPD, unternommen hat: mehr Geld für Polizei und Justiz, für politische Bildung und Geschichtsunterricht in Schulen. "Aber diese Maßnahmen wirken nicht sofort", sagt er. "Ich bin nicht derjenige, der rechthaberisch ist", meint Tillich. "Wenn ich etwas korrigieren muss, ist das nichts Verwerfliches." Das alles klingt so ratlos, als habe er sagen wollen: Wissen Sie vielleicht, was ich tun soll?
Eine Veränderung im sächsischen Justizapparat ist schon beschlossen. Eine Maßnahme, über die noch vor dem Suizid von Jaber al-Bakr entschieden wurde. Im Leipziger Knast wird eine neuartige Zelle eingerichtet, die Wände werden in hellen, gedeckten Farben gestrichen. Kein Gitter mehr, dafür ein Fenster, durch das Beamte den Häftling ständig beobachten können. In vier Wochen soll es so weit sein. Einen Namen hat die Zelle auch schon: Suizidpräventions-Raum.
Mitarbeit: Moritz Aisslinger, Martin Klingst, Mariam Lau, Martin Machowecz, Daniel Müller, Julia Niemann