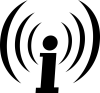Im Kiez ist er Kult. Hans-Georg Lindenau und sein Laden in der Manteuffelstraße sind Überbleibsel eines wilderen Berlins. Jetzt sind beide nicht mehr erwünscht. Doch er verkauft weiter „Revolutionsbedarf“. Nur der Bedarf für Revolution ist nicht mehr so groß wie früher
Die Tür des Ladens in der Manteuffelstraße 99 scheppert und ein junger Mann tritt ein, ganz in Schwarz. Er hätte gerne sechs Dosen Pfefferspray, sagt er, die für 3,50 Euro. „Ah, antifaschistisches Deo“, ruft Hans-Georg Lindenau und gibt dem Mann die Kartuschen. Der zahlt und verschwindet. Lindenau, 58, sitzt in seinem Rollstuhl unter einem Heizstrahler vor der Tür zum Hinterzimmer, in dem er auch wohnt, und wärmt sich auf. Überall sonst sticht die Kälte, am Vormittag ist in dem maroden Gebäude die Gasheizung ausgefallen. Um Lindenau herum stapeln sich Regale voller Klamotten. Kapuzenpullis und T-Shirts mit roten Sternen, Pippi-Langstrumpf-Motiven und Aufdrucken wie „Zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen“ oder „Antifaschistische Aktion“. Daneben liegen Magazine und Bücher über Marxismus, Tierrechte, Antikapitalismus und Anleitungen zum Ladendiebstahl. Bis unter die Decke vollgestopft. Die Gänge zwischen den Regalen, sie sind so schmal, dass man sich kaum umdrehen kann. Lindenaus Regel, deshalb: Rucksack runter und vorne auf der Brust tragen. „Mach dich zum Känguru“ plärrt er jedem entgegen, der durch die Tür in seinen Laden kommt.
Seit 30 Jahren betreibt Hans-Georg Lindenau, den jeder hier nur HG nennt, seinen linken Szeneladen M99 in Berlin-Kreuzberg. Verknitterte Kleidungsstücke und Schuhe liegen in Kisten vor den Fenstern im Schnee, daneben eine alte Kaffeemaschine und ein paar Bücher. Die Ladenfront sieht aus, als wäre das Innere durch Fenster und Türen nach außen gequollen. Als wären die Räume im Erdgeschoss des Eckhauses zu klein, um zu fassen, was der Laden bietet: „M99 - Gemischtwarenladen mit Revolutionsbedarf“, steht unter den Fenstern im ersten Stock, in Schwarz auf Gelb, von Hand geschrieben. Es gibt nur nicht mehr so viel Bedarf für Revolution wie früher.
Das Geschäft ist eines der Letzten seiner Art. Einen wie Hans-Georg Lindenau gibt es ohnehin nicht noch mal. Beide, Laden und Lindenau, sind in der Manteuffelstraße nicht mehr erwünscht. Die Kündigung des Vermieters ist rechtskräftig. Lindenau ist trotzdem noch da. Welcher echte Revolutionär schert sich schon um die Regeln des Systems?
Und so weckt Lindenaus Laden Erinnerung an Berlins wildere Zeiten. Er ist ein Überbleibsel eines früheren Kreuzbergs, das langsam verschwindet. Kreuzberg, das war lange Zeit gleichbedeutend mit Widerstand gegen den Staat, Synonym für ungeordnete Verhältnisse. Anfang der 1980er - der Bezirk lag damals gleich neben der Mauer - waren rund 80 Häuser besetzt. Der Stadtteil war Schauplatz der ersten großen Straßenschlachten zwischen Hausbesetzern und der Polizei, hier haben die Maidemonstrationen ihren Ursprung. Wie Berlin sich seit dem Mauerfall gewandelt hat, lässt sich wohl nirgends so leicht beobachten wie hier. Viele der ursprünglichen Läden sind verschwunden, stattdessen reihen sich hippe Bars und Cafés aneinander. Nirgends waren im letzten Jahr die Durchschnittsmieten höher.
Lindenau lebt den Gegenentwurf. Vor seinem Laden stehen Kisten. „Freebox“ nennt er das Konzept. Jeder, der etwas hat, das er nicht braucht, kann es hier ablegen. Jeder, der etwas braucht, kann es mitnehmen. Alles für alle.
Ums Geldverdienen ging es Lindenau bei seinem Laden von Anfang an nicht. Für ihn sind die Besucher keine Kunden, sondern Reisende. „Ich teil die in drei Gruppen ein: Traveller Dialog, Traveller NGO und Traveller Konsum“. Seine Waren verkaufe er nur, um das M99 erhalten zu können. Es gehe vor allem um Kommunikation und politische Vernetzung.
1985 hat Lindenau das M99 als Copyshop und alternativen Buchladen gegründet. Nicht sein erstes Projekt. Seit er 18 ist, war er, der gebürtig aus Franken kommt, in der Hausbesetzerszene Westberlins aktiv. Seine Wohnsitze im Laufe der Jahre, ein Best-of der Hausbesetzerszene: Kuckuck, Schrippenkirche, Rauch-Haus. Wohnraum ohne Staat, gegen das System.
Alles lange her. Geschichten über Revolution beginnen in Kreuzberg heute oft mit: „Weißt du noch?“
Lindenau ist vielleicht der Letzte, der den Kampf nie aufgegeben hat und auch kurz vor dem Rentenalter willens ist, einen neuen anzufangen.
Der Eigentümer des Hauses in der Manteuffelstraße 99 hat Hans-Georg Lindenau gekündigt. Laut Cornelius Wollmann, dem Anwalt des Hauseigentümers, wurde Lindenau deswegen gekündigt, weil dieser mehrfach gegen den Mietvertrag verstoßen habe. Er habe Räume seiner Wohnung an andere untervermietet und sich auch nach mehrmaliger Aufforderung und einer Abmahnung geweigert, diesen Untermietern zu kündigen. Lindenau hingegen vermutet Profitgier. Man wolle das Haus renovieren und teurer weitervermieten, sagt er. Die Revolution, so muss sein Vorwurf lauten, soll einfach weggentrifiziert werden.
Wer über Gentrifizierung in Kreuzberg redet, muss früher oder später auch mit Sigmar Gude sprechen. Kaum jemand hat sich tiefer mit den Veränderungen in den Berliner Innenstadtbezirken beschäftigt als Stadtforscher Gude mit seinem Büro Topos. Der Soziologe untersucht seit Jahren die Entwicklung in Kreuzberg. Für Leute wie Lindenau, sagt Gude, seien die Voraussetzungen früher ideal gewesen. Die Mieten waren günstig. „In den 80er und 90er Jahren sind mit dem Aufkommen der großen Einkaufszentren viele kleine Läden verschwunden. Die Eigentümer waren damals froh, überhaupt Mieter zu finden“, sagt er. Wer das war, sei dabei eigentlich egal gewesen. Freie Platzwahl für autonome Enklaven.
Jetzt, knapp 30 Jahre später, lasse sich die Geschichte des M99 durchaus auch als eine Geschichte der Gentrifizierung verstehen. „Normalerweise bezieht sich ja Gentrifizierung immer auf Wohnungen“, sagt Gude zwar, „aber man muss auch das Verschwinden von kulturellen Angeboten, die von der angestammten Bevölkerung eines Bezirks genutzt werden, dazuzählen.“ Das drohende Verschwinden des M99 sei also ein Problem. „Heute können Eigentümer mehr Miete verlangen und wünschen sich oft auch ein anderes Image für ihre Gebäude. In Kreuzberg geht so etwas an die Substanz. Solche Läden sind Angebote für bestimmte Bevölkerungsschichten, die einen sehr speziellen Charakter haben, die aber den speziellen Charakter des Viertels ausmachen“, sagt er.
Speziell war Lindenau schon immer. Dabei wollte er nach der Schule eigentlich in einer Bank arbeiten. In den späten Siebzigern, erzählt er, habe er sich politisiert, besetzte Häuser und protestierte gegen die Teilung Deutschlands. 1988 organisiert er eine Mauerflucht in den Ostteil der Stadt. „Ich habe die Mauer immer als Kunstobjekt begriffen“, sagt er. Einen Tag bleibt er drüben, dann fährt er zurück in den Westen. Er ist überzeugt, damit den Grundstein für den Mauerfall gelegt zu haben. „Das was die später gemacht haben, auf der Mauer tanzen und so, das haben wir schon damals gemacht.“
Im Rollstuhl sitzt Lindenau seit 1989. In diesem Jahr, so sagt er das selbst, starb er. Nach seiner Mauerflucht plagte ihn die Angst. Er fühlte sich verfolgt, von Staatsschutz und System. Immer, wenn die gefühlte Bedrohung überhand nahm, kletterte er durch ein Fenster in die Kirche am Lausitzer Platz und wartete, bis es vorbei war. Suizidprävention nennt er das. Eine Zeit lang ging es gut. Dann, an einem Tag im September, sprang Hans-Georg Lindenau vom Dach. Warum, weiß er nicht. Mehrere Wochen lag er im Koma. Als er wieder aufwachte, war er querschnittsgelähmt.
Kaum aus dem Krankenhaus entlassen, zog Lindenau zurück in seinen Laden. Immer wieder verreiste der „Sitzbeiner“, wie er sich fortan selbst nannte. Er besetzte Bäume im Redwood Forest und tingelte als singender Bettler durch Europa. Kostprobe gefällig? Lindenau beginnt zu singen, ein selbst erfundenes Lied, das von den Grenzen in den Köpfen der Menschen handelt, von Frieden und von Solidarität. Mit tiefen Tönen fängt er an und schraubt seine Stimme immer höher, bis sie in einem hohen Jodler bricht. Einmal auf Mykonos, erzählt er, habe Nana Mouskouri ihn singen gehört und ihm 40 Euro gegeben. Ein anderes Mal habe er beim „Supertalent“ gesungen. Wie bei vielen seiner Geschichten ist nicht ganz klar, was Mythos ist und was Wirklichkeit. Revolutionsfolklore. Seine Kunden kommen von überall aus der Welt zu ihm, um Aufkleber und andere Ungehörigkeiten zu kaufen. Auf einer Website über besetzte Häuser wird er als „Der jodelnde Alleshändler“ angepriesen. Sollte die Revolution ein Maskottchen gebraucht haben, hat sie in Lindenau eines gefunden.
Im Kiez ist er Kult. Der junge Mann, der im Späti in der Manteuffelstraße hinter der Theke steht und gelangweilt auf Kunden wartet, weiß sofort, um wen es geht. „Das ist doch der, der immer mit dem Rollstuhl die Straße entlangfährt“, sagt er und lacht. „Der ist nett“.
Der Mann in braunem Anorak, der an der Sparkasse am Lausitzer Platz für ein paar Cent die Tür aufhält, kennt Lindenau auch. „Von dem hab ich meine Schuhe“, sagt er und zeigt auf die dicken Winterstiefel an seinen Füßen. „Ich hab eigentlich die Hälfte meiner Klamotten aus der Freebox vor dem M99“.
In der linken Szene selbst, sagt ein Bekannter über Lindenau, sei er hingegen nicht unumstritten. Weil er mit allen rede. Keine Grabenkämpfe, keine Lager, keine Macht für niemanden.
Ein blonder, junger Mann mit glattem Gesicht steht in schwarzen Klamotten vor Lindenau und probiert ein Paar Handschuhe an. „Sind die demotauglich, oder bekomme ich da in der Vorkontrolle Ärger?“ fragt er. Manche Handschuhe werden bei Demonstrationen als Passivwaffen betrachtet und sind deshalb dort nicht erlaubt. „Die sind nur gefüttert“, antwortet Lindenau. Sollte also klappen. Der Blonde kauft noch ein Halstuch. Eines, das er im Fall der Fälle schnell über sein Gesicht ziehen kann. Außerdem nimmt er eine schwarze Hose mit großen Taschen und eine Windjacke mit. „Der starke Regen geht am Samstag los“, sagt er zum Abschied. Am Samstag will er auf eine Demo.
Für solche Anlässe verkauft Lindenau auch Gasmasken und Tränengas. Zur Verteidigung notwendig, sagt er. Und obwohl er selbst für sich nur das Wort als Waffe gewählt hat, hat er damit kein Problem. Andere sehen das problematischer. Das M99 zieht immer wieder die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. 54 Mal hat sie in den vergangenen 30 Jahren Lindenaus Laden durchsucht. Dabei ging es fast immer um verbotene Zeitschriften und den Aufruf zu Straftaten. Zu einer Verurteilung sei es trotz all dieser Razzien nur einmal gekommen, erzählt Lindenau. „Und die wurde dann wieder aufgehoben.“
Als er das erste Mal eine Kündigung für seinen Mietvertrag erhielt, wandte sich der Anarchist schutzsuchend an den Staat, den er verachtete, zog vor Gericht. Sieben Vermieter und mehrere Kündigungen hat er so überstanden. Hilfe bekommt er beim Kampf um seinen Laden von Burkhard Draeger. Seit 25 Jahren vertritt er seinen Nachbarn, hilft ihm dabei, zu bleiben, wo er ist. Anders als früher jedoch hatten sie diesmal keinen Erfolg. Das Gericht gab dem Vermieter recht. Draeger sieht das mit Sorge. „Der Laden ist sein Leben“, sagt er.
Dabei hätte es mit Lindenaus Laden nicht so weit kommen müssen, sagt der Anwalt des Vermieters. Man habe mehrere Vergleichsangebote unterbreitet, auf die Lindenau nicht eingegangen sei. Eines dieser Angebote: den Laden behalten, aber ohne Untermieter und ohne die Räume im ersten Stock. Für Lindenau kommt das nicht infrage. „Wenn ich in einer behindertengerechten Wohnung wohne, besuchen mich die Leute nur als Behinderten. Das will ich nicht“, sagt er. Ihm gehe es darum, selbstbestimmt zu leben und zu arbeiten. Das könne er nur mit der Unterstützung seiner Untermieter. Deshalb will er seine Wohnung genau so behalten, wie sie ist. Revolution und Kompromiss vertragen sich nicht.
Einen Gegenvorschlag habe Lindenau bisher nicht gemacht, sagt der Anwalt des Eigentümers.
An diesem Nachmittag im Januar, als Lindenau in seinem Laden unter dem Heizstrahler sitzt, sollte er natürlich schon längst nicht mehr da sein. Laut Urteil hätte er seinen Laden am 31. Dezember 2015 räumen müssen. „Freiwillig geh ich hier nicht raus“, sagt er. An die Lehne seines Rollstuhls hat er eine Tafel montiert. „M99 bleibt!“ steht darauf und „Besetzt seit 1.1.2016“.
Zwei Teenies betreten den Laden. „Bitte, macht euch zum Känguru“, ruft Lindenau wieder. „Hallo, ja, wissen wir schon.“ Die beiden nehmen ihre Rucksäcke ab und zwängen sich durch die engen Gänge. Er, in Schwarz, mit „FCK CPS“-Button an der Jacke, will Handschuhe kaufen. Zückt sein Handy und wählt eine Nummer. „Mama? Ich bräuchte ja eigentlich Handschuhe. Hier gibt es welche. 13 Euro kosten die. Ok, tschüs!“ Dann kauft er aber doch keine, weil seine Begleitung - bunte Winterjacke, schwarze Röhrenjeans, Zahnspange - ihm das Geld nicht auslegen will. Mit den Rucksäcken vorne, Lindenau zuliebe, verlassen sie den Laden. Sie würden ihm helfen, versprechen sie noch. Zur Demo kommen, ganz bestimmt.
Natürlich hat Lindenau getan, was jeder gute Aktivist in seiner Lage tun würde. Er organisierte eine Demo. Auf großen Plakaten wirbt er für seine „M99 Himmelfahrt“ und lädt jeden, der in seinen Laden kommt, dazu ein. 1000 Leute wären gut, sagt Lindenau. Dann könne es klappen, glaubt er, wie bei Bizim Bakkal. Im vergangenen Jahr hatten mehr als Tausend gegen die Schließung des alten Gemüseladens in der Wrangelstraße protestiert und erreicht, dass dem Betreiber der Vertrag verlängert wurde.
Zu der Demo am vergangenen Samstag sind dann wirklich etwa 1200 Leute gekommen. Vom roten Lautsprecherwagen dröhnte Rio Reiser. Eine Rednerin schwörte die Teilnehmer auf den Protestmarsch ein: nicht mit den Bullen reden, bei Verhaftung die Hotline anrufen, Standard. Im Polizeibericht wird später stehen, es habe „einige Rangeleien“ gegeben und aus der Menge heraus „soll ein Stein in Richtung der Polizisten geworfen worden sein.“ Die Revolution frisst ihre Kinder nicht mehr, der Staat hat ihr nach und nach die Zähne gezogen. Seit Mitte 2015 gilt in Berlin die Mietpreisbremse. In der Wrangelstraße 66 schritt gar der Bezirk ein, machte von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch und verhinderte, dass die Wohnungen an eine Gesellschaft in Luxemburg verkauft wurden. Kompromisse, mit denen Lindenau wohl wenig anfangen kann.
Die Tür in der Manteuffelstraße 99 scheppert wieder und ein Mann mit langen, grauen Haaren und Schnauzbart zwängt sich durch die Gänge auf Lindenau zu. Er kennt ihn, auch er war Hausbesetzer. Sie beginnen, sich über früher zu unterhalten. In welchem Haus warst du wann? Wer war da noch? Ah, damals! Ja, da war ich schon weg. Fachsimpeln. Irgendwann, als die Geschichten ausgehen, fragt Lindenau den Mann: „Sag mal, kennst du das auch, dass viele von denen, die früher dabei waren, heute tot sind?“