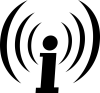Bereits in unserer letzten Ausgabe widmeten wir uns den jüngsten rassistischen Ausschreitungen in Deutschland. Der Artikel „Zwischen grenzenloser Solidarität und mörderischem Rassismus“ setzte sich gleichermaßen mit dem institutionellen Rassismus der Politik, der medialen Stimmungsmache der Medien und den mit Ressentiments beladenen „besorgten Bürgern“ auseinander, wie auch mit den unschwer erkennbaren Parallelen zu den rassistischen Mobilisierungen der 1990er Jahre. Zusammen mit der Wiederveröffentlichung des Textes „Ein Blick zurück in Zorn“, welcher fünf Jahre nach den Pogromen von Rostock-Lichtenhagen entstand und dem Artikel der „Antifa Klein Paris“, welcher sich unter anderem auf die sogenannte „Feuerwehrpolitik“ der Antifa in der jetzigen Zeit bezieht, hofften wir zu der notwendigen Diskussion einen Teil beitragen zu können. Seitdem ist viel passiert und es verging keine Woche ohne Brandanschläge und Angriffe auf geplante oder bezogene Flüchtlingsunterkünfte und kein Tag ohne rassistische Demonstrationen oder körperliche Übergriffe auf vermeintliche und tatsächliche Asylsuchende.
In Gesprächen rund um die Frage was getan werden kann, um dieser rechten Bewegung die Stirn bieten zu können, begegnet man immer wieder Gefühlen der Ohnmacht, der Lähmung. Es scheint fast so, als ob bisherige Erfahrungen, Konzepte und Strategien nur schwer angewandt werden können. Meist finden die Ausschreitungen im ländlichen Raum statt, in denen antifaschistische Strukturen nur marginal vertreten, oder mit den Ereignissen überfordert sind. Wir mussten jedoch auch lernen, dass sich Provinz und Großstadt oft nicht viel nehmen, wir in Dresden ebenso wenig ausrichten konnten, wie in Freital oder Heidenau, wir in Erfurt einem ähnlich gewalttätigem Mob begegnen wie derzeit jeden Montag in Leipzig. Die Zeit rast, die rassistische Stimmung innerhalb der Gesellschaft wächst und Antifaschist_innen müssen sich der Lähmung und Lethargie stellen und realistische Herangehensweisen zur Intervention überlegen, bevor die Situation erneut eskaliert.
Dieser Text soll ermuntern, die geführten Auseinandersetzungen zu intensivieren. Dafür werden konkrete Handlungsmöglichkeiten zur Diskussion gestellt und Ideen zur Voranalyse gegeben.
Wenn wir von „Wir“ sprechen, meinen wir einerseits uns als organisierte Antifaschist_innen im Allgemeinen, egal ob aus Groß- oder Kleinstadt, die es satt haben, jedes Wochenende neue Hiobsbotschaften aus #Kaltland zu bekommen, ohne adäquate Lösungsansätze vorstellen zu können. Andererseits richten sich die konkreten Überlegungen geziehlt an Bezugsgruppen, in denen der Konsens herrscht, spätestens „wenn es brennt“, gemeinsam einzugreifen. Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist eine akute, für Geflüchtete lebensbedrohliche Situation, in der wir Antifaschist_innen konkret handeln müssen, d.h. im Moment einer zu erwartenden rassistischen Ausschreitung oder eines Pogroms.
Antifa heißt Austausch
Wir sind kaum handlungsfähig, wenn wir hunderte Kilometer in eine fremde Stadt fahren, ohne Vorkenntnisse über die dortige Situation, Stimmung und Bedrohungslage zu haben. Im besten Fall gibt es selbst in der ländlichsten Region Antifa-Gruppen oder antirassistische Bündnisse, auf deren Einschätzungen wir uns stützen können und mit denen wir in Kontakt treten sollten. Im schlechtesten Fall sind wir auf uns gestellt und müssen uns durch eigene Recherche einen Überblick verschaffen. Hilfreich dafür kann es sein, Genoss_innen anzusprechen, die in den jeweiligen Regionen gelebt haben um mit ihnen gemeinsam die lokale Situation nachvollziehen zu können.
Im Falle der Kleinstädte und Dörfer haben wir immer wieder feststellen können, dass sich die meisten kennen. Wir können nicht von außerhalb Strukturen aufbauen, können aber unterstützend wirken und Impulse geben, auch ohne Großstadtarroganz.
Für die Gruppen vor Ort ist es in der jetzigen Situation unabdingbar Bündnisse zu verfestigen und politische Mitstreiter_innen zu finden, um in Notlagen verlässlich zusammen handeln zu können und gleichzeitig eine ansprechbare Struktur für Auswärtige zu etablieren. Denn ohne regionale Strukturen sind Auswärtige oft handlungsunfähig.
Sind diese lokalen oder regionalen Strukturen vorhanden, ist es für Auswärtige unablässig, diese in strategische Entscheidungen einzubinden und die vorhandenen Ängste und Sorgen ernst zu nehmen. Argumente wie „Wenn ihr hier den Nazis was antut, fällt das auf die eh schon kleine regionale Szene zurück“ müssen verstanden, aber auch kritisch hinterfragt werden. Richtig ist: Insbesondere wenn wir längere Anreisewege haben, können wir keinen kontinuierlichen Schutz lokaler Strukturen gewährleisten. Jedoch ist es wichtig sich die eigenen Handlungsoptionen nicht vollständig einschränken zu lassen. Oft sind es lediglich Mythen, in denen sich das politische Gegenüber sonnt, als das tatsächlich No-Go-Areas existierten. Diese Mythen müssen wir prüfen und verifizieren. Antifaschistisches Engagement wird immer konfliktbehaftet sein und auf Widerstand seitens der extremen Rechten stoßen. Das jedoch darf nicht ausschlaggebend für unser Handeln sein. Stattdessen sollten wir uns überlegen, wie wir ländliche Strukturen unterstützen können, damit antifaschistische Interventionen auch in dem kleinsten, konservativsten Dorf möglich sind. Das schließt ein, dass wir die Kontakte halten, regelmäßigen Austausch suchen und immer wiederkommen, wenn es notwendig ist.
Neben Kontakten zu lokalen Strukturen sollten wir zur Vorbereitung auch eigene Recherchen anstellen. Wichtige Fragen dabei sollten sein: Wann und wo eröffnen Unterkünfte, welche Art der Unterbringung (Notunterkunft, Heim, dezentrale Unterbringung) wird in Betracht gezogen, welche Stimmung herrscht innerhalb der Bevölkerung, gibt es bereits rassistische Initiativen und wenn ja, welches Mobilisierungs- und Gewaltpotential geht von ihnen aus? Gibt es Ansätze zivilgesellschaftlicher Willkommensinitiativen und haben wir Kontakt zu diesen? Gibt es möglicherweise sogar Kontakte zu Bewohner_innen bestehender Heime?
Im Unterschied zu den 1990er Jahren gibt es heutzutage fast unbegrenzte Möglichkeiten, durch soziale Netzwerke und schnelle, sichere Kommunikation, jeden noch so kleinen Funken rassistischer Mobilmachung nach zu vollziehen. Andererseits ist eine extreme Rechte durch den technischen Fortschritt in der Lage schneller zu mobilisieren und ihre Aktionen virtuell aufzubauschen.
Tankstellen und Gewerbegebiete
Haben wir konkrete Befürchtungen, d.h. bahnen sich rassistische Ausschreitungen an, werden wir im Vorfeld Ortsbegehungen machen müssen. Diese geben uns auf der einen Seite einen Überblick über die lokalen infrastrukturellen Gegebenheiten, auf der anderen Seite ein Gefühl für die Stimmung vor Ort. Rechte Mobilisierungen können in sozialen Netzwerken ein hohes Maß an Organisation vermitteln, in der Realität können diese Zusammenschlüsse aber auch marginal sein. Andererseits können etwaige Mobilisierungen in der Realität auch bedrohlicher sein, als sie im Netz erscheinen.
In der Vorrecherche müssen wir Schwerpunkte setzen und arbeitsteilig vorgehen. Es ist unmöglich knapp 70 rassistische oder neonazistische Aufmärsche und Kundgebungen — so viele fanden in der ersten Novemberwoche 2015 statt — ausführlich zu analysieren, doch dürften wir über die Jahre einen Blick dafür entwickelt haben, wo Brennpunkte entstehen könnten.
So sollten wir die Entwicklung rund um größere Erstaufnahmeeinrichtungen besonders im Blick haben, seien es umfunktionierte Baumärkte, Turnhallen oder ähnlich große Gebäude. Unserer Einschätzung nach fühlen sich die RassistInnen von diesen besonders bedroht, da die Aufnahmekapazitäten dort noch einmal höher sind als bei regulären Asylunterkünften. Außerdem ist das Terrain um diese oft weitläufig und schwer überschaubar: Sie liegen oft am Stadtrand bzw. in Gewerbegebieten. Einem rechten Mob wird es da einfacher gelingen, anzugreifen. Wir hingegen hätten dort die Herausforderung den Überblick zu wahren und Schutz zu realisieren.
Im Rahmen der Vorrecherche ist es ebenso wichtig, aktuelle Aktionsformen der Angreifenden zu analysieren. In Heidenau wie auch jüngst an anderen bezugsfähigen Unterkünften zeichneten sich erste Proteste durch Versammlungen an populären Orten im Stadtgebiet ab. Vielfach waren es Tankstellen oder Parkplätze vor Supermärkten, die einem eher unorganisierten rassistischen Klientel Anlaufpunkte boten. Es folgten spontane Blockaden der Zufahrtswege, um ankommende Busse mit Flüchtlingen zu stoppen. Auch die Versuche in Freiberg, Zwickau oder Meerane, Flüchtlinge an sogenannten Drehkreuzen an der Weiterfahrt zu hindern, sollten wir genauestens verfolgen, um bestehende Mobilisierungen begreifen zu können.
Die Ausschreitungen folgen einem ähnlichen Muster.
In Rostock-Lichtenhagen wie auch in Heidenau hat sich die Lage über Tage hinweg zugespitzt und ist dann aufgrund von „Erfolgen“ seitens des Mobs eskaliert. Diese „Erfolge“ dürfen wir nicht außer Acht lassen, denn auch wenn es anfangs nur 50 Rechte auf der Blockade waren, so standen wir einen Tag später mehreren Hundert gegenüber. Ein Meldesystem unsererseits ist daher unabdingbar und eine frühe Erkennung der Lage notwendig. Dass wir nicht jedes Wochenende vor ein und der selben Unterkunft stehen können, steht fest, doch sollten wir uns Richtlinien schaffen, nach denen wir eine Reise in Betracht ziehen. Dabei sollten Alarmismus vermieden und umlaufende Informationen verifiziert werden. Es ist besser, fünf mal präsent gewesen zu sein, als nur einmal eine Situation nicht erkannt oder ernst genommen zu haben, zumal wir durch jede Anreise an Erfahrung reicher und in Organisation und Auftreten sicherer werden.
Von der Erkenntnis zum Handeln
Für diejenigen, die sich entschließen, los zu fahren, sollte vorher klar sein, auf was sie sich einlassen. Wichtig ist es auch Kriterien zu entwickeln, die für die Entscheidung, zu fahren oder nicht zu fahren, bedeutend sind. In den vergangenen Monaten kam es des öfteren zu rechten Angriffen noch bevor die Heime bezogen waren. Der rechte Mob beschäftigte sich mit der Polizei, ohne dass Flüchtlinge in Gefahr gewesen sind. Wir sehen in solchen Situationen keinen konkreten antifaschistischen Interventionsbedarf, da wir dort unsere Ressourcen und Kapazitäten verschwenden, ohne jedoch Flüchtlinge in einer bedrohlichen Lage geschützt zu haben. Solche Ereignisse sollten uns dennoch als Indikator dienen. Sie geben uns die Möglichkeit, eine eventuelle rechte Mobilisierung nach Einzug von Flüchtlingen abschätzen zu können. Auch hier ist zu fragen: Wer sind die ProtagonistInnen und wer schaut zu und klatscht Beifall? Solche Attacken sind Teil einer Eskalationsspirale und sollten bei uns höchste Alarmbereitschaft auslösen.
Falls wir uns entscheiden zu fahren, brauchen wir Selbsteinschätzungen und auch ein Gefühl dafür, auf was sich andere Gruppen einstellen und wie deren Konzepte sind. Notfallbündnisse müssen im Vorfeld geschmiedet und deren Entscheidungen sollten in den Bezugsgruppen diskutiert werden. Ein Notruf muss verifizier- und argumentierbar sein.
Gemeinsames Handeln nach gemeinsam beschlossenen Richtlinien kann uns allen ein sicheres Gefühl und Auftreten geben, sowie Sorgen und Ängste minimieren. Je mehr wir vor solchen Ereignissen miteinander reden und unsere Ängste thematisieren, desto weniger Worte müssen wir im Notfall auf einberufenen Treffen verlieren. Wir müssen eine Basis finden, auf der sich niemand ausgeschlossen, aber auch nicht ausgebremst oder eingeschränkt fühlt. Offensive Intervention und passiver Schutz können sehr wohl gemeinsam funktionieren. Dies allerdings nur, wenn jede teilnehmende Person im Vorfeld mit sich und den Mitstreiter_innen klärt, wie man sich an einer Intervention beteiligt. Wir verweisen dabei grundlegend auf das Prinzip der Bezugsgruppe und sehen keinen Sinn, mit einem wahllos zusammengewürfelten Haufen Entscheidungen zu treffen.
In Situationen bevorstehender rassistischer Attacken sprechen wir uns dafür aus, mehr Risiken einzugehen. In der konkreten Situation eines Pogroms sind kaputte Auto-scheiben oder andere Sachschäden wohl zu verkraften. Der materielle Schaden lässt sich gemeinsam tragen. Körperliche Auseinandersetzungen sind in diesen Momenten nicht immer unumgänglich, müssen aber in Relation stehen. Vielleicht riskieren wir unsere Unversehrtheit, in dem wir uns einem Mob offensiv entgegen stellen. Im besten Fall können wir dadurch jedoch schlimmeres verhindern. Wir haben den „Luxus“ es uns auszusuchen, Teil einer solchen Auseinandersetzung zu sein, die Betroffenen rassistischer Gewalt können das nicht.
Ängste vor konfrontativen Situationen im Sinne einer (Selbst)-Verteidigung lassen sich durch gemeinsames Durchsprechen — oder auch das Üben von koordiniertem Agieren — abbauen oder wenigstens rationalisieren.
Manchmal lieber weg von der Professionalität und hin zur Konsequenz.
Hinsichtlich zu erwartender Repression wünschen wir uns mehr Selbstvertrauen und Rationalität. Im Moment einer Auseinandersetzung, welche auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, sollten wir uns fragen, in wie weit unser Handeln schlicht Notwehr bzw. Nothilfe ist. Die gilt insbesondere in Situationen, in den die wenigen bereitstehenden Polizist_innen überfordert sind. Wir haben Handlungsspielräume und die sollten wir auch nutzen. Heidenau hat einmal mehr gezeigt, dass man sich allein auf diejenigen, die für den Schutz der Unterkünfte zuständig sind, nicht verlassen kann. Dafür sprechen auch die Erfahrungen aus den 1990er Jahren. Weder eine Sicherheitsfirma, deren Personal nicht selten aus den Reihen der extremen Rechten rekrutiert wird, noch die Polizei können verlässliche Partner sein. Durch die Stigmatisierung der Antifa durch den Staat und die Medien werden wir in rassistischen Ausschreitungen selbst zum Störfaktor, wenn wir den Mob an seinem Handeln aktiv hindern. wird.
Wir fassen zusammen. Um effektiv in eine pogromartige Auseinandersetzung intervenieren zu können, brauchen wir verifizierte Informationen über das Geschehen, nachhaltige Kontakte zu Strukturen in der Region, selbstkritische Einschätzungen über die Möglichkeiten unseres Handelns sowie eine gehörige Portion Selbstvertrauen.
Öffentlichkeit schaffen und Selbstermächtigung stärken
Es wäre naiv zu glauben, dass Heidenau eine einmalige Sache war. Die aktuelle rassistische Stimmung in der Gesellschaft wächst und schafft den Nährboden für weitere gewalttätige Ereignisse. Rassistische Aufmärsche finden an vielen Orten gleichzeitig statt, was zur Folge hat, das wir — als antifaschistische Bewegung — uns entweder auf eine Stadt konzentrieren oder uns aufteilen müssen.
Wenn wir zahlenmäßig schlecht aufgestellt sein sollten, bleibt uns die Möglichkeit, Öffentlichkeit zu schaffen, sei es durch Kundgebungen, Demonstrationen oder Willkommensfeste. Dadurch nötigen wirPolizei und Behörden zur Präsenz und schaffen Sensibilisierung. Darüber hinaus können wir so auch direkten Kontakt zu den Flüchtlingen aufnehmen, auch wenn dies schwer ist, sei es durch die hohe Fluktuation oder durch Konflikte innerhalb der Unterkünfte.
Wir müssen ihre Selbsthilfe stärken, Selbstermächtigung und Austausch fördern. Viele der Flüchtlinge können Genoss_innen sein, mit denen wir gemeinsame Kämpfe führen können bezüglich eines Lebens in Würde. Der Hintergrund derer, die nun in diesen Sammelunterkünften leben müssen, sollte nicht außer Acht gelassen und ihr Blick auf die Geschehnisse um sie herum nicht vergessen werden. Oftmals bedarf es keiner großen Erläuterung, was für ein brauner Mob vor ihrer Unterkunft tobt oder welche Rolle die Polizei spielt. Faschistische Gewalt und Rassismus spielen auch in vielen Herkunftsländern der Flüchtlinge eine Rolle und das autoritäre Verhalten, bzw. der ambivalente Zweck einer Polizei ist weltweit bekannt. Dazu vereint beide eine fehlende Empathie gegenüber den Fluchtursachen, wobei die Konsequenz der RassistInnen Hass und Gewalt, die der Polizei unwürdige Behandlung und Abschiebung ist.
Gräben überwinden und Kämpfe vereinen
Wir müssen wieder lernen, (Zweck-) Bündnisse einzugehen und Diskussionen möglich zu machen, in denen wir uns nicht in Kleinigkeiten verlieren. Uns geht es in erster Linie darum, rassistische Ausschreitungen zu verhindern. Wir sind aber auch politische Individuen, mit eigenen Ideen und Vorstellungen. Antifaschistische Intervention sollte kein Selbstzweck werden, auch wenn oft von „Feuerwehrpolitik“ die Rede ist. Stattdessen sollte sie nachhaltig sein und uns auch außerhalb der konkreten Aktion vereinen. Uns schwebt ein dichtes Netzwerk antifaschistischer Bezüge vor, das im ländlichen Raum genauso erreichbar und handlungsfähig ist wie in Großstädten. Es braucht Plattformen, auf denen ein schneller Austausch nötiger Informationen möglich ist, so dass sich jeder Zusammenhang ermächtigt fühlt zu Handeln, mit dem Wissen um mögliche Mitstreiter_innen, deren Ansätze ähnlich ausgerichtet sind.
Liebe Mitstreiter_innen, wir befinden uns in einer sehr düsteren Zeit, deren Ende noch lange nicht absehbar ist. Rassistische Stimungsmache auf den Straßen und in den Behörden, Übergriffe und Ausschreitungen werden uns auch zukünftig beschäftigen. Lasst uns aus den 1990er Jahren lernen und uns zügig und intensiv auf kommende Ausschreitungen vorbereiten. Zwischen den Pogromen in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen lag auch fast ein Jahr. Zeit, die nur ungenügend genutzt wurde um eine überzeugende Reaktion zu organisieren.
Deshalb: Raus aus der Wohlfühlzone, dem Szene-Kiez und dem vorgewärmten Nest, rein in den Austausch, die Diskussion, die reale Vorbereitung zum Losfahren und die konsequente Intervention in Kaltland!