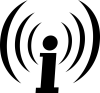Auf die Schulen kommt jetzt Großes zu: Sie müssen Hunderttausende Flüchtlingskinder integrieren. Wie soll das gehen?
Von Marina Kormbaki
Berlin. Drei Sprachlernklassen gibt es an der Grundschule von Schulleiter Holger Leimbach, alle drei sind mit je zwölf Schülern voll belegt. Auf einer Warteliste stehen zehn Namen, es könnten mehr werden - denn in der benachbarten Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Moabit treffen Tag für Tag Kinder mit ihren Eltern ein. Neue Kollegen unterrichten jetzt an der Schule, ältere buchen Fortbildungen, um zu lernen, wie sie Migrantenkindern am besten Deutsch beibringen. Kurzum: Von Routine kann eigentlich keine Rede sein an der Miriam-Makeba-Grundschule. Aber für Schulleiter Leimbach ist das kein Grund, nervös zu werden.
Ob die Flüchtlingskinder den Schulbetrieb vor Probleme stellen?
"Überhaupt nicht", sagt Holger Leimbach. Es klingt nach Tatkraft, nach
dem von der Kanzlerin vorgegebenen "Wir schaffen das"-Optimismus dieser
Tage. Und es klingt für manchen auch etwas blauäugig angesichts der
neuesten Berichte, nach denen die Regierung intern davon ausgeht, dass
in diesem Jahr nicht bis zu einer Million, sondern sogar bis zu 1,5
Millionen Flüchtlinge nach Deutschland kommen könnten.
Integration ist ein kühles, technokratisches Wort. Es verschleiert die
harte Arbeit, die Integration bedeutet. Zum Beispiel an Schulen. Viele
jener Menschen, die jetzt in Deutschland Schutz suchen, sind Kinder. Sie
können kein Deutsch, wurden seit Jahren nicht oder auch noch nie
unterrichtet, haben häufig Schlimmes erlitten. Sie stellen das
Schulwesen vor eine große Aufgabe.
Wie viel Aufwand und wie viel Geld nötig sein werden, damit diese Kinder
eines Tages ihren Platz in der Gesellschaft finden können, lässt sich
nur schwer abschätzen. Irgendwie aber muss man ja auf die neue Lage
reagieren, und deswegen hat Marlis Tepe, Vorsitzende der
Lehrergewerkschaft GEW, eine Rechnung aufgestellt: "Wir gehen für die
nächsten zwölf Monate von bundesweit rund 300000 zusätzlichen Schülern
aus, die allein oder mit ihren Eltern geflüchtet sind. Um diesen ein
qualitativ gutes Schulangebot zu machen, sind rund 25000 Lehrkräfte
zusätzlich notwendig." Tepe lobt die Bemühungen der Bundesländer, neue
Lehrerstellen zu schaffen. "Das Problem aber ist: Der Markt für Lehrer,
die Deutsch als Zweitsprache unterrichten, ist leer gefegt." Die
Gewerkschafterin plädiert für pragmatische Lösungen: "Es muss auch über
den Einsatz pensionierter Lehrkräfte mit der Qualifikation für Sprachen
und über Crashkurse im Unterrichten von Deutsch als Zweitsprache für
pädagogisch qualifizierte Menschen nachgedacht werden."
Flexibilität ist das Gebot der Stunde. Oder, wie es Stefan Kaufmann,
Obmann der Unionsfraktion im Bildungsausschuss des Bundestags,
ausdrückt: "Es sind jetzt unbürokratische Lösungen gefragt." Auch
Kaufmann wirbt dafür, die formellen Hürden für den Sprachunterricht
nicht wachsen zu lassen: "Neben Deutschkursen, für die qualifizierte
Lehrkräfte - aber nicht zwingend zwei Staatsexamina - benötigt werden,
braucht es Selbstlernprogramme." Und die Kosten? "Bei der Finanzierung
der Sprachkurse müssen die Kommunen durch Bund und Länder unterstützt
werden." Überhaupt sei mehr Zentralisierung nötig. "Ich bin
zuversichtlich, dass wir die große Herausforderung meistern werden -
wenngleich der Bildungsföderalismus hierbei sicherlich eher hinderlich
als förderlich ist."
Die vielen Bilder von Menschen, die jetzt ins Land kommen, erwecken den
Eindruck einer nie da gewesenen Ausnahmesituation. Aber Deutschland ist
ja nicht erst seit diesem Sommer Einwanderungsland. "Wir haben in der
Vergangenheit bereits vielfältige Erfahrungen gesammelt und Konzepte
entwickelt. Wir müssen jetzt das Rad nicht neu erfinden", sagt Prof.
Viola Georgi, Bildungsexpertin an der Uni Hildesheim. "Schon seit Langem
vermitteln wir Lehramtsstudenten eine Pädagogik, die kulturelle
Unterschiede und Mehrsprachigkeit von Schülern nicht mehr als Problem
betrachtet, wie es in früheren Jahrzehnten der Fall war."
In den Sechzigerjahren steckte man die Kinder der Gastarbeiter in die
"Ausländerklassen". Dort saßen sie ihre Schulzeit ab, getrennt von ihren
deutschen Mitschülern. Das Erlangen eines Schulabschlusses war nicht
wichtig. Die Gastarbeiterkinder würden ja bald wieder mit ihren Eltern
heimkehren in die Türkei, nach Griechenland oder Italien - so die
folgenschwere Annahme.
"In der Bildungspolitik der Vergangenheit wurden viele Fehler gemacht",
sagt Georgi. "Daraus haben wir inzwischen eine Menge gelernt." So lernen
die Kinder der Flüchtlinge, aber auch die der Einwanderer aus
EU-Staaten heute zunächst in "Willkommensklassen", "Integrationsklassen"
oder "Sprachlernklassen" - jedes Bundesland, jede Schule hat da ihre
eigene Bezeichnung. "Diese Klassen sind ein Schon- und Schutzraum für
die Kinder. Dort können sie langsam ankommen in ihrem neuen Alltag, sich
mit der neuen Sprache vertraut machen. Dass Kinder dort auf Kinder
treffen, die die gleiche Muttersprache sprechen, vermittelt ein Gefühl
von Vertrautheit und Geborgenheit." Wichtig ist allerdings, und das
betont die Forscherin Georgi, dass die Kinder möglichst schnell in
Regelklassen aufgenommen werden. Länger als sechs bis zwölf Monate solle
die Eingewöhnung in der Integrationsklasse nicht dauern. "Der Wechsel
kann auch schrittweise geschehen - zum Beispiel können Flüchtlingskinder
in Fächern wie Sport, Kunst und manchmal auch Mathematik recht schnell
in den Regelunterricht integriert werden."
Die Integrationsarbeit solle aber nicht allein Lehrern aufgebürdet
werden: "Es müssen mehr Psychologen, Sozialarbeiter und Dolmetscher in
die Schulen", sagt Georgi. Und noch etwas sei wichtig: die Stimmung im
Klassenraum, die Haltung im Kollegium. "Zurzeit ist in den Schulen sehr
viel guter Wille zu spüren", sagt Georgi.
Guter Wille - bei Schulleiter Holger Leimbach tritt diese Einstellung
als zupackender Pragmatismus in Erscheinung. Er mag nicht von
"Willkommensklassen" sprechen. "Willkommen ist bei uns jedes Kind", sagt
der Berliner. "Sprachlernklassen, so heißt das bei uns. Die Kinder
lernen halt die Sprache."