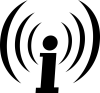Noch nie wirkten Deutschland und die Deutschen so weltoffen und freundlich wie heute. Woran liegt das? Wie lange wird das so bleiben?
Von Matthias Koch
In dieser Woche ergaben in Deutschland viele kleine Szenen ein großartiges Ganzes. Beispiel: München, Dienstag, Hauptbahnhof. Da nimmt ein bayerischer Polizist seine Dienstmütze ab, setzt sie einem Flüchtlingsjungen auf - und erntet ein anfangs vorsichtiges, dann immer befreiteres Lächeln eines Erdenbürgers, der soeben zum ersten Mal seine kleinen Füße auf deutschen Boden gesetzt hat.
Die Freundlichkeit der deutschen Stellen hat System. Schon als die
Flüchtlinge ausstiegen schlugen die Beamten ganz andere Töne an als die
grantigen Grenzer auf dem Balkan oder in Ungarn. "Sie sind nicht
verhaftet", betonten die deutschen Uniformierten auf Englisch. "Sie sind
willkommen." Eine junge Frau, die mit einem kranken Kind auf dem Arm
ausstieg, wurde beruhigt; sie solle sich keine Sorgen machen, draußen
vor dem Bahnhof warte auch ein Arzt. Und dann gab es die größte
Überraschung: Berge von Lebensmitteln, die viele Münchner
heranschleppten, dazu Spielzeug, Babynahrung und Windeln.
Deutschland ist anders, als viele dachten. Diese Entdeckung machten
Gäste aus aller Welt schon im Jahr 2006, in den sommerlich-sonnigen
Fußballweltmeisterschaftswochen, die als Sommermärchen in Erinnerung
blieben. Damals notierten etwa amerikanische Journalisten, so entspannt,
so menschlich, so freundlich hätten sie das Land, das einst Adolf
Hitler zujubelte, nie erlebt.
Jetzt folgt eine noch unglaublichere Geschichte: Deutschland weicht auch
im Moment der ernsten Belastung durch einen nie dagewesenen
Flüchtlingsstrom nicht ab von seinem Bemühen, die netteste Nation
Europas zu sein.
Zwar hat auch die Gewaltbereitschaft zündelnder Ausländerfeinde
gefährlich zugenommen. Jeden Tag, jede Nacht könnte eine Tragödie
geschehen. Doch die breite Mehrheit der Deutschen steht hinter der
Kanzlerin und der von ihr beschriebenen Linie der Hilfsbereitschaft.
Angela Merkels Ton ist ohne Pathos. "Deutschland tut, was moralisch und
rechtlich geboten ist. Nicht mehr und nicht weniger." So sprach die
Kanzlerin am Donnerstag in die Mikrofone der in- und ausländischen
Medienvertreter.
Bankenrettung, Fukushima und der Atomausstieg, Griechenland, jetzt die
Flüchtlinge: Merkel hat im Umgang mit Krisen Routine. Längst folgt sie
bei deren Bearbeitung einem Muster. Einmal mehr spricht sie jetzt von
einer "nationalen Aufgabe" - und verbittet sich damit, ohne es
auszusprechen, jeglichen Parteienstreit. Einmal mehr auch kündigt sie
an, binnen kurzer Zeit ungewöhnlich viele Neuregelungen gleichzeitig vom
Stapel zu lassen, etwa zur Entbürokratisierung der Flüchtlingshilfe.
Die Bundesländer werden, egal wer dort regiert, im Bundesrat am Ende
brav die Hand heben. Denn Merkel stellt im Gegenzug auch mehr Geld des
Bundes für Hilfen vor Ort zur Verfügung. "Package deals" dieser Art
produziert das Kanzleramt bei Bedarf en masse; die Große Koalition wirkt
dabei geräuschdämmend.
Am wichtigsten aber für die emotionale Lage der Nation war Merkels quer
durch die politischen Lager gelobter unaufgeregter Grundton: "Wir
schaffen das."
Solche Zuversicht ist derzeit europaweit einmalig. Ängstliche Dänen
wandten sich bei den jüngsten Wahlen massenhaft den Rechtsextremen zu.
Die Polen machten einen zugeknöpften Nationalisten zum neuen
Präsidenten. Ungarn versuchte diese Woche, Flüchtlinge auszutricksen und
in Lager zu transportieren, in die sie nicht wollten; erstmals seit
sehr langer Zeit fuhren wieder mit Menschen überfüllte Züge durch Europa
zu Zielen, die den Insassen verschwiegen wurden.
In dieser Düsternis wirkt, was derzeit in Deutschland geschieht, umso
lichtvoller. Bundespräsident Joachim Gauck hantierte jüngst mit einem
Gegensatzpaar, das schon den Historiker Sebastian Haffner in seinem 1940
zuerst auf Englisch erschienenen Buch beschäftigte: "Germany: Jekyll
& Hyde". Gauck fragte sich: Wird "Dunkeldeutschland" sich
durchsetzen oder das helle Land?
Derzeit, so scheint es, hat der böse Hyde im Bewusstsein der Deutschen
nicht viel zu melden. Ihre dunklen Seiten zeigen in Europa gerade die
anderen. Der konservative Londoner Außenminister Philip Hammond zum
Beispiel wurde jüngst düsterer denn je: Wenn erst "Millionen
marodierende Afrikaner" durch Europas Metropolen zögen, orakelte er, sei
es vorbei mit dem europäischen Wohlstandsniveau, wie man es seit
Generationen gewohnt sei.
In Frankreich hofft die rechtsextreme Marine Le Pen darauf, im Wahljahr
2017 als Gewinnerin dazustehen. Der Konservative Nicolas Sarkozy will
wie sie mit Abschottung Punkte sammeln. Einst empfahl er mit Blick auf
Kriminelle, man müsse Frankreichs Vorstädte "kärchern". In der Debatte
um eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik fällt er jetzt erneut
durch eine seltsame Wortwahl auf: Wenn das Abwasserrohr breche, müsse
man es abdichten, dozierte Sarkozy. "Da kann der Klempner nicht sagen:
Ich habe die Lösung - wir behalten die Hälfe in der Küche, tun ein
Viertel ins Wohnzimmer, ein Viertel ins Schlafzimmer, und wenn das nicht
reicht, bleibt noch das Kinderzimmer."
Stimmen dieser Art sind in Deutschland kaum zu hören. Und wenn doch,
dann nur aus politisch einflussarmen Parteien wie der AfD. Bei Infratest
dimap blieb die Partei diese Woche wie zuletzt unter der
Fünf-Prozent-Marke.
Wie lange aber wird das so bleiben? "Wir haben auch ein bisschen Glück
derzeit", heißt es in Führungskreisen der Großen Koalition. Man ahnt,
dass die derzeit erstaunlich stabile Stimmung im Laufe des Winters
kippen könnte: Was, wenn nun noch von Osten her Flüchtlinge kommen, weil
der Ukraine-Krieg wieder aufflammt? Droht dann irgendwann doch eine
Überforderung?
Noch wirken diverse Sonderfaktoren zugunsten von Offenheit und
Hilfsbereitschaft der Deutschen. Der Arbeitsmarkt hat einen höheren
Bedarf an Nachwuchs als in anderen EU-Staaten, nicht nur aus
konjunkturellen, sondern auch aus demografischen Gründen. Hinzu kommt:
Das Vertrauen der Bürger in die Politik ist hier größer, die
Feindseligkeit der Parteien untereinander geringer als anderswo. Sogar
Schwarze und Grüne, die noch vor wenigen Monaten die Flüchtlingspolitik
als Feld ihrer größten Differenzen markierten, nähern sich mittlerweile
an, wie ein diese Woche veröffentlichtes gemeinsames Papier von Jens
Spahn (CDU) und Boris Palmer (Grüne) zeigte. Die Union blickt
entspannter als früher auf mehr Einwanderung, die Grünen tauen auf für
den Gedanken, Bewerber aus sicheren Balkanstaaten fernzuhalten.
Viele Deutsche wundern sich über sich selbst angesichts eines
Wirgefühls, das die Nation überspannt wie ein leuchtender Regenbogen.
Ein neuer Nationalstolz ist spürbar, der ausgerechnet aus der
Relativierung des Nationalen seinen Kick bezieht. Diesen neuen Stolz der
Deutschen ließ Merkel anklingen, als sie diese Woche in aller
Bescheidenheit festhielt: "Die Welt sieht Deutschland als ein Land der
Hoffnung und der Chancen - das war nicht immer so."