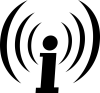Am Samstag, den 18. Juli, fand im Wild West in Mannheim die Diskussionsveranstaltung „Samstag Steine schmeißen und Montag wieder ab auf Arbeit? – Gipfelhopping, Alltagskämpfe, Selbstorganisation“ statt. Wir hatte eingeladen, um auszuloten, welche Möglichkeiten und Vorteile sowohl Event- und Gipfelproteste (wie die EZB-Blockaden in Frankfurt, EXPO-Gegenproteste in Italien, STOP-G7) als auch Alltagskämpfe (wie Mietenproteste, Action gegen Zwangsräumungen, Gentrifizierung, Abschiebungen und Repression) oder Selbstorganisation (wie der Aufbau sozialer Zentren) bieten.
Nachdem die Referenten Frederic Wester, Sprecher des Blockupy-Bündnisses, und Juan Miranda, Journalist (facebook.com/pages/Juan-Miranda/1390009717966684) und Ko-Autor des Textes „Wie die Welt verändern?“ (http://lowerclassmag.com/2015/01/wie-die-welt-veraendern/) in die Thematik eingeführt hatten, kam es zu einer lebhaften Publikumsdiskussion. In deren Verlauf kam man zu dem Fazit, dass es wichtig ist, beides zu kombinieren – sowohl Proteste gegen politische Events als auch Alltagskämpfe und Selbstorganisation. Dadurch können einerseits unterschiedliche Spektren und Gruppen miteinander vernetzt und langfristig handlungsfähige Strukturen geschaffen werden. Andererseits kann vor Ort durch Erfolge und durch die Einbeziehung von Betroffenen die Arbeit der Initiativen und Gruppen verankert und ausgebaut werden. Darüber hinaus berichteten viele der ca. 40 Gäste im Publikum von ihren konkreten Aktivitäten und Projekten. Alltagskämpfe und Ansätze von Selbstorganisation in Mannheim reichen demnach von solidarischen Interventionen bei Streiks, über Aktionen gegen das Tarifeinheitsgesetz oder die mörderische Asylpolitik, antifaschistische Kämpfe, Mietenproteste, VoKüs, selbstorganisierte Parties bis zu Feminist Action und mehr. Wie können diese Strukturen sinnvoll vernetzen und ausgebaut werden? Wo gibt es Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten für Vernetzung und vor allem für Praktisches? Woher nehmen wir uns die Zeit und den Raum für Analyse, Reflexion und konkrete gemeinsame Erfahrung? Diese Fragen wollen wir mit euch in der Fortsetzungs-Veranstaltung am kommenden Donnerstag, den 23. Juli, durchgehen. Dazu seid ihr natürlich wieder alle eingeladen! Kommt und diskutiert mit uns, der Frankfurter Gruppe „Antifa, Kritik und Klassenkampf“ (http://akkffm.blogsport.de/) und der FAU Mannheim über den „kommenden Aufprall“ beziehungsweise darüber, wie die Verschärfung der Krise aus radikal linker Perspektive genutzt werden kann, um sich besser zu organisieren und wirkungsmächtiger handeln zu können! Grundlage der Diskussion ist der Text „Der kommende Aufprall – Auf der Suche nach der Reißleine in Zeiten der Krise“ von der Gruppe „Antifa, Kritik und Klassenkampf“. Wenn ihr euch im Vorhinein schon mal einlesen wollt, findet ihr den Text auf Linksunten: https://linksunten.indymedia.org/de/node/139451 Wann? Donnerstag, 23. Juli 2015 um 20.15 Uhr Wo? Wild West, Alphornstraße 38, 68169 MA
Im Vorfeld der ersten Veranstaltung haben wir mit Frederic Wester und Juan Miranda kurze Interviews geführt. Diese wollen wir euch nicht enthalten:
Interview mit Frederic Wester
>>>Seit spätestens 2008 hat der kapitalistische Krisenprozess einiges in Bewegung gebracht. Die europäischen Regierungen reagierten darauf mit Kürzungen und umfassenden Angriffen auf die Lebensbedingungen der Lohnabhängigen. Während es vor allem in den ersten Krisenjahren in Südeuropa zu Streiks, Riots und vielfältigen Experimenten mit Selbstorganisation kam, setzt die Linke in der BRD vor allem auf Eventmobilisierung. Am Anfang standen die eher von linken GewerkschafterInnen getragenen "Wir zahlen nicht für eure Krise Proteste", über M31 bis hin zu Blockupy. Zugespitzt könnte man formulieren, die Linke in der BRD macht halt einmal im Jahr ne Krisendemo. Wo siehst du Chancen und Grenzen dieser Proteste?
Frederic Wester: Dass die Linke in der BRD vor allem auf
Eventmobilisierung gesetzt hätte ist höchstens zur Hälfte richtig. Denn
die Dynamik sozialer Bewegungen kann man sich leider nicht aussuchen,
sie hängt viel mehr vom Bewusstsein der Leute und der gesellschaftlichen
Dynamik ab, als es das abstrakte Reden über „die richtige Aktionsform“
nahelegt. Die meisten Linken hier hätten sicherlich auch gerne „Streiks,
Riots und vielfältige Experimente der Selbstorganisierung“ gehabt – und
einige praktische Versuche gab es in diese Richtung ja auch, zum
Beispiel in den Bereichen „Recht auf Stadt“, „sozialen Rechte“ oder
„Flüchtlingskämpfe“ und sogar auf gewerkschaftlicher Ebene. Allerdings
ist die gesellschaftliche Situation hier eine ganz andere als in
Griechenland: Zwei Drittel dieser Gesellschaft sehen ihre Interessen –
egal ob das nun nur nationalistische Ideologie ist oder auch einen
polit-ökonomischen Kern hat – von der aktuellen Bundesregierung gut
vertreten, die großen Gewerkschaften sichern das deutsche Exportmodell
ab und nehmen seine Kollateralschäden hier und anderswo billigend in
Kauf (und die meisten Medien spielen natürlich auch mit). Vor dem
Hintergrund waren die „Eventmobilisierung“ der richtige Versuch, die
Perspektive der 20 %, die bei diesem Krisenregime nicht mitmachen können
oder wollen, öffentlichkeitswirksam deutlich zu machen und ein Spektren
wie Grenzen übergreifendes Gegenprojekt zu entwickeln. Darin hatten
diese Proteste ihre Notwendigkeit und Erfolge, aber natürlich auch ihre
Schranken.
Das gilt allerdings auch andersherum: die berühmten
Alltagskämpfe und eine soziale Verbreiterung der Linken in diesem Land
sind notwendig, aber ebenfalls begrenzt. Denn aus sich selbst heraus,
weisen soziale Kämpfe im Kapitalismus eben nicht über sich selbst
hinaus. Vielmehr bleiben sie partikulare Interesse, die sich allzu
schnell gegeneinander ausspielen lassen. Ohne ein übergreifendes Projekt
gegen die Ordnung, in dem sich die Interessens- und Identitätskonflikte
ja überhaupt erst immer wieder strukturelle ergeben, die dann
radikalisiert werden sollen, mutiert Organisierung im Alltag zu
Sozialarbeit, Ehrenamt in Bürgerinitiativen oder Schlimmerem. Denn für
mehr Lohn zu streiken und trotzdem die Knute gegen Griechenland zu
fordern ist in diesem Land kein Widerspruch. Früher nannte das mal
jemand das Problem des tradeunionistischen Bewusstseins. Das Problem hat
auch eine sozialpsychologische Dimension: Wer will schon von sich
selbst ständig als „Mieter“ oder „Arbeitsloser“ denken und bereits die
Aufgabe, den Orgabetrieb eines sozialen Zentrums aufrecht zu erhalten
wird schnell zur unbezahlten Nebentätigkeit. Das könnte auch erklären,
warum alle von Alltagskämpfen reden aber kaum einer sie selber
langfristig „führt“.
>>>Die GenossInnen der Autonomen Antifa aus Frankfurt haben 2013 in ihren Auswertung zu den damaligen Aktionstagen geschrieben: "Der Event ist nur so gut, wie auch die Ausweitung antikapitalistischer Bewegung in Alltagskämpfen hinein gelingt. Blockupy war insofern ein Punkt von dem aus es jetzt weiter gehen kann – aber auch weitergehen muss. Die nächste Großmobilisierung zur EZB-Eröffnung 2014 wird nur dann mehr als eine Wiederholung sein, wenn sie zum Kristallisationspunkt einer breiten Bewegung von international vernetzten und lokal verankerten Initiativen wird." Welche Bilanz ziehst du zwei Jahre später?
Frederic Wester: Es ist mit Blockupy tatsächlich gelungen die transnationale Vernetzung weiter zu treiben und durch die Zusammenarbeit über Spektrengrenzen sogar hinweg einen einigermaßen stabilen und zugleich antagonistischen Akteur zu etablieren. Das hat einen Anteil an der Politisierung und Polarisierung der Krisendebatte auch hierzulande – und ist genau das, was die Entpolitisierungskultur unter Merkel und Gabriel ja eigentlich verhindern will. Das ist in der desolaten Lage der Linken im Herzen des Krisenregimes schon mal etwas und kann sich in Zukunft noch als nützlich erweisen. Zudem haben eine Menge Leute damit Erfahrungen gesammelt, was gemeinsam möglich ist und sich kennen gelernt – auch das ist eine Menge wert. Die pädagogische Bedeutung der Erfahrung, dass auch die andere Seite mal im Rückwärtsgang sein kann, sollte man nicht unterschätzen. Daher war die Blockupy-Mobilisierungen insgesamt auch deutlich mehr als nur die Wiederholung des Immer Gleichen. Aber: Wie die letzten Wochen gezeigt haben ist hier es bisher nicht gelungen, den Diskurs in der Mehrheitsgesellschaft entscheidend zu verändern und hier zu einem politischen oder gar sozialen Faktor zu werden. Mir scheint das aber auch eher ein Punkt der jetzt ansteht, als etwas, das realistischer Weise vorher schon drinne gewesen wäre. Denn die unheimliche Stabilität der Deutschland AG beruht ja gerade auf der partiellen Einbindung von fortschrittlichen Menschen in Bewegungen, Parteien, Verbänden und Gewerkschaften. Die muss auf verschiedenen Ebenen gekappt werden. Denn bevor man in einer so hochgradig ausdifferenzierten Gesellschaft überhaupt mehr werden kann, braucht es auf den unterschiedliche Ebenen erstmal wieder ein mehrheitsfähiges und zugleich antagonistisches Angebot. Was jetzt nötig wäre, sind also weder Phantasien über rot-rot-grüne Regierungsmehrheiten noch der Rückzug in die autonome Subkultur, sondern die Bildung eines oppositionellen Lagers gegenüber dem hegemonialen Modell des Standort Deutschland. Das Kunststück besteht also darin, gleichzeitig mehr und radikaler zu werden. Denn auf absehbare Zeit werden wir in diesem Land zwar nicht die Mehrheit stellen. Das entbindet aber nicht von der Aufgabe, mit den 20% Unzufriedenen und ausgeschlossenen eine tatsächliche Opposition zu organisieren. Von da aus könnte man dann schließlich weiter machen. Gleichzeitig wird man mit einer Anbiederung an die Mitte, diese nicht dazu bringen ihr bisheriges Mitmachen im Schweinesystem wirklich in Frage zu stellen.
Die gute Nachricht bei dieser einigermaßen komplizierten Ausgangslage ist übrigens: Da die Auseinandersetzung in Europa heute ohnehin nur noch im transnationalen Rahmen gedacht werden kann, könnte sich die Frage von Mehrheit und Minderheit schneller relativieren, als man denkt.
>>>Die Blockupy-Aktionstage und M18 haben im März dieses Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Dafür haben viele AktivistInnen sowohl viel Zeit reingesteckt als auch einiges riskiert. Diese Events stellen für Aktive ermächtigende und kollektive Ausnahmesituationen dar, in denen viele Erfahrungen gemacht werden. Danach gehts aber wieder zurück in den Alltag mit Job, Uni oder Amt und die Leute sind wieder auf sich gestellt. Wie siehst du vor diesem Hintergrund die Effekte dieser "Events" und das Spannungsfeld von Ermächtigung und Frustration?
Frederic Wester: Es ist genau das
Spannungsfeld auf das es ankommt und in dem man sich organisieren muss.
Denn wie gesagt: Nur das eine (massenhaft auf die Straße gehen) oder nur
das andere zu machen (im Alltag organisieren) ist nicht drin, wenn man
das Ziel gesellschaftlicher Veränderung nicht zugunsten einer einfache
aber langweiligen Identitätspolitik aufgeben möchte.
Deswegen
artikuliert die alte Unart der deutschen Linken immer „den einen“
richtigen Weg zu suchen, die ihren neusten Ausdruck in dem Fehler
findet, die falsche Alternative aufzumachen, man könne entweder
öffentliche Mobilisierungen des politischen Widerspruchs organisieren
oder eine soziale Verankerung der Linken im Alltag betreiben, einen
Mangel an strategischem Denken. Dieses Baukasten-Denken ist ein Beispiel
dafür, was Johannes Agnoli in seiner von Kant geklauten Definition der
Dummheit mal die „Fassungslosigkeit des Denkens vor der Wirklichkeit“
genannt hat. Das gilt übrigens genauso für die – diplomatisch formuliert
– etwas platte Debatte nach der vorläufigen Niederlage der
Syriza-Regierung gegenüber der deutschen Erpressung. Die Vorstellung man
könne nun entweder „Unterwerfung“ oder „Grexit“, entweder den „Tod des
Reformismus“ oder die grüne Logik des „kleineren Übels“ postulieren,
geht am Problem (und der Chance) der Ungleichzeitigkeit und
Prozesshaftigkeit im heutigen Kapitalismus vorbei. Weder kann man heute
so tun, als wäre eine hochgradig komplexe, arbeitsteilig und
transnationale organisierte Gesellschaft einfach von heute auf Morgen in
Selbstorganisation zu überführen und die Kämpfe im Staatsapparat seien
daher egal, noch kann Veränderung heute in einer nationalstaatlichen
Perspektive gedacht werden. Zumindest wenn man nicht die nächsten zwei
Jahre nur von Oliven, Käse und den Medikamenten aus Hilfspaketen leben
möchte. Jenseits des plakativen Blablas, also in der konkreten
Bestimmung welche Mobilisierung und welche Organisierung im Alltag jetzt
gerade nötig ist, fängt es also erst an interessant zu werden.
Es wäre schon einiges gewonnen, wenn sich die gesellschaftliche Linke in diesem Land ihre eigene Machtlosigkeit nicht mehr immer wieder dadurch rationalisieren würde, dass sie Schattenboxen betreibt und die Spaltung gegenüber den jeweiligen anderen Linken sucht. Das meint nicht die Ideen einer konfliktfreien politischen Familie. Im Gegenteil: Es geht heute um das Primat der praktischen Initiative gegenüber den häufig so erbittert ausgetragenen wie ungefährlichen Kämpfen um „den“ richtigen Weg – den dann immer irgendwer anders gehen soll.
>>>Vielen Dank für das Interview.
Interview mit Juan Miranda
*Hallo Juan, du hast mit John Mallory Anfang 2015 den Text "Wie die Welt verändern?" veröffentlicht. Darin setzt ihr euch umfangreich mit der kapitalistischen Krise und sozialen Kämpfen auseinander. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen beiden?
Menschen kämpfen nicht weil sie biologisch so veranlagt sind, sondern weil die Verhältnisse sie dazu zwingen. Weil sie ihre Bedürfnisse und Interessen anders nicht durchsetzen können. Grundlage für soziale Kämpfe ist die Existenz sozialer Konfliktlinien. Der Kapitalismus produziert diese Konfliktlinien am laufenden Band. Das heißt nicht automatisch, dass sich soziale Konflikte zu sozialen Kämpfen auswachsen oder dass sie die gesellschaftliche Ordnung in Frage stellen.Damit das passiert, müssen die Beteiligten den Eindruck haben, dass sie ihren Interessen innerhalb der existierenden Ordnung keine Geltung verschaffen können. Außerdem braucht es etwas, für das zu kämpfen es sich lohnt - etwas das verspricht den eigenen Interessen besser Geltung zu verschaffen.Kapitalistische Krisen sind also nicht Ursache sozialer Kämpfe,sie wirkt aber als Katalysator dafür, dass sich bestehende Konflikte weiter zuspitzen und zu sozialen Kämpfen eskalieren.
*Wieso ist die Krise ein Katalysator für soziale Kämpfe?
Wirtschaftliche Krisen verschärfen zum einen unmittelbar die soziale Lage, weil Menschen entlassen oder Löhne gekürzt werden. Wenn dazu staatliche Versuche kommen, die Kapitalrentabilität zu steigern, indem die Kosten auf die Mehrheit abgewälzt werden - wie in den vergangenen Jahren in Südeuropa - verschärft das die sozialen Konflikte weiter.Hinzu kommt ein Vertrauensverlust in die kapitalistische Ökonomie und in die Problemlösekompetenz des politischen Betriebs. Bei Menschen, denen Leistungen gekürzt werden, die ihren Job verlieren oder jetzt ohne Krankenversicherung für Hungerlöhne arbeiten müssen, während Banken mit Milliarden gerettet werden, geht der unerschütterliche Glaube an die Segnungen des freien Marktes und die politischen Institutionen verloren - insbesondere dann, wenn dies massenhaft in kurzer Zeit geschieht. Sie schauen sich - wie in Spanien und Griechenland - nach anderen Möglichkeiten um, um ihr Leben besser zu gestalten.
*Deutschland gilt vielen als Krisengewinner. Ihr argumentiert, dass
die deutsche Friedhofsruhe nicht ewig halten wird und auch in
Deutschland in den nächsten Jahren mit Kriseneinbrüchen und Angriffen auf soziale Standards zu rechnen ist. Warum?
Die "Deutschland AG", wie der Kapitalstandort gerne von der Wirtschaftspresse genannt wird, ist bisher tatsächlich Gewinnerin der Krise. Und gewissermaßen auch ihre politischen Vertreter, allen voran die Bundesregierung. Davon können sich Hartz IV-Empfänger*innen, Leiharbeiter*innen oder illegalisierte Arbeitsmigrant*innen allerdings nicht viel kaufen.Dass seit 2012 in einigen Branchen deutliche reale Lohnerhöhungen durchgesetzt werden konnten, sollte nicht täuschen. Die Lohnstückkosten sind in Deutschland zwischen 2000 und 2013 nur halb so schnell gestiegen wie im Durchschnitt im Euroraum. Und bis zur Einführung des Mindestlohns von 8,50 Euro arbeitete jede*r fünfte Beschäftige in Deutschland zu Niedriglöhnen - das ist auch im europäischen Vergleich ein hoher Wert. Dass die Situation in Deutschland von vielen als gut empfunden wird, hat sicher auch den Grund, dass es in Griechenland und Spanien derzeit noch deutlich schlechter ist und dass die Zumutungen der Agenda 2010 mittlerweile als gegeben angenommen werden.
Anders als in Großbritannien, finden hierzulande derzeit auch keine weiteren sozialen Kürzungen statt. Der soziale Friede scheint dem deutschen Kapital angesichts der guten Gewinne derzeit mehr wert zu sein, als ein bisschen Extraprofit. Es gibt aber auch andere Tendenzen.So nimmt in einigen Berufsgruppen mit herausgehobener Stellung, aber auch im Dienstleistungssektor die Konfliktfreudigkeit bei Arbeitskämpfen zu. Das ist gut, denn in solchen Auseinandersetzungen werden wichtige Erfahrungen gemacht, die in den kommenden sozialen Kämpfen dringend gebraucht werden. Und die werden kommen!Was wir in Deutschland derzeit erleben ist die Ruhe im Auge des Orkans. Und wie bei diesem Wetterphänomen ist diese Ruhe, die in Deutschland derzeit herrscht, trügerisch. Sie wird schneller vorbei sein, als das die Mehrheit der Bevölkerung hierzulande wahrhaben will. Die nächsten Kürzungen oder Kriseneinbrüche werden nicht allzu lange auf sich warten lassen.
*Warum bist du dir so sicher, dass es auch hierzulande wieder schlimmer wird?
Weil die Herrschenden die Dynamik weiter befeuern, die zu Bankenkrise, Staatsschulden und sozialen Verwerfungen geführt hat. John Malamatinas hat Griechenland bereits 2011 treffend als Krisenlabor für den europäischen Kapitalstandort beschrieben.Dort wird derzeit ausprobiert, wie viel man aus den Menschen herauspressen kann, um den Kapitalprofit in Europa weiter zu steigern. In der globalen Konkurrenz der Wirtschaftsstandorte und Machtblöcke, die sich nach dem Ende des Kalten Kriegs herausgebildet hat, reicht es nicht, dass Profit gemacht wird.Der Profit muss größer sein als an anderen möglichen Standorten. Größer als in den USA, als in China oder im Falle der Textilindustrie als in Kambodscha. Das Modell, das den Verantwortlichen in der EU und in der Bundesregierung vorschwebt, ist ein Machtblock Europa, der sich ökonomisch gegen die Mitkonkurrenten aus aller Welt durchsetzen kann. Das ist nicht ohne Angriffe auf unsere Lebensbedingungen in weiteren Ländern und schließlich auch in Deutschland zu haben. Spätestens dann, wenn Spanien oder Griechenland es schaffen dem Kapital günstigere Bedingungen zu bieten als Deutschland. Zur dieser Unterbietungsspirale kommt die Gefahr weitererKriseneinbrüche hinzu. Auch nach der Bankenkrise hat sich am kapitalistischen Entwicklungsmodell nichts geändert. Weiterhin werden die größten Teile des angehäuften Geldes in Finanzprodukte und Immobilien gesteckt, weil dort höhere Gewinne zu erwarten sind. Der deutsche Aktienindex hat kürzlich ein neues Rekordhoch erreicht, Immobilien in Großstädten werden immer mehr zu Geldanlagen, der deutsche Außenhandelsüberschuss ist größer denn je und mit TTIP und CETA sollen die nächste Freihandelszone ohne soziale Ausgleichsmechanismen geschaffen werden.Mit anderen Worten: Das Problem ist nicht nur nicht behoben, die Fallhöhe hat sich sogar nochmals deutlich erhöht.
*Was glaubst du erwartet uns in den nächsten Jahren an sozialen Auseinandersetzungen in Deutschland?
Es ist ja nicht so, dass es in Deutschland derzeit keine sozialen Auseinandersetzungen gäbe. Der Kampf um bezahlbaren Wohnraum und das Leben in den Städten, aber auch die Kämpfe illegalisierter Flüchtlinge sind zwei Beispiele. Die bereits erwähnten Arbeitskämpfe in Bereichen, in denen bisher kaum gestreikt wurde, sind eine weitere interessante Entwicklung. Diese Kämpfe kochen wegen der allgemeinen politische Friedhofsruhe noch nicht so hoch wie sie könnten. Sollte jedoch die deutsche Exportwirtschaft in Absatzschwierigkeiten kommen und Leiharbeiter*innen entlassen werden, dann werden sich diese Konflikte wahrscheinlich zuspitzen. Nicht zu sprechen davon, was bevorsteht, wenn der nächste europäische oder globale Crash kommt.
Das hätte massive Auswirkungen auf die ärmeren Teile der Bevölkerung, aber auch auf die Mittelschicht. Dass in diesem Fall mit einer massiven Zunahme von offenem Rassismus und Sozialchauvinismus zu rechnen ist, deuten die Erfolge von AfD und Pegida schon an.
*Wie sollte sich die radikale Linke deiner Meinung nach für kommende soziale Auseinandersetzungen vorbereiten?
Die außerparlamentarische Linke und erst recht die radikale Linke ist gesellschaftlich - zumindest außerhalb von Rojava - äußerst marginal und oft isoliert. Deshalb sollte man keine Illusionen haben, was die Veränderungskraft der existierenden Linken betrifft. Wenn die radikale Linke in den künftigen Kämpfen eine Rolle spielen möchte und einen Beitrag dazu leisten will, dass nach dem Kapitalismus nicht Mad Max, sondern etwas besseres kommt, dann muss sie sich ändern. John Mallory und ich schlagen deshalb in unserem Text "Wie die Welt verändern?" eine drei-Ebenen-Strategie vor.
Erstens: Das prozesshafte Herausarbeiten einer linken gesellschaftlichen Vision.
Zweitens: Selbstorganisation und kollektive Organisierung, nicht als Nischenpolitik sondern als Breschen gegen den kapitalistischen Alltag.
Drittens: Eine offensive Auseinandersetzung mit rechten Krisenakteuren und ihren gesellschaftlichen Ursachen.
Eine gesellschaftliche Vision ist uns wichtig, weil es ohne eine Idee von einer besseren Gesellschaft nichts gibt wofür es sich zu kämpfen lohnt. Eine Vision muss deshalb mehr sein als eine in antikapitalistischen Zirkeln kursierende Vorstellung vom Kommunismus oder Anarchismus. Es wird neue Begriffe brauchen, die sich in sozialen Kämpfen etablieren müssen. Gleichzeitig braucht es aber konkrete Handlungsoptionen, die kurzfristig umsetzbar sind und in deren Umsetzung sich Stärke, Organisierungserfahrung und Bewusstsein entwickeln. Wir brauchen eine alltägliche Selbstorganisierung über Szenegrenzen hinweg. Also solidarische Strukturen, die es ermöglichen über den kapitalistischen Überlebenskampf hinaus an dessen Überwindung zu arbeiten.
Die Idee ist: Was wir jenseits kapitalistischer Logik organisieren können, organisieren wir. Und wir beziehen diejenigen mit ein, die gewillt sind, sich solidarisch nach den gleichen Prinzipien mit uns zu organisieren. Hier sehe ich eine besonders große Leerstelle in der deutschen Linken.
Dabei ist es wichtig, autoritären Tendenzen und Bewegungen klar und offen entgegenzutreten. Um das erfolgreich tun zu können, ist es wichtig, sich nicht als Verteidiger der falschen Ordnung zu gerieren. Wenn wir verhindern wollen, dass sich Rechte in sozialen Kämpfen profilieren und festsetzen, müssen wir uns selbst mit eigenen Positionen und Selbstorganisierungsangeboten an diesen Kämpfen beteiligen.
*Während viele Linke in Deutschland, inspiriert von Syriza und
Podemos, mit der Linkspartei liebäugeln, bezeichnet ihr dies als
"Sackgasse" und argumentiert für Selbstorganisation und Basiskämpfe. Warum?
Mir ist es immer wieder ein Rätsel, wieso Menschen, die sich als Kommunist*innen oder Linksradikale bezeichnen mit Parteien liebäugeln. Parteien sind zur Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse denkbar ungeeignet, beziehen sie ihre gesamte Macht doch aus den Institutionen des Staates, der letztlich für nichts anderes, als für den reibungslosen Ablauf der Kapitalverwertung gut ist. Was passiert, wenn man versucht die Gesellschaft über den Staat zu verändern lässt sich am Staatssozialismus genauso studieren, wie an der SPD oder den Grünen.
Als Syriza, zusammen mit Anel im Januar die griechische Regierung übernahm, war der Jubel in Teilen der deutschen Linken groß. Viele verlautbarten öffentlich, jetzt werde endlich jemand der Troika und der Bundesregierung die Stirn bieten. Damals habe ich in einem Artikel im "Neuen Deutschland" geschrieben, dass nicht zu erwarten ist, dass Syriza relevante Verbesserungen durchsetzen kann, ohne die soziale Situation der Menschen noch weiter zu verschärfen. Derzeit scheint sich diese Prognose noch härter zu bestätigen, als ich mir das damals vorstellen konnte. Nicht einmal die Tatsache, dass Syriza fast alle seine Wahlversprechen gebrochen hat, hat die Gläubiger bewegt einzulenken. Vorherzusagen, dass Syriza mit seinem Programm scheitert, war jedoch keine besondere prognostische Leistung meinerseits. Im Gegenteil: es erfordert schon einiges an Zuversicht und blindem Glauben, um anzunehmen, dass sich ein im Kern sozialdemokratisches Programm, wie das von Syriza heute durch eine Regierungsübernahme verwirklichen ließe.
Dagegen sprechen sowohl die Funktionsweise der finanzialisierten Ökonomie mit ihren globalen Produktionsstrukturen und dem alles bestimmenden Standortwettbewerb, wie auch die politischen Strukturen und Mehrheitsverhältnisse in der EU.
Statt darauf zu hoffen, das Syriza es schon richten wird, sollte die Linke die wahrscheinlich kurze Regierungszeit dazu nutzen, offensiv ihre eigenen Strukturen zu stärken.
* Vielen Dank für das Interview! Wir freuen uns schon darauf, wenn wir dich am 18.07. in Mannheim begrüßen dürfen!