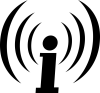Wegschauen. Verdrängen. Versagen. Auch nach der Festnahme einer mutmaßlichen rechten Terrorgruppe ist der Hass in Freital nicht verschwunden. Im Gegenteil.
von Sebastian Leber
Zunächst einmal: Hier gibt es keine Nazis. Jedenfalls nicht viele. Und Terroristen schon gar nicht. Das könne er garantieren, sagt Mock, aber zu 100 Prozent. Man will es ihm glauben. Das gewinnende Lächeln, der Bierbauchansatz, das Piercing in der Augenbraue als modischer Kontrast zu den Geheimratsecken. Dieser Typ kann nicht verkehrt sein. Außerdem ist Mock hier geboren und betreibt eine der beliebtesten Kneipen Freitals. Sie liegt an der Hauptstraße unweit einer Discounterfiliale. Er steht hinterm Holztresen und bietet eine Zigarette an, Benson & Hedges, hat er drüben in Tschechien gekauft. Unter der Voraussetzung, dass weder sein bürgerlicher Name noch der seiner Gaststätte in der Zeitung auftauchen, ist Mock bereit, so einiges über Freital klarzustellen.
Denn da wurde ja viel Schlimmes berichtet über die 40 000-Einwohner-Stadt, zehn Bahnminuten südlich von Dresden. Die massiven Proteste gegen die Asylunterkunft „Leonardo“, die früher ein Hotel war. Sprengstoffanschläge auf Flüchtlinge und Linke. Vergangenen Dienstag dann die Festnahme von fünf Freitalern, die Teil einer Terrorgruppe sein sollen.
Absolut lächerlich, findet Mock. Diese Leute seien keine Gewalttäter, höchstens welche, die es etwas übertrieben und Mist gebaut hätten. Ob er sie kenne? „Nu“, antwortet Mock. So sagt man hier, wenn man „ja“ meint. „Ich bin sicher, die wollten mit ihren Böllern Flüchtlinge erschrecken, aber doch nicht verletzen.“ Dann sagt er noch: „Die sind ganz normal.“
Sollte Mock mit diesem Satz tatsächlich recht haben, wäre die Frage: Was bedeutet es in Freital, ganz normal zu sein?
Unter den sächsischen Städten und Dörfern, die seit Frühsommer 2015 durch fremdenfeindliche Proteste auffielen, gehört Freital zu denjenigen, in denen sich der Hass am offenkundigsten materialisierte. Bei Demonstrationen vor dem Heim wurde immer wieder der Hitlergruß gezeigt. Bei einer Straßenumfrage der Lokalzeitung sagte eine Anwohnerin, die steineschmeißenden Rechten seien nicht gefährlich, denn sie würden ja keine Deutschen bewerfen.
Gar nicht fremdenfeindlich?
Die Bürger Freitals, behauptet Kneipeninhaber Mock, seien in großer Mehrheit nicht fremdenfeindlich, sie hätten schlicht Beobachtungen gemacht. Zum Beispiel, dass in den Supermärkten deutlich mehr geklaut werde, seit hier Flüchtlinge lebten. Oder dass Nordafrikaner abends um elf an der Tankstelle Chipstüten kauften, obwohl diese doppelt so teuer seien wie tagsüber bei Aldi. Oder dass in der Hauptpost an der Dresdner Straße ständig Ausländer anstünden, die Geld, das sie vom deutschen Staat bekämen, an ihre Verwandten in der Heimat schickten. „Ich will sie dafür nicht verurteilen“, sagt Mock. „Das steckt einfach in ihrer Kultur.“
In der Kneipe sitzt ein kahl geschorener Mann. Er sagt, er sei nicht rechts, es handele sich bloß um eine Frisur. Was ihn aber wundere: „Warum kommen die ganzen Syrer hierher, haben die denn zu Hause keine Armee, die sie beschützt?“ Mock nickt. Man stelle sich vor, sagt er, die deutschen Männer seien damals im Krieg alle geflohen, anstatt für ihr Vaterland zu kämpfen, das wäre doch in einer Katastrophe geendet. Kurze Pause. Nein, er merkt es nicht.
Die Initialen N.S. sind überall
Wer durch die Tür von Mocks Kneipe auf die Straße tritt, blickt auf ein Graffito: „No Asyl“. Der Slogan ist im Stadtbild seit Wochen allgegenwärtig, ebenso „Kein Heim“, meist in Verbindung mit den Initialen „N.S.“. Sie finden sich dutzendfach an Häuserwänden, Stromkästen, Parkbänken, Kirchenfassaden. Bei der Stadtverwaltung heißt es, die Schmierereien seien nicht umgehend entfernt worden, da es sich nicht um verfassungsfeindliche Inhalte handele. Kürzlich wollte ein privater Träger gemeinsam mit Flüchtlingen einzelne Graffiti übermalen. Die Gruppe wurde so massiv von Passanten bedrängt, dass sie ihren Versuch abbrechen musste.
Bedroht wird, wer es wagt, offen für Nichtdeutsche Partei zu ergreifen. Die grüne Stadträtin erhielt über Monate anonyme Anrufe, sie und ihre Neger würden alle erschossen, sagte die Stimme einmal. Im Internet wurde ihre Wohnanschrift veröffentlicht. Dem Fraktionschef der Linken haben sie Sprengstoff ins Auto gelegt. Totalschaden. Die Namen beider Politiker standen auf einer sogenannten „To-do-Liste“, die Unbekannte an die Fensterfront des örtlichen Linken-Büros klebten. Die Scheiben sind mehrfach eingeschlagen worden.
Einer der Sprengstoffanschläge, die jetzt den mutmaßlichen Terroristen zur Last gelegt werden, fand vergangenen September in der Bahnhofstraße statt. In einem Mehrfamilienhaus sind dort ebenerdig 14 Flüchtlinge aus Eritrea untergebracht. Das Fenster, das bei der Explosion zerstört wurde, ist heute noch kaputt. Darunter wieder: „N.S.“ Die Bewohner sagen, sie trauten sich abends nicht aus dem Haus. Allerdings bekämen sie fast täglich Besuch von Jugendlichen. Die riefen Beleidigungen und oft auch „We kill you“, neulich trat jemand die Vordertür ein. Einer der Flüchtlinge sagt, er sei vergangenen Sommer nach Deutschland eingereist und zunächst in München gelandet. Dort hätten ihm Menschen zugewunken. Deute in Freital eine fremde Hand in seine Richtung, sei es entweder die geballte Faust oder der ausgestreckte Mittelfinger. „Wir haben gehofft, es würde besser“, sagt der junge Mann. Aber es wurde nicht besser. Vorige Woche standen abends Maskierte im Eingang. Sie sprühten seinem Mitbewohner CS-Gas in die Augen.
Hat die Polizei geschlafen?
Die nun festgenommene mutmaßliche Terrorgruppe ist spätestens seit dem Anschlag in der Bahnhofstraße von der Polizei überwacht worden. Einiges spricht dafür, dass weitere Sprengstoffattacken hätten verhindert werden können. Warum dies nicht geschah, ob womöglich gar ein Polizeibeamter der Gruppe nahestand, prüfen jetzt die Ermittler.
Rechtes Gedankengut hat in Freital eine lange Tradition. Bevor die NPD in Dresden ihr Landtagsbüro eröffnete, operierte sie von Freital aus. Der Rockerklub Gremium MC, deren Mitglieder zwar auch anderswo in Deutschland durch Straftaten auffallen, aber selten durch politische Einstellungen, bestand hier jahrelang aus Rechtsextremen. Pegida-Gründer Lutz Bachmann hält sich häufig in Freital auf, hat hier etliche Freunde. Das Foto, auf dem er als Hitler posierte, entstand in einem Freitaler Friseursalon. Viele Pediga-Unterstützer der ersten Stunde kommen aus der Stadt.
Warum Freital? Experten führen Gründe an, die man so oder ähnlich schon von anderen Gegenden mit Naziproblem kennt. Die Deindustrialisierung der Region nach der Wende. Der Wegzug junger Menschen mit hohem Bildungsgrad, vor allem weiblicher. Die Lage in der Peripherie. Das Gefühl von Abgehängtheit. Die Suche nach einer Identität. Aber kann das alles sein?
Im Freitaler Stadtrat kommt es gelegentlich zu Kooperationen, die in anderen Gemeindevertretungen undenkbar wären. Abgeordnete der CDU und AfD haben Geschäftsordnungsanträge der NPD durchgewunken. In Pausen wird zusammen geraucht. Auf den Vorschlag des NPD-Stadtrats, Flüchtlingen den Besuch von Spielplätzen zu verbieten, entgegnete ein ranghoher Christdemokrat lediglich, dies sei juristisch schwer umzusetzen. Ein anderer sagte, die Unterbringung von Flüchtlingen in Turnhallen könne keine „Endlösung“ darstellen. Später rechtfertigte er sich damit, das Wort stehe im Duden.
Der Oberbürgermeister schaut weg
Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg ist ebenfalls von der CDU. Für ein Interview hat er keine Zeit, schriftlich lässt er ausrichten, es gebe in Freital keine nennenswerte Neonaziszene. Und dass er auch dunkelhäutigen Touristen einen Besuch seiner Stadt empfehlen könne.
Menschen, die sich in Freital gegen Rechtsextremismus engagieren, halten das für aberwitzig. Es sind Menschen wie die Kellnerin Steffi Brachtel, 41. Sie gehört keiner Partei an, bis vor anderthalb Jahren interessierte sie sich wenig für Politik. Dann veröffentlichte ein Freund auf Facebook einen Witz, der ging so: „Warum gibt es bei Star Trek keine Moslems? Weil Star Trek in der Zukunft spielt.“ Steffi Brachtel schrieb darunter, dass dies nicht lustig sei, und wurde reihenweise als Hure und linke Zecke beschimpft. Da ahnte Brachtel, dass sie künftig den Mund halten muss oder es schwer haben wird.
Mit ein paar anderen gründete sie eine Ehrenamtlichengruppe namens „Organisation für Weltoffenheit und Toleranz“. Seitdem haben sich Freunde, Bekannte und Nachbarn von ihr abgewandt. Die Mutter einer Mitschülerin ihres Sohnes zischte sie an der Bushaltestelle an: „Du bist doch für die aus dem Heim.“
Der Riss geht mitten durch Freitaler Familien. Bei Steffi Brachtel ist es der jüngere Bruder. Er glaubt, Deutschland werde bis heute von den Amerikanern besetzt gehalten, die ganze Welt werde von Juden beherrscht. „Ich weiß schon länger, dass er so tickt“, sagt Brachtel. Aber früher war das nicht wichtig, früher konnten sie sich über Rockmusik oder Kleinstadttratsch oder Dynamo Dresden unterhalten. Seit Pegida und der Flüchtlingskrise gehe das nicht mehr. „Jetzt steht jeder auf einer Seite.“
Im Juli besuchte sie eine Bürgerversammlung. Stadtvertreter wollten erklären, wo die Flüchtlinge in Freital untergebracht würden. Im Saal wurde Brachtel beschimpft, man drohte, auch ihr Haus werde brennen. Als sie selbst sprechen wollte, wurde ihr das Mikrofon abgestellt. Nach der Veranstaltung fragte sie das Sicherheitspersonal, warum niemand eingegriffen habe. Antwort: „Lieber haben wir fünf von deiner Sorte gegen uns als 300 von den anderen.“
In Mocks Kneipe kennt man Steffi Brachtel und ihre Mitstreiter inzwischen mit Namen. Diese Gruppe von Ehrenamtlichen bestehe im Wesentlichen aus Wichtigtuern, sagt Mock. Und aus Frauen, die mal wieder gepoppt werden müssten.
Eines Abends wurde Brachtel auf dem Nachhauseweg von einem fremden Auto verfolgt. Seitdem holt ihr Sohn sie jeden Tag von der Bushaltestelle ab. Ein paar Wochen später wurde ihr Briefkasten in die Luft gesprengt. Als Brachtel auf der Wache fragte, wie die Polizei ihre eigene Gefährdung einschätze, erwiderte die Beamtin: „Würden alle Menschen solche Fragen stellen, kämen wir hier gar nicht mehr zum Arbeiten.“
Steffi Brachtel sagt, rechte Umtriebe würden in Freital seit Jahren bagatellisiert. Vielleicht, weil das Angehen dagegen enormen Aufwand und Risiken bedeute. Vielleicht, weil der Kampf ohnehin aussichtslos erscheine. Vielleicht aber auch, weil viele zwar nicht die bloße Gewalt, aber doch die Positionen dahinter guthießen. Träfe dies alles zu, wäre es kein Wunder, dass die Graffiti in der Stadt wochenlang bleiben. Es wäre Ausdruck eines Arrangements.
Zynische Erklärung der Stadt
Um die wenigen Engagierten und die Flüchtlinge zu unterstützen, plante die bundesweite Initiative „Laut gegen Nazis“ Anfang Mai ein Konzert in Freital, Smudo von den Fantastischen Vier wollte auftreten. Als der Veranstalter die Stadt um Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Bühnenstandort bat, lehnte die zunächst ab. In der Begründung hieß es, die Existenz einer Neonaziszene sei ein „Klischee“, das man nicht nähren wolle. Erst nach bundesweiten Protesten lenkte die Stadt ein.
Das Wort „Klischee“ klingt zynisch, bestenfalls weltfremd, wenn man in Freital Menschen wie Joseph Parkes, 18, Flüchtling aus Ghana, trifft.* Steht man abends um zehn mit Parkes auf dem Bürgersteig vor seiner Wohnung, dauert es keine Minute, bis von der anderen Straßenseite jemand „Scheißneger“ herüberbrüllt. Das Wort ist Joseph Parkes geläufig, genau wie Bimbo, Kanacke, Dreckskanacke. Einmal haben fremde Männer Böller nach ihm geworfen. Seiner deutschen Pflegemutter legte jemand Bananenschalen vor die Tür. Als Parkes kürzlich mit ihr auf dem Bahnsteig stand, musste sie in ihrer Handtasche kramen, also bat sie ihn, kurz ihren Kaffeebecher zu halten. Da wurde er wüst beschimpft: Wie er es wagen könne, hier zu betteln?
Joseph Parkes sagt, in Freital würden Dunkelhäutige schlechter als Hunde behandelt. „Ich glaube, die Menschen in dieser Stadt sind stolz darauf, rechtsextrem zu sein.“ Vor acht Monaten kam er her, er lernte schnell, die Hauptstraße zu meiden, Cafés sowieso. Er legt jetzt nur noch Wege zurück, die er nicht vermeiden kann: morgens zur Schule und nachmittags zurück. Zum Einkaufen begleitet ihn seine Pflegemutter. In der Bahn lachen ihn Mitreisende aus, haha, ein Schwarzfahrer.
Einmal im Monat sucht er im nahe gelegenen Pirna einen Traumatherapeuten auf. Der Mann hilft ihm, sagt Joseph Parkes. Er macht ihm Mut, er rät, Parkes solle weghören, wenn ihn jemand „schwarze Ratte“ schimpft. Das Gefühl der Erleichterung hält so lange an, bis Joseph Parkes wieder in Freital am Bahnhof ankommt und bepöbelt wird.
Er hat Suizidgedanken. Er sagt, das Maß an Leid, das er ertragen könne, sei nicht unbegrenzt. Aber er hat auch Hoffnung: Im September kann er vielleicht in der Nähe von Münster eine Ausbildung anfangen. Er ist bereits einmal dort gewesen. Joseph Parkes sagt, er war stark verwundert. Die Leute dort hätten ihn wie einen Menschen behandelt.
* Name geändert