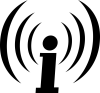Der Bürgerbeirat zum Sanierungsgebiet „Frankfurter Allee Nord“ (FAN) hat eine dringend nötige Diskussion im Berliner Bezirk Lichtenberg angestoßen: Was können die Bezirke tun um geflüchteten Menschen Wohnraum zu bieten? In Zeiten, in denen täglich neue Notunterkünfte eröffnet werden und ganze Familien mit Hostelgutscheinen im Normalfall der Obdachlosigkeit überlassen werden, muss auch Lokalpolitik zusehen wie dem katastrophalen Unterbringsmanagement des Senats auf die Sprünge geholfen werden kann.
Wie dringend solche lokalen Verständigungen sind, zeigt die große Beteiligung und die ziemlich dürftigen Statements der verantwortlichen PolitikerInnen in Lichtenberg. Die Grundhaltung der bezirklichen EntscheidungsträgerInnen unterscheidet sich, trotz der Bilder vom LaGeSo, nicht großartig von der von vor vier Jahren: Lasst die Probleme anderer Leute (LaGeSo, Senat, Merkel), die Probleme anderer Leute (Flüchtlinge, UnterstützerInnen) sein. Schön, dass mit dem fünfstündigen Fachtag am 6. November im Bürgerzentrum Schottstraße wenigstens ein bisschen Sand ins Getriebe gestreut wurde, wenn auch alle Beteiligten seltsam zufrieden rausgegangen sind.
Neben vielen AnwohnerInnen, und Leuten die bereits seit Jahren im Bereich Flüchtlingspolitik und Mietenpolitik tätig sind (Flüchtlingsrat, International Women Space, Bündnis gegen Lager, AG Wohnen von Xenion, Willkommens Ini Lichtenberg, Mieterbeirat Frankfurter Allee Süd, Mieterberatungen, Mietshäusersyndikat und Architekten, BewohnerInnen von Sammelunterkünften und sogar Heimleitungen) kamen vor allem Leute aus der Lokalpolitik und jemand von der Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE. Dass sich ausgerechnet so ein von Amtswegen (Beteiligungsverfahren beim Stadtumbau) eingerichteter Beirat berufen fühlt tatsächlich akute Fragen der Stadtentwicklung im Sinne einer integrierten Wohnraumstrategie mit rund 100 Leuten in Kleingruppen und Plena aufzufächern, zeigt wie wenig in den herkömmlichen politischen Räumen (z.B. BVVen, Verbände, Parteien, Zusammenschlüsse von Wohnungsbauakteuren) dazu horizontal diskutiert wird. Da hatte sich einiges angestaut. Schade, dass am Ende nicht verabredet wurde wie die z.T. guten Ansätze auf Bezirksebene umgesetzt werden können.
Inputs
Zu Beginn wurde von Betroffenen deutscher Willkommenskultur vom Leben im Lager berichtet. Jennifer vom International Women Space ging auf die spezifischen Probleme von Frauen in Lagern ein und konnte als Einstiegsinput vieles vorweg nehmen was ein Großteil im Saal offenbar noch nie gehört hatte. Hier wurde schnell klar, dass es nicht um das 'Dach über dem Kopf ' geht, sondern um menschenwürdige, selbstbestimmte Unterbringung, die Traumatisierungen nicht noch weiter vertieft. Ähnliche Schilderungen gab es schon viele (z.B. bei der Veranstaltung zur Lagerpolitik Berlins), aber selten in einem Rahmen wo die Leute anwesend sind, die aus unterschiedlichsten Gründen Sammelunterkünfte (nicht für sich selbst!) bevorzugen. Fazit des Inputs: Wenn schon Gemeinschaftsunterkünfte, dann wenigstens separierte Räume für Frauen.
Als zweiter Input kam Andrej Holm mit einem Vortrag zur Wohnungsversorgung in der Stadt und in Lichtenberg im Speziellen. Sein Fazit: Es gibt eine Unterversorgung von Wohnungen gerade für untere Einkommensschichten und eine künstlich herbeigeführte Konkurrenz um billige Wohnungen. Etwa 150.000 Haushalte haben keine eigene Wohnung. Das Ergebnis sind überbelegte Wohnungen und Obdachlosigkeit. Wer davon betroffen ist bzw. wer die Chance auf angemessenen Wohnraum hat, entscheiden die beiden Kriterien Geld und Diskriminierung. Ausgehend von den Verdrängungsbewegungen innerhalb Berlins (z.B. aus Mitte/Friedrichshain nach Lichtenberg/Marzahn) und der erhöhten Wohnungsnachfrage durch Flüchtlinge, machte Holm mehrere Vorschläge zur Abmilderung: Dem Wohnungsmangel muss mit Neubau und Erhalt preiswertem Wohnraums begegnet werden. Die Diskriminierung bestimmter Gruppen auf dem Wohnungsmarkt (z.B. Flüchtlinge) kann nur mit einer Belegungsbindung effektiv abgeholfen werden. All das gibt es schon – aber in zu geringem Maß. Darüber hinausgehende Vorschläge wären kurzfristig die Beschlagnahme von zweckentfremdeten und leerstehenden Wohnungen, ein Moratorium für Zwangsräumungen (2014 gab es über 7.000 Zwangsräumungen in Berlin), das Dulden von Selbsthilfe (Instandbesetzungen) und der gezielte Ankauf von Belegungsbindungen (vertraglich festgelegte Anzahl von Wohnungen, die nur an bestimmte Gruppen zu vermieten sind). Dann könnte auf Turnhallen und Traglufthallen schnell verzichtet werden. Als mittelfristige Maßnahme wäre ein Mietmoratorium denkbar – denn warum sollten bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften (in Lichtenberg immerhin 60% aller Wohnungen) die Mieten überhaupt steigen müssen? Neubau sollte nur mit Belegungsbindung möglich sein. Wirklich nachhaltig wäre es aber die spekulative Verwertung von Wohnraum zu unterbinden (z.B. durch ein Weiterverkaufsverbot) und selbstverwalteten Wohnraum zu stärken.
Thementische
Nach diesen klaren Worten wurden dann Thementische mit ExpertInnen gebildet, die Aspekte der Flüchtlingsunterbringung und des Wohnungsbaus vertiefen sollten. Die vollsten Tische waren der vom EjF, die für das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) die Wohnungsvermittlung für Flüchtlinge betreiben und der vom Berliner Flüchtlingsrat. Relativ schnell wurde deutlich, dass Flüchtlinge einerseits von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt betroffen sind, der Staat aber auch nicht mit Beratung oder unkomplizierteren Verwahren gegensteuert. Die Forderung nach dem Aufbau von bezirklichen Beratungsangeboten für Flüchtlinge, die in der Lage sind bei der Wohnungssuche und Vertragsabschluss zu unterstützen, wurde hier entwickelt.
Die Mieterberatung (Paper für den Fachtag als PDF) ging in kleiner Runde darauf ein, dass in Sachen sozialer Wohnungsbau viel an den Fakten manipuliert wird um eigentlich nur die Wohnungswirtschaft zu fördern. Die im Lichtenberger „Bündnis für Wohnen“ ausgehandelte Belegungsquote (25% der Neuvermietungen an WBS-EmpfängerInnen) täuscht beispielsweise darüber hinweg, dass WBS noch lange nicht ALGII bedeutet. Am Ende würden doch die vergleichsweise Gutsituierten diese Wohnungen bekommen. Wie Holm betonte auch Wilhelm Fehse nochmal: Die Wohnungsknappheit ist kein Ergebnis von Zuwanderung, sondern durch die politische Abkehr vom sozialen Wohnungsbau verursacht. Die Belegungskoordination in Lichtenberg kann nur noch über 1000 Wohnungen verfügen. Nach und nach fallen die Objekte aus den Belegungsbindungen raus und dann entscheiden ausschließlich die VermieterInnen wen sie einziehen lassen. Der einzige Ort um konkret zu werden, um beispielsweise ein Mietmoratorium für Lichtenberg zu vereinbaren, wäre das schon genannte „Bündnis für Wohnen“.
Die Stadtentwicklung hat das Wort
Nahtlos übernahm Stadtentwicklungs-Stadtrat Nünthel (CDU) diesen Tisch um 20 Minuten zu monologisieren. Da er offenbar sonst seine Bürgertransparenz-Zeit damit rumbringt den LichtenbergerInnen zu versichern, dass für Wohnungsneubau keine Kleingarten- und Grünanlagen weichen müssen, war er erstmal im falschen Film und tauchte auch nicht mehr wirklich auf.
Ihm geht es um Neubau – egal um welchen und in welchem Mietsegment - „Möglichst ohne Belegungsquoten o.ä. Bedingungen“. Begrenzt wird Wohnungsneubau nur durch (bezirklich zu schaffende) Infrastruktur (Schulen etc.). Die bescheidenen Ressourcen dafür und offensichtlich Nünthels Kleinmut, der sich durch die Bereichsentwicklungspläne und Bebauungspläne (Stichwort „Verdichtung“) seiner Behörde zieht, stehen dem Wohnungsneubau in Lichtenberg im Weg. Dass ein Viertel aller durch kommunale Wohnungsbaugesellschaften errichteten Wohnungen 8 Euro kalt pro m² kosten sollen, hält er für einen Erfolg des Lichtenberger „Bündnis für Wohnen“. Weit über Mietspiegel, sowieso über dem üblichen Satz der Kosten der Unterkunft (KdU) – aber billig genug um zu behaupten mensch täte etwas für billige Mieten. Er will den Wohnungsbestand mit Gemach (soziale Mischung undso) erweitern und so den Druck für alle MieterInnen rausnehmen. Mit seiner Strategie sind dieses Jahr 1.600 Wohnungen geschaffen worden. Nicht gerade viel, vor allem wenn mensch bedenkt, dass davon nur ein geringer Teil das Problem der Wohnungsversorgung im unteren Marktsegment lindern wird.
Zur Flüchtlingsunterbringung konnte er nicht viel sagen. Das ist Sache des Senats. Er hat fünf Objekte gemeldet, die von ihm aus gern beschlagnahmt werden können. Darunter ein altes Stasi-Bürogebäude in der Ruschestraße, wo rechnerisch 2.500 Personen untergebracht werden könnten. Auf die Frage was denn mit den anerkannten AsylbewerberInnen sei, also jenen die nicht mehr im Asylverfahren sind und deshalb aus der Zuständigkeit des LaGeSo rausfallen, hatte er nur die Hoffnung parat, dass der Senat die Leute in den Unterkünften weiter wohnen lässt. Die bezirkliche Zuständigkeit für deren potentielle Obdachlosigkeit, ficht ihn überhaupt nicht an. Er könnte sie auch gar nicht unterbringen und wird auch keine bezirklichen Sammelunterkünfte schaffen. Sein Argument: Nur weil sich Zuständigkeiten ändern, sollten die Leute nicht ihre Unterbringung verlieren. Hä? Da hat er wohl vorher nicht zugehört. Niemand will in Lagern leben! Im Asylverfahren hat sich diese Form der Unterbringung nunmehr durchgesetzt, aber dass es nun auch noch für anerkannte Flüchtlinge gelten soll, ist schon ein starkes Stück. Dem Monolog Nünthels lauschend macht sich das Gefühl breit: Der Mann will nur nicht – er kann auch nicht. Aber ablenken kann er gut.
Die Bürgermeisterin spricht
Nach den Thementischen kam die Bürgermeisterin Monteiro (wohlgemerkt Schirmherrin des Tages) kurz reingehuscht um sich von den Arbeitsgruppen befragen zu lassen. So adhoc fiel es ihr aber schwer den Ton zu treffen. Noch ganz beeindruckt vom „Anti-Heim-Geschrei“ vom Vortag (irgendeine Bürgerversammlung in der Konrad-Wolf-Straße) war es ihr wichtig zu betonen, dass sie keine Lichtenberger Turnhalle hergibt. Der Applaus blieb aus – vor allem weil sie zum eigentlichen Thema „Wohnraum für Geflüchtete“ nichts beitragen konnte. Wie bei Nünthel hieß es: Flüchtlingsunterbringung ist Aufgabe des Senats. Was sollen die Bezirke sich da den Kopf zerbrechen. Erst wenn es um die Schulplätze geht, müssen die Bezirke liefern. Und das fällt zunehmend schwerer, weil der Schulbau in Lichtenberg aufgrund finanzieller Probleme ins Stocken geraten ist. Sie stellte es aber so dar, als seien fehlende Schulen eine Art Trumpf im Ärmel gegen die Sammelunterkünfte des Senats. Wo keine soziale Infrastruktur, da auch kein Wohnraum. Ätsch. Ihre Aufforderung, man solle auch „an die denken, die hier schon sind“ verhallte, denn auch an die will sie selbst lieber nicht denken: Beim Thema Mietmoratorium nur für Lichtenberg schaltete sie ebenfalls auf stur. Mietpreisbremse seien Landes-, oder besser noch Bundespolitik.
Zur Frage nach den anerkannten AsylbewerberInnen konnte sie zumindest vermelden, dass sie bezirksweit zehn Stellen geschaffen hat, die sie flexibel in der Verwaltung (z.B. in der Leistungsabteilung des Sozialamts) einsetzen kann. Im Grunde hofft sie aber auf neue Gesetze, die alles ein wenig leichter machen (z.B. Bauordnungsrecht) und auf die große Unbekannte soziales ehrenamtliches Engagement. Beschlagnahme von Gebäuden findet sie juristisch schwierig – soll mal der Senat oder ein anderer Bezirk sich daran die Finger verbrennen. Wohnungsneubau findet sie wichtig, aber was ist mit dem Leerstand in Senats-Händen? Am Ende der langen Fragestunde bleibt nicht mehr viel übrig von dem was eine Bezirksbürgermeisterin so alles machen kann. Und schon war sie wieder weg.
Fazit
Die Abschlussdiskussion war sicherlich das Highlight des Tages. Leider wurde versäumt aus den Arbeitsgruppen umfassend zu berichten und zu dokumentieren was da für Vorschläge kamen. So blieb die gemeinsame Diskussion weit hinter dem zurück was die Thementische halbwegs erfolgreich erarbeitet hatten. Katrin Lompscher (Linke, ehm. Lichtenberger Stadträtin für Stadtentwicklung und auch mal Gesundheitssenatorin von Berlin), die sich, anders als Nünthel, tapfer den kompletten Tag beteiligt hatte, brachte noch ein paar neue Gedanken ein. Sie will die Genossenschaften stärker in die Pflicht nehmen. Schließlich haben die auch einen sozialen Auftrag, so wie die kommunalen Wohnungsunternehmen. Ihrer Meinung nach könnte der Bezirk gezielter von seinem Vorkaufsrecht für Bauland gebrauch machen, um den mehr oder weniger sozialen Wohnungsbauunternehmen billig Bauland über Erbbaupacht zu verschaffen. Die Beschlagnahme von leerstehendem Wohnraum fand sie auch nicht-einvernehmlich für juristisch durchsetzbar. Bisher hatte Berlin nur einvernehmlich mit gütlichen Entschädigungen Gebäude beschlagnahmt. Auch interessant war nochmal der Hinweis auf die 650 Millionen, die gerade in 60 modulare Gemeinschaftsunterkünfte investiert werden. Das seien stinknormale Sammelunterkünfte, die jetzt für Flüchtlinge und später für alle anderen hergerichtet werden denen das Recht auf normale Wohnungen aberkannt werde. Mit dem Geld könnten massig Plattenbauten hochgezogen werden. Schade dass sie zu ihren Amtszeiten nicht so mutig war.
Martina Mauer vom Flüchtlingsrat zeigte sich in der Gesamtschau des Tages ziemlich enttäuscht, dass sich weder der Senat noch die Bezirke ernsthaft Gedanken darüber machen, dass Leute, die jetzt in Notunterkünften untergebracht sind, auch mal irgendwann da raus wollen und spätestens dann Wohnungen gebraucht werden. Das ehrenamtliche Engagement, dass gerade beim Betrieb von Notunterkünften oder vor dem LaGeSo schamlos von der Politik und Betreibern abgegriffen wird, fehlt bei der Wohnungssuche. Wenigstens eine bezahlte Stelle zur Koordinierung der ehrenamtliche Hilfe bei der Wohnungssuche für Flüchtlinge sollte mal locker gemacht werden. Seit Jahren beteuert die Politik dass Wohnungsunterbringung politisch gewollt ist. Das Ergebnis dieses politischen Willens ist nicht spürbar. Hart aber gerecht.
Am Ende bleibt nicht viel von diesem Tag, außer dass noch viel Überzeugungsarbeit in den Bezirken zu leisten ist. Rhetorisch dauernd auf der Bremse, diskutierten die VerantwortungsträgerInnen aus Politik und Wohnungswirtschaft die teilweise interessanten Vorschläge einfach weg, legten einen Schleier der Unklar- und Unwissenheiten (am besten Zuständigkeits- und Jurageschnatter) über alles und fokussierten vor allem ihre Probleme mit einer steigenden Bevölkerungszahl, ihre Probleme mit dem Bauplanungsrecht, ihre Probleme mit den Kosten für Schulerweiterungsbauten usw. Spätestens in der Abschlussdiskussion war der Raum mit autoritärer Mutlosigkeit vollends ausgefüllt und auch Interventionen durch Flüchtlingsrat, EJF und Frau Lompscher konnten das Ruder nicht mehr rumreißen. Bruno vom Bündnis gegen Lager Berlin/Brandenburg hatte sich schon zu Beginn von den Sachzwängen der Verwaltungsfachangestellten verabschiedet und konnte auch zum Ende noch klar formulieren was die Grundprämissen einer humanen Unterbringungspolitik sein müssten: „Lasst die Leute ankommen.“ Sie kämen schließlich nicht aus Sammelunterkünften, sondern haben in ihren Heimatländern auch mal in Wohnungen gelebt. Ohne eigene Wohnung werden sie hier nie ankommen und die Mauern zur politisch gewollten Integration werden so immer höher.