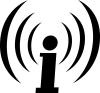Die „Postautonomen“ suchen das Bündnis mit linksbürgerlichen Kräften. Dafür verzichten sie auf Straßenkampf. Und schaffen Freiraum für andere Gewalttäter. Von Markus Wehner
Emily Laquer trägt weder Sturmhaube noch schwarze Kämpferkluft. Die 30 Jahre alte Studentin der Politikwissenschaft sieht ganz normal nett aus. Runde Hornbrille, Pulli, Jeans, mal ein Trainingsanzug, mal ein Sakko. So hat es die junge Frau kürzlich schon zum Gast einer Talkshow gebracht. Laquer hat die Proteste gegen den G-20-Gipfel in Hamburg mitorganisiert, sie ist Sprecherin der „lnterventionistische Linke“. Was dort vor einer Woche geschah, das sieht sie als Erfolg. Die Verantwortung für die Gewalt während der Gipfeltage trage allein die Polizei, sagte sie in Interviews. Nicht aber diejenigen, die wie sie „zur größten friedlichen Demo“ in Hamburg seit den achtziger Jahren und zu Sitzblockaden aufgerufen hatten. Der „Aufstand der Hoffnung“ gegen die Mächtigen sei gelungen. Die Medien regten sich „über brennende Karren auf“, nicht aber über Mittelmeertote, Klimaflüchtlinge oder Abschiebungen nach Afghanistan.
Laquer sieht sich selbst als „Kommunistin des 21. Jahrhunderts“. Autos anzuzünden, etwa jene „unserer Freunde“ aus dem Schanzenviertel in Hamburg, findet sie nicht gut. Aber verurteilen will sie das auch nicht. Vom Schwarzen Block distanziert sie sich nicht. „Unser gemeinsamer Ausdruck ist bunt, und auch Schwarz - also die Autonomen - ist ein Teil von bunt“, hat sie noch vor dem Gipfel in einem ihrer zahlreichen Interviews gesagt. Wer die Vision einer besseren Welt durchsetzen wolle, der müsse eben auch einmal Regeln verletzen. Die Helden von heute seien früher oft Kriminelle gewesen.
Seit es vor einer Woche in Hamburg zu einer Gewaltorgie mit Dutzenden brennenden Autos, zerstörten Geschäften, hundertfachen Angriffen auf Polizisten und einem Ausnahmezustand über mehrere Stunden hinweg kam, reden alle über die Leute vom Schwarzen Block. Wie konnte es dazu kommen, dass einige hundert linksextremistische Gewalttäter die Außenwirkung des Gipfels weitgehend bestimmten? Dass sie ungestört Brände legen und plündern konnten und den Eindruck hinterließen, dass der Staat und seine Ordnungskräfte überfordert waren?
Gründe dafür gibt es viele: die generalstabsmäßige Planung der militanten linken Szene, die sich über ein Jahr auf dieses Großereignis vorbereitet und die örtlichen Gegebenheiten ausgekundschaftet hatte; die Unterstützung durch eine starke linksextremistische Szene in Hamburg, die Unterkünfte, Beratung und auch Kampfausrüstung bereitstellte; die große Zahl von Mitgliedern des Schwarzen Blocks aus Italien, Frankreich oder Griechenland, die aufgrund der Demonstrationserfahrung in ihren Heimatländern und auch eines intensiveren „Trainings“ noch rücksichtsloser Gewalt ausübten als ihre deutschen Gesinnungsgenossen. Und denen es anscheinend egal war, ob sie bei ihrer Randale ein Szeneviertel verwüsteten.
Über allem schwebt jedoch ein allgemeiner Grund: Die Politik hatte den Linksextremismus unterschätzt. Man hatte - trotz der Warnungen der Sicherheitsbehörden - nicht damit gerechnet, dass die linksextremistische Szene noch in der Lage ist, so breit zu mobilisieren und dermaßen gewaltsam vorzugehen.
Schließlich schienen die Autonomen in den letzten Jahren eher in einer Krise zu sein als in der Offensive. Zur sogenannten revolutionären 1.-Mai-Demo in Berlin-Kreuzberg gingen in den vergangenen Jahren zwar immer mehr Leute, doch zu den ganz schweren Ausschreitungen früherer Jahre kam es nicht mehr. Der Funke der Gewalt sprang nicht mehr über. Die autonome Szene wirkte zunehmend isoliert, trotz oder auch wegen ihrer rituellen Gewaltausbrüche.
Was dabei in der Öffentlichkeit aus dem Blick geriet, beschreiben Verfassungsschützer als Strukturwandel der Szene. Viele Linksextremisten entsprechen wie Emily Laquer heute nicht mehr dem Bild des Steine und Molotowcocktails werfenden Straßenkämpfers. Sie lehnen martialische Gesten ab, sind in ihrem Habitus und ihrem Aussehen betont bürgerlich, oft gut ausgebildet und beruflich etabliert. Sie wollen zwar weiter den Kapitalismus überwinden und den bürgerlichen Staat als Garanten dieser Wirtschaftsordnung abschaffen. Gewalt lehnen sie nicht ab, halten sie sogar für notwendig. Sie sind aber bereit, etwa bei Demonstrationen aus taktischen Gründen auf sie zu verzichten. Denn sie suchen das politische Bündnis mit anderen linken Gruppen, bis weit in das bürgerliche Lager hinein. So wollen sie die Isolation der autonomen Gruppen vom Rest der Gesellschaft überwinden. Sie nennen sich deshalb Postautonome.
Der Verfassungsschutz gibt ihre Zahl mit 800 an, der Berliner Extremismusforscher Klaus Schröder spricht von annähernd tausend Personen. Das ist immer noch eine Minderheit der gewaltbereiten Linksextremisten in Deutschland, deren Zahl zwischen 6000 und 8000 Personen liegt. Doch während die ursprünglichen Autonomen in die Jahre gekommen sind und Nachwuchsprobleme haben, wächst die Zahl der Postautonomen. In Berlin, das schon oft der Trendsetter in der linksextremistischen Szene war, zählt der Verfassungsschutz 320 Postautonome, das ist rund ein Drittel der 970 gewaltbereiten Autonomen. Vor allem junge Studenten schließen sich den Postautonomen an.
Als Ausgangspunkt für die Entstehung der Postautonomen gilt eine missratene Mobilisierung der deutschen Linksextremisten, jene zum G-8-Gipfel in Köln 1999. Damals begannen Diskussionen, wie die linksextremistische Szene ihre Isolation aufbrechen, wie sie wieder zu einer politischen Kraft werden könne.
Aus einem langwierigen Diskussionsprozess ging die heute bedeutendste Gruppe der Postautonomen hervor: die „lnterventionistische Linke“ (IL). Sie trat zum ersten Mal beim G-8-Gipfel 2007 in Heiligendamm in Erscheinung, mobilisierte für den Schwarzen Block auf der Großdemonstration in Rostock und organisierte Sitzblockaden in der Nähe des Gipfelgeländes. Mittlerweile haben sich zahlreiche autonome Gruppen der IL angeschlossen, so etwa vor drei Jahren die Gruppe „Avanti“ und große Teile der „Antifaschistischen Linken Berlin“. Heute hat die IL rund 30 Ortsgruppen, eine Organisationsform, die eigentlich untypisch für das autonome Umfeld ist, aus der sie sich speist. Denn autonome Gruppen sind oft nur lose Cliquen, sie lehnen Hierarchien zumindest offiziell ab und tun sich schwer damit, ihre Unabhängigkeit zugunsten einer größeren Organisation aufzugeben. Um nicht in politischen Nischen zu verharren oder „sich im Zynismus der reinen Kritik zu verlieren“, wie es in einem Papier heißt, klinkt sich die „interventionistische Linke“ in vielerlei politische Kampagnen ein. Dazu gehörten Proteste gegen Atommülltransporte ins Zwischenlager Gorleben („Castor? Schottern!“) oder gegen Braunkohletagebau („Ende Gelände“), Blockaden von Neonazi-Treffen oder Solidaritätsaktionen für Flüchtlinge. Ziel ist es, über aktuelle Themen möglichst viele Personen anzusprechen und „mittelfristig zu radikalisieren“, wie Verfassungsschützer schreiben. Vor allem die Globalisierungsdebatte hat den Postautonomen Zulauf gebracht.
Bei den Protesten in Hamburg war die „Interventionistische Linke“ für die Protestchoreographie zuständig. An verschiedenen Protesttagen sollten die Zufahrtswege zu den Veranstaltungsorten es Gipfels blockiert werden. Das Ganze hatte die Gruppe schon bei den "Blockupy" -Aktionen im März 2015 in Frankfurt praktiziert, die sich gegen die Eröffnung des Neubaus der Europäischen Zentralbank richteten. Mit ihren Aktionen des „zivilen Ungehorsams“, vor allem durch Sitzblockaden, banden sie die Polizeikräfte und bereiteten so den Boden für die gewalttätigen Kleinstgruppen, die damals Barrikaden in Brand setzten, Schaufenster von Geschäften zerstörten und auch eine Polizeiwache angriffen.
Was in Frankfurt zum Teil noch ungeplant geschah, wurde vor einer Woche in Hamburg schon gezielt eingesetzt. Die Postautonomen spielten eine wichtige Rolle dabei, dass die Proteste in Gewalt umschlagen konnten. Sie blockierten mehr oder weniger militant die Zufahrtswege zu den Austragungsorten des Gipfels und beschäftigten damit die Polizei, die dafür sorgen musste, dass der Gipfel stattfinden konnte. Damit schufen sie den Freiraum für die Autonomen, die sich über das Stadtgebiet verteilten und zum Teil geplant, zum Teil spontan Ziele angriffen, die von den Polizisten nicht geschützt wurden.
Die „Interventionistische Linke“ feiert die Aktionen in Hamburg als Erfolg, nicht zuletzt weil sich „große Teile der Bevölkerung solidarisierten“, wie es in einer Bewertung der Gruppe heißt. Ein Gipfeltreffen dieser Größenordnung in einer Großstadt in Westeuropa sei „auf Jahre hinaus undenkbar“. Zwar üben sie auch milde Kritik an der Gewalt, die sich gegen Anwohner und Geschäfte richtete. Doch verurteilen will die Gruppe das nicht. „Wir haben schon vorher gesagt, dass wir uns nicht distanzieren werden und dass wir nicht vergessen werden, auf welcher Seite wir stehen.“
Seit den neunziger Jahren ist es den linksextremistischen „Antifa“-Gruppen immer wieder gelungen, Bündnisse mit demokratischen Kräften zu schmieden, etwa wenn es gegen Aufmärsche der NPD oder von Neonazis ging. Auch bei den Protesten gegen Pegida oder die A.fD ist das zuletzt der Fall gewesen. Von der Linkspartei über die Grüne Jugend bis hin zu Gewerkschaften und kirchlichen Gruppen reicht dann die Spanne der Kräfte, die sich von den Linksextremisten instrumentalisieren lassen. Die „Interventionistische Linke“ kooperiert auch mit dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac. In den Sicherheitsbehörden werden die Postautonomen deshalb als neuer Versuch der linksextremistischen Szene gesehen, ihren politischen Einfluss deutlich auszuweiten. „Ich sehe die Gefahr, dass sie die Isolation der linksextremistischen Szene aufbrechen können“, sagt ein Verfassungsschützer.
Wenn zugleich Gewalttaten gegen Polizisten und Rechtsextremisten immer öfter gerechtfertigt werden, dann könnte auch der bisher geltende Konsens der Szene bröckeln, dass gezielte Tötungen kein Mittel des politischen Kampfes mehr sein sollen. Das jedenfalls befürchten die Sicherheitsbehörden. In Berlin hat sich die Tonlage der Erklärungen schon erheblich verschärft, etwa in den Auseinandersetzungen um ein Symbolprojekt der Autonomen, die besetzte Rigaer Straße 94. Mit mächtigen Angriffen gegen Senat und Polizei, „vielleicht sogar mit bewaffneten Kampfhandlungen“ müsse gerechnet werden, hieß es in einem Aufruf. In einem anderen wünschte man sich „Heckenschützen auf den Dächern“, um sich „vor dem Gewaltausbruch der Schweine“ zu retten. Gemeint waren Polizisten.