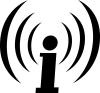Die neue Leiterin des Simon Dubnow-Instituts Yfaat Weiss im Interview
Das Simon-Dubnow-Institut erforscht die jüdische Geschichte und Kultur mit Schwerpunkt Mittel- und Osteuropa. Seit April leitet Yfaat Weiss die Einrichtung. Die Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Leipzig und Professorin für Jüdische Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem sprach mit dem kreuzer über Institutsaufgaben, Leipzig in der hebräischen Literatur und als Ort der Begegnung.
kreuzer: Kannten Sie Stadt und Institut schon zuvor?
YFAAT WEISS: Ich war das erste Mal 1992 in Leipzig. Das war im Rahmen eines längeren Archivaufenthalts für meine Dissertation über deutsche und polnische Juden vor dem Holocaust. Die Stadt befand sich damals stark im Umbruch und ich habe meine Zeit hier als eine doppelte Erfahrung von Ost und West in Erinnerung. Zum einen, da mein Promotionsthema sich intensiv mit Fragen von ost- und westeuropäischen Juden auseinandersetzte, zum anderen, da sich in der Stadt deutlich ein Aufeinandertreffen von Ost und West zeigte. Untergebracht war ich in einem sorbischen Studentenwohnheim und dort bekam ich einen besonderen Einblick in eine Lebenswelt, die ich vorher nicht kannte. Insgesamt also eine sehr spannende Zeit, in der ich Leipzig zuerst kennenlernte und später habe ich dann immer mal wieder die Entwicklung der Stadt verfolgt. Vor allem auch, da mich in Leipzig mit dem Dubnow-Institut ja bereits seit langer Zeit vieles verbindet. In meiner Funktion als Professorin an der Hebräischen Universität Jerusalem und als Direktorin des Franz Rosenzweig Minerva Research Centers gab es bereits eine enge Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen und nun wechsle ich gewissermaßen die Rolle und freue mich auf die Aufgaben als neue Direktorin des Instituts.
kreuzer: Welche sind diese?
WEISS: Meine Aufgabe muss es zunächst sein, die Tradition des Hauses zu bewahren, zu der eben auch die engen Kontakte zu der Hebräischen Universität in Jerusalem gehören, die ich durch meine bleibende Verankerung dort fortsetzen möchte. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch die Forschung im Rahmen neuer inhaltlicher Schwerpunkte und organisatorischer Formate weiter entwickeln, um damit auch neue Perspektiven und Kooperationen für das Institut zu ermöglichen. Mit der Aufnahme in die Leibniz-Gemeinschaft ab Januar 2018 steht das Institut auch vor einem Umbruch. Damit sind beste Rahmenbedingungen geschaffen für eine auf Kontinuität, Unabhängigkeit und Dauer angelegte Forschung. Dabei ist unser zentrales Anliegen, Studierende für die jüdische Moderne zu interessieren und ihnen einen Zugang zu eröffnen, der jüdische Geschichte als Bestandteil der europäischen Geschichte betrachtet, als fremd und eigen zugleich, und auf diese Weise den Blick schärft für Entwicklungen der europäischen Moderne insgesamt.
kreuzer: Das Institut erforscht jüdische Lebenswelten, begreift die »jüdische Geschichte als Geschichte verschiedener Judenheiten«. Können Sie das erklären?
WEISS: Das Dubnow-Institut erforscht jüdische Geschichte und Kultur mit einem Schwerpunkt in Mittel- und Osteuropa, also dort, wo von der Frühen Neuzeit bis zum Holocaust die weltweit größten jüdischen Gemeinschaften lebten. Dementsprechend vielfältig sind die Zugänge zu unserem Gegenstand. Mittel- und osteuropäische jüdische Geschichte zu erforschen, verweist auf eine eindrückliche Spannung in unserer Arbeit: Während sich die Mehrheit der Juden in Mitteleuropa seit der jüdischen Aufklärung, der Haskala, mehr und mehr akkulturierten – bildete sich in Osteuropa eine jüdische Nationalbewegung heraus. Der Ausdruck »verschiedene Judenheiten« verweist auch auf die diasporische Verfasstheit der jüdischen Geschichte; dass es eben nicht ein, sondern verschiedene Zentren gibt, in denen sich jüdisches Leben dann sehr unterschiedlich ausformte und ausformt. Das ist im Übrigen auch ganz im Sinne unseres Namensgebers, Simon Dubnow, gedacht – einer der bedeutendsten jüdischen Geschichtsschreiber. Es ist also entscheidend, sich auch mit den Umgebungskulturen, dem Austausch zwischen Juden und Nicht-Juden, den interkulturellen Räumen, in denen sie sich bewegen, zu befassen. Am Institut gibt es daher zum Beispiel eine lange Tradition, das Verhältnis zwischen islamischer oder protestantischer und jüdischer Kultur zu untersuchen. Wir versuchen überdies dem Umstand gerecht zu werden, dass Migration und Bewegung in der jüdischen Geschichte eine zentrale Rolle spielen. Insofern betrachten und erforschen wir sowohl die Bewegungen als auch die dadurch entstehenden Zentren in Bezug auf Individuen und kollektive Formationen in ihrer jeweiligen religiösen und kulturellen Vielfalt.
kreuzer: Wie »jüdisch« ist Leipzig?
WEISS: Leipzig zeichnet sich innerhalb der jüdischen Geschichte als Stadt der Ost-West Begegnungen aus. Als Messe- und Universitätsstadt, als Stadt der Wissens- und Buchkultur aber auch im Zuge der Ost-West Migration spielte Leipzig eine zentrale Rolle. Als sich die diskriminierende Politik gegenüber Juden im 19. Jahrhundert änderte, zogen vermehrt Juden in die Stadt, darunter auch viele Studierende. Die Leipziger jüdische Gemeinde ist der Ort, an dem verschiedene Formen der Repräsentation erprobt wurden und insofern ist sie für die Geschichte von Migration und Integration von einiger Bedeutung. Als Ort der Begegnung hat Leipzig auch in der hebräischen Literatur seinen Ausdruck gefunden. Der Nobelpreisträger Schmu’el Josef Agnon, der 1917 und 1930 jeweils mehrere Monate in Leipzig verbrachte, schreibt sehr fasziniert von der Handelsstadt. In seinem berühmten Roman »Herrn Lublins Laden« schildert er ein Handelshaus im Böttchergäßchen am Markt als Treffpunkt für jüdische Kaufleute – alt eingesessene Leipziger, die einer urbanen, westlichen Lebenswelt entstammen – und für sogenannte »Ostjuden«, die durch den Ersten Weltkrieg heimat- und mittellos in Leipzig gestrandet waren. In Lublins Laden treffen diese unterschiedlichen Welten aufeinander und rege Debatten entstehen, die sehr aussagekräftig für die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen ist. Man könnte weitere Beispiele aufzählen und insofern reicht die Bedeutung Leipzigs weit über seine Grenzen hinaus.
kreuzer: Hören die Leute »jüdisch«, werfen sie oft Kultur, Religion, Holocaust und noch irgendwas mit Klezmer und Witz zusammen. Wie schwer ist es, Klischees gegen anzugehen?
WEISS: Ich denke, ein Institut, das sich mit der jüdischen Moderne befasst, beschäftigt sich naturgemäß mit der Aufklärung und dem was das Judentum im Zuge der Säkularisierung ausmacht; es begreift seine Aufgabe aber als wissenschaftlich und nicht als aufklärerisch. Insofern sind die Aufgaben durch den Gegenstand definiert. Wir haben aber gewiss auch ein Interesse, unsere Forschung einer interessierten Öffentlichkeit nahezubringen und Zugänge zur jüdischen Geschichte und Kultur zu eröffnen, die den Zusammenhang zur europäischen Geschichte aufzeigen und die viele Fragen aus unserer heutigen Zeit betreffen.
kreuzer: Ein Schwerpunkt des Instituts bildet die Migrations- und Wissenschaftsgeschichte. Wie stehen Migration und Innovation in Verbindung?
WEISS: Migration ist eines der vielen Phänomene von Bewegung, die die jüdische Geschichte ausmachen. Auch Säkularisierung oder Modernisierung sind als solche Phänomene der Bewegung oder der Wandlung zu verstehen, zu denen auch Zwangsphänomene wie Flucht gehören. Gemeinsam ist all diesen Bewegungen, dass sie Wandlungen mit sich bringen, die sich dann auch in Wissensfeldern ausdrücken und, ob gewollt oder ungewollt, Innovationen hervorbringen. Als Beispiel könnte ich die Kulturgeschichte der Hebräischen Universität Jerusalem nennen, die 1925 eröffnet wurde und von Anfang an stark geprägt war durch die deutsche und deutsch-jüdische Tradition. In den 1930er Jahren fanden zahlreiche aus Deutschland zwangsemigrierte Gelehrte in Palästina und an der Hebräischen Universität eine Zuflucht: etwa Richard Koebner oder Martin Buber. Im Grunde findet hier ein »transfer of knowledge« statt, und es ist sehr bereichernd, sich das Wirken dieser Gelehrten unter dem Aspekt von Übersetzungsprozessen sowohl im sprachlichen also auch im wissenschaftlichen und epistemischen Sinne anzuschauen. Auch wenn einige dieser Gelehrten später in Hebräisch unterrichteten, so war das, was sie lehrten gewissermaßen immer noch deutsch. In diesem Sinne könnte man auch eine jüngere Generation betrachten: Etwa die Schriftstellerin, Lyrikerin und Sprachwissenschaftlerin Lea Goldberg, die es gerade noch geschafft hatte 1933 in Bonn zu promovieren und in den 1950er Jahren an der Universität in Jerusalem das Fach Komparatistik begründete.
kreuzer: Sie forschen zum Zusammenleben verschiedener Ethnien. Können Sie einen Rat für das Zusammenleben geben?
WEISS: Die Beschäftigung mit der Jüdischen Geschichte ist keine angewandte Wissenschaft, insofern wären alle Ratschläge anmaßend. Ich denke, man muss bei der nüchternen Feststellung bleiben, dass es vor allem um das Erkennen und Benennen von historischen Phänomenen geht – mit dem richtigen Abstand, der ausgewogenes Urteilen und Differenzierungsvermögen befördert.
Das Interview erschien in gekürzter Version in der Juli-Ausgabe des kreuzer.
INTERVIEW: TOBIAS PRÜWER