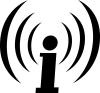Hamburg. Es ist Sonntagvormittag, halb zwölf, als der Staat ein weiteres Mal daran scheitert, ins Hamburger Schanzenviertel zurückzukehren. In diesem Moment will sein oberster Repräsentant, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, ins Schulterblatt fahren, in jene Straße, in der vom Staat am Freitagabend weit und breit nichts zu sehen war. In der militante Randalierer Holzplatten zu brennenden Barrikaden türmten, Scheiben einschlugen und Geschäfte plünderten. Aber es bleibt für Steinmeier bei dem Versuch.
Ein Besuch im Schanzenviertel sei zu gefährlich, erklärt ihm die Polizei. Neue Krawalle drohen. Alles, was dem Bundespräsidenten bleibt, ist ein Gespräch mit Anwohnern auf dem Polizeirevier. Der Staat scheint die Kontrolle noch immer nicht wiedererlangt zu haben. „Ich bin fassungslos“, sagt Steinmeier später vor den gut bewachten Messehallen. Er meint das, was am Freitagabend im Schanzenviertel geschah. Er könnte aber auch meinen, was er eben erlebt hat.
Steinmeier wollte am Schulterblatt etwas reparieren. Etwas, das sich weit schwerer reparieren lässt als zerbrochene Schaufenster und eingeschlagene Geldautomaten. Der Bundespräsident wollte den Menschen ein Gefühl zurückgeben. Das Gefühl, dass der Staat auf sie aufpasst. Dass er für sie da ist, wenn es gefährlich wird. Daraus wird nun nichts.
Es waren drei Stunden der Anarchie, die die Republik erschütterten. Drei gesetzlose Stunden am Freitagabend im Hamburger Schanzenviertel, die Folgen haben werden. Es gibt politische Folgen, weil der Erste Bürgermeister der Stadt Hamburg nun erklären muss, ob er für ein paar strahlende Bilder mit Staatschefs vor der Elbphilharmonie Teile der Stadt dem Mob preisgegeben hat. Und weil sich die Politik nun die Frage stellen muss, ob das künftig tatsächlich nicht mehr möglich ist: dass sich Staatschefs inmitten der Metropolen treffen statt auf Helgoland oder in den Bergen.
Zunächst einmal haben diese drei Stunden aber emotionale Folgen. Ulf, ein 45-jähriger Sozialarbeiter, seit 20 Jahren in der Schanze zu Hause, steht am Sonnabendmorgen mit seinem achtjährigen Sohn zwischen den verkohlten Resten der abgebrannten Barrikaden. „Ich habe aus dem Fenster geschaut und die ganze Zeit gedacht, wann kommen die denn, wo bleiben die nur“, erzählt er fassungslos. „Aber die Polizei kam einfach nicht.“ Cord Wöhlke, Chef der Drogeriekette Budnikowsky, ein hanseatischer Herr in weißem Hemd, steht mitten im Chaos seiner verwüsteten Filiale, bei jedem Schritt tritt er auf eine Mischung aus Scherben, Vollkornkeksen, Teebeuteln und dem Rest seiner Drogeriewelt.
Wöhlke erfuhr am Freitagabend durch einen Anruf von der Plünderung, er fuhr dann mit seinem Sohn sofort zum Schulterblatt – und konnte nur zusehen, wie vermummte Chaoten sein Geschäft ausräumten und bevorzugt Spraydosen ins Feuer warfen, weil die dann so schön explodieren. Auf 400 000 Euro schätzt Wöhlke den Schaden. Aber es gibt etwas, das ihn noch mehr entsetzt. „Das war hier über Stunden ein komplett rechtsfreier Raum“, sagt er. „Das hätte ich nie für möglich gehalten.“ Wer jene Nacht in der Schanze erlebte, der sah Anwohner des Schulterblatts, die zunächst noch versuchten, die Feuer auf der Straße zu löschen – und dabei von den Randalierern beschimpft, getreten und geschlagen wurden. Man sah junge Männer um die 20, viele Italienisch, Griechisch und andere Sprachen sprechend, die blitzschnell ihre bunten T-Shirts gegen schwarze Kleidung tauschten, Tücher vors Gesicht banden und dann die Pflastersteine aus dem Boden stemmten. Man sah am Rand viele Zuschauer, Bierflasche in der Hand, die Party ging weiter, im Brandgeruch, zwischen meterhoch lodernden Feuern. Und man sah gegen Mitternacht eine Polizei, die mit Reizgas, zwei Wasserwerfern, Räumfahrzeug und mehreren Hundertschaften gerade mal eine Dreiviertelstunde brauchte, um das Schulterblatt zu räumen und die Chaoten von den Straßen zu spritzen.
Die entscheidende Frage war dann: Wäre das nicht vielleicht auch ein bisschen früher gegangen?
Am Sonntagmittag um 13.10 Uhr sind es vier Männer, die im Polizeipräsidium im Hamburger Norden der Öffentlichkeit eine Antwort geben wollen: der Erste Bürgermeister Olaf Scholz, der den Hamburgern vor dem G-20-Gipfel erklärt hatte, man traue sich den Gipfel schon zu, „wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus“. Dazu Innensenator Andy Grote, Polizeipräsident Ralf Martin Meyer und sein Einsatzleiter Hartwig Dudde, der markig angekündigt hatte, er werde „alles auspacken“, was es an Polizeitechnik gibt.
Dudde, 54 Jahre alt, im Halbarm-Polizeihemd, zeigt eine Zwillenkugel aus Metall, die die Panzerung eines Wasserwerfers durchschlagen habe, als seine Beamten auf das Schulterblatt wollten. Er zeigt ein unscharfes Wärmebildvideo, aufgenommen vom Hubschrauber, das zeigen soll, wie Chaoten vom Dach eines Hauses am Eingang zum Schulterblatt einen Molotowcocktail und Steine auf die Beamten warfen. „Wir wollten nicht in die Falle laufen“, sagt Dudde. Also habe er erst das Spezialeinsatzkommando angefordert, das aber noch an der Elbphilharmonie eingesetzt gewesen sei. Dudde spricht direkt, leicht schnoddrig, „die waren da eingegraben“, sagt er. Als sie 13 Personen auf dem Dach festgenommen hatten, hätten sie das Schulterblatt „schnell durchgeräumt“.
Dudde wirkt vollkommen mit sich im Reinen. Ganz anders als Scholz. Scholz spricht leise, zögernd, er sieht blasser aus als sonst. Er weiß, dass die Sätze, die er vor dem Gipfel gesprochen hat, jetzt unfassbar naiv wirken. Dass es verheerend wirkt, wenn er mit Donald Trump und Angela Merkel beim Konzert in der Elbphilharmonie sitzt, während draußen die Stadt brennt. „Das erschreckt … jeden, mich auch“, sagt er stockend. „Das bedrückt ... jeden, mich auch.“ Aber diese öffentliche Selbstzerknirschung reicht nicht aus, um seine Kritiker zu beruhigen. Auch, dass er schnell Entschädigung für die betroffenen Bürger verkündet hat, entlastet ihn kaum. Die Hamburger CDU fordert noch am Sonntag seinen Rücktritt. „Politisches Totalversagen“ wirft ihm der Oppositionschef in der Bürgerschaft, André Trepoll, vor. Und legt nach: „Das war die größte Fehleinschätzung eines Hamburger Bürgermeisters aller Zeiten.“
Seit eineinhalb Jahren haben Bundesinnenministerium und der Hamburger Senat, haben Angela Merkel und Olaf Scholz immer ein Ziel gehabt: Der G-20-Gipfel sollte ein Erfolg werden, allen Vorurteilen zum Trotz. Beide stimmten sich ab, kooperierten, planten. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, das nun gescheitert ist.
Die Verquickung von Union und SPD in der Sache ließ beide Seiten in Sachen Schuldzuweisung zunächst zurückhaltend reagieren. Mit den katastrophal wirkenden Videos und TV-Bildern von brennenden Barrikaden begannen aber auch die Sorgen um eine sich anschließende innenpolitische Debatte über ein mögliches Polizeiversagen.
Aus dem Kanzleramt ergingen Bitten an die Innenpolitiker auch der Union, sich zurückzuhalten. „Wir wollen keine parteipolitische Schlammschlacht“, lautete der Appell. Und selbst FDP-Vize Wolfgang Kubicki warnte vor einem „politischen Schaukampf“.
Die Innenminister, ob Thomas Strobl aus Baden-Württemberg oder Bayerns CSU-Spitzenkandidat und Joachim Hermann hielten sich daran. Andere Innenpolitiker wie Hans-Peter Uhl waren weniger zimperlich. „Man hätte den G-20-Gipfel nie in einer Millionenstadt wie Hamburg veranstalten dürfen. Die Sicherheitslage ist dort viel zu schwer zu kontrollieren“, sagte Uhl öffentlich.
Es sind Angriffe, die nun in der SPD zunehmend für Frust sorgen. Die Genossen wollen sich nicht in die Rolle derer drängen lassen, die nicht für Sicherheit sorgen können. „Die Einladung zum G-20-Gipfel hat die Bundeskanzlerin ausgesprochen. Sie war die Gastgeberin“, sagt SPD-Parteivize Ralf Stegner dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Dass Teile der Union jetzt der SPD und Olaf Scholz die Verantwortung für die Hamburger Krawalle zuschieben, ist billig.“
Zweieinhalb Monate vor der Bundestagswahl scheint das Desaster von Hamburg damit auf dem besten Weg zu sein, ein Thema für den Wahlkampf zu werden. Genau das also, was Union und SPD eigentlich verhindern wollten. „Man kann nicht nur für die schönen Bilder zuständig sein wollen“, sagt SPD-Vize Stegner und verweist auf die Kanzlerin. Schöne Bilder gab es bei diesem Gipfel allerdings ohnehin nicht allzu viele.
Tage der Gewalt – eine Bilanz in Zahlen
21 000 Polizisten, schätzt der Hamburger Polizeipräsident Ralf Meyer, waren während des G-20-Gipfels und der Krawalle in der Hansestadt im Einsatz.
200 österreichische Polizisten, darunter 95 Spezialisten der Sondereinsatzkommandos Cobra und Wega, sind nach der ersten Krawallnacht zu Hilfe gerufen worden. Sie waren bis zum Sonntagmorgen im Einsatz.
476 Einsatzkräfte sind nach Auskunft der Polizei verletzt worden; knapp 200 werden in Kliniken behandelt.
70 Demonstrantensind im Klinikum Eimsbüttel behandelt worden, einige wenige auch in anderen Kliniken. Die genaue Zahl der Verletzten ist nach wie vor unklar, die Demonstranten hatten eigene Sanitäter angeheuert.
186 Randalierer sind festgenommen worden. Darunter sind 132 Deutsche, acht Franzosen und sieben Italiener. Der Rest verteilt sich laut Polizei auf andere Nationalitäten, darunter auch Russen und Türken. 158 der 225 in Gewahrsam genommenen Personen sind Inländer, 20 sind Italiener und 17 Franzosen.
478 Rettungseinsätze ist die Feuerwehr gefahren. Zweimal wurde die Feuerwehr am Freitag unter dem Stichwort „Massenanfall von Verletzten“ alarmiert: einmal, als 15 Polizisten wegen der Hitze und der Anstrengung zusammenbrachen, und einmal, als 14 Demonstranten, die auf einen Zaun geklettert waren, vier Meter in die Tiefe stürzten.
1000 private Fotos und Videos mit Aufnahmen möglicher Straftäter und Randalierer haben Hamburger Anwohner des Schanzenviertels bis zum Sonntagnachmittag der Polizei übergeben.
Konfliktforscher: Nicht nur auf Polizei bauen
Nachgefragt . . .
Herr Zick, was treibt junge Menschen zu solchen Gewaltexzessen wie jetzt in Hamburg?
Diese Gewalt hat eine Vorgeschichte, und da liegt die Motivation. Der sogenannte schwarze Block hat sich weit vorher formiert und sich dann zu den Guerillaaktionen verabredet. Der Block besteht bei solchen Großdemonstrationen aus zumeist jungen Männern aus verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Milieus. Bei der Formierung dieses Blocks motivieren aggressive Botschaften, um eine gemeinsame Identität herzustellen. Dann wird die Gewalt schon zur Norm, bevor es zur Aktion geht. Das Motiv ist, die Macht der Gruppe zu demonstrieren.
Was wollen sie bekämpfen?
Es wird ein Feindbild aufgebaut, auf das sich konkrete Gewaltaktionen beziehen können: Polizei, Reiche, Eigentümer – aber auch Gegendemonstranten, die Zivilcourage zeigen. Die Botschaft gerät in den Hintergrund. In der konkreten Konfliktsituation sind meist die einigende Identität und der Gruppendruck so groß, dass die Motive der Einzelnen keine Rolle spielen. Extreme Gewalt gegen Menschen wird ausgeübt, wenn sich die Idee herausbildet: Jetzt kämpfen wir – egal, ob alle zusammen untergehen.
Wie bewerten Sie die Strategie der Polizeieinsätze?
Die Strategie der Polizei hängt davon ab, welche Gewaltszenarios sie vorher entwickelt, wie die Einheiten koordiniert werden können und wie sie dann kooperieren. Die Polizei war zahlenmäßig gut aufgestellt und hat das vermittelt. Die Idee, Strategien sichtbar zu machen, ist gut. Das hätte sie noch intensiver an die friedlichen Demonstranten vermitteln können.
Hat die Polizei Fehler gemacht?
Die Polizei hat bei der ersten Demonstration „Welcome to Hell“ zu früh versucht, den schwarzen Block aus der Demo zu trennen. Das hat den Block bestätigt und Teile der friedlichen Demonstranten verärgert, weil nun die erste legale Demonstration kaum stattfinden konnte. Es hat auch vereinzelte Polizeihandlungen gegeben, die friedliche Demonstranten an Sicherheit und Ordnung zweifeln ließen. Im Internet kursieren Handyvideos von friedlichen Demonstranten, die sich die Polizei ansehen sollte.
Was raten Sie, damit sich so ein Gewaltexzess nicht wiederholt?
Auf Polizei und reine Gefahrenabwehr zu bauen wird nicht reichen. Das hat Hamburg gelehrt. Wichtig für die Prävention ist jetzt, die Gewalt nicht für politische Zwecke zu missbrauchen. Das heizt nur noch mehr an. Die Organisatoren der friedlichen Demonstration müssen sich fragen, ob sie Szenarien der Gewalteskalation mitbedacht hatten. Aber auch aus solchen Demonstrationen kann man lernen. Angesichts der wachsenden Gewalt in vielen Bereichen muss sich die Gesellschaft insgesamt viel besser aufstellen.
Interview: Holger Spierig