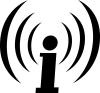Tom Strohschneider über den Backlash gegen alles Linke und einen rasenden Zug ins Autoritäre
Zugegeben: Mit welcher Dynamik die Debatte nach den Krawallen von Hamburg sich zu einem radikalen Backlash gegen alles Linke, alles Differenzierende, ja gegen eine Form von Kritik überhaupt auswachsen würde, war nicht einmal im Feuerschein der brennenden Barrikaden abzusehen.
Was seit Ende der vergangenen Woche sich in die Öffentlichkeit ergießt, ist in vielen Facetten ohne Beispiel: die empörungsgesteuerte Gleichsetzung von sich links kostümierenden Randalierern mit den tödlichen Anschlägen des IS oder einem neonazistischen Terrorismus; die Verengung des politisch Sagbaren auf Bekenntnisse pro Polizei; die Verachtung jeder differenzierenden Kritik, die als Verharmlosung oder Überläufertum gebrandmarkt wird.
Das Ganze hat inzwischen einen beängstigenden Zug ins Autoritär-Reaktionäre bekommen. Ein großer Teil der Debatte hat sich von seinem Ursprungsgegenstand entfernt, die Krawalle dienen nur mehr als Hintergrundbild, im Vordergrund läuft schon ein anderer Film. Ein gefährlicher. Da wäre unter anderem das argumentative Zusammenrücken am rechten Rand zu nennen, bei dem sich Union, Journalisten und AfD nicht nur die Begriffe in die Hand geben (Linksfaschisten, Terroristen), sondern auch eine Eskalation der Forderungen in Gang gesetzt haben, in der es jetzt schon nicht mehr für eine Schlagzeile ausreicht, bloß das Verbot der Antifa oder die Räumung aller linken Zentren zu verlangen. Was kommt als nächstes? Der Ruf nach dem Verbot linker Zeitungen? Und wer sagt, was links ist?
Ein wichtiger Aspekt dieser Radikalisierung der Debatte lässt sich mit einem Fangnetz vergleichen, das den Zwang zur Eindeutigkeit über dem Öffentlichen ausbreitet und weithin eine Wirkung entfaltet, die Spielräume demokratischer Auseinandersetzung suspendiert. Schon der ebenso banale wie wichtige Hinweis, dass es jetzt nicht nur auf einer Seite Grund zur Aufarbeitung gibt, muss mit empörter Zurückweisung rechnen: Distanziere dich erst von Gewalt!
Dass es darum aber gar nicht geht, wird nicht einmal verborgen – denn das Aussprechen der Distanzierung beendet nicht den Vorwurf. Die Funktion des Gewaltvorwurfs ist nicht auf Demonstrationskultur oder Strafrecht gerichtet, sondern darauf, eine andere Bedrohung zu überdecken: Es hat in Hamburg in Teilen eine Volte der Exekutive gegen Gerichte, gegen Grundrechte und gegen die Pressefreiheit gegeben. Das allgemeine Linken-Bashing soll davon ablenken. Damit sind weitere Probleme verbunden.
Das Kleinste: Die Debatte in der Protestbewegung darüber, wo die Grenzen linker Solidarität und Aktionsformen liegen, wird so nicht einfacher, weil es die Neigung zum abwehrenden Reflex bestärkt, wenn alle jetzt »Rock gegen Links« fordern.
Hinzu kommt: Indem hier medial angetrieben die »gute Gemeinschaft« gegen die »bösen Randalierer« angerufen wird, wächst nicht nur die vom Boulevard verkaufsträchtig angeheizte Gefahr von Selbstjustiz, wird nicht nur der ewige Kreisel der Rufe nach immer neuen Gesetzesverschärfungen am Laufen gehalten, sondern es werden auch gesellschaftliche Ursachen von Randale komplett »entnannt«. Oder anders gesprochen: Es wird alles getan, damit eine andere Antwort auf die Frage, wer und warum da überhaupt Läden plündert und Steine auf Polizisten wirft, gar nicht erst aufkommt. Ist das wirklich »Linksextremismus« oder »Randaletourismus«? Wer, wie der Politikwissenschaftler Franz Walter, einmal einen kritischen Blick auf mögliche soziale Ursachen Randale zu werfen versucht, muss mit dem Vorwurf rechnen, »auf der falschen Seite« zu stehen. So wird aber auch kritische Sozialwissenschaft, skeptische Polizeiforschung, überhaupt jede nicht dem Grundton des Backlashs folgende Betrachtung inkriminiert.
Walter hat zum Beispiel darauf hingewiesen, dass Randale in jüngerer Zeit besonders in solchen Gesellschaften zu beobachten ist, »in denen die jungen Erwachsenenkohorten dominieren und Aufwärtsmobilitäten durch massenhafte innergenerationale Konkurrenz in fiskalisch schwierigen Zeiten fraglich sind«. Klingt kompliziert, ist aber ein wichtiger Hinweis auf klassenpolitische Fragen, die man bei der Ursachenforschung nicht außer acht lassen kann.
Nicht das Vorstadtproletariat wirft Steine, sondern es dominieren »junge Leute mit Abitur und Hochschulausbildung«, für die »der Einstieg in eine sichere, materiell attraktive Berufslaufbahn versperrt ist«. Walter sagt ausdrücklich, dass das »nicht unbedingt die gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland beschreibt«. Die Notwendigkeit, sich die Frage nach dem sozialen Warum der Randale zu stellen, erübrigt sich dadurch aber nicht.Parteipolitische Konkurrenz und Wahlkampf mögen die Dynamik dieses Teils der Hamburg-Debatte zum Teil erklären. Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es die anderen Stimmen weiterhin gibt.
Aber man wird sich nichts vormachen dürfen: Wenn immer lauter dazu aufgerufen wird, sich vorbehaltlos auf die Seite der Polizei zu stellen, wenn nur noch eine kleine Opposition auf die Grundrechte pocht, wenn Versammlungsfreiheit sicherheitspolitischen Erwägungen untergeordnet wird, wenn der Gewaltbegriff nur noch zum Instrument populistischer Attacken gegen Links taugt, wenn die innere Mobilisierung damit angefeuert wird, dass die Krawalle von Hamburg mit Nazimorden und IS-Terror in eins gesetzt werden, wenn es ohne größeren Aufschrei bleibt, dass Polizei und Politiker sich eine kritische Presse verbitten, wenn Journalisten auf »schwarzen Listen« auftauchen, dann haben wir ein weit größeres Problem als das der Randale.