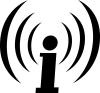Tausende junge Männer aus Nordafrika kommen jedes Jahr nach Deutschland, viele von ihnen begehen hier Straftaten und sollen abgeschoben werden. Doch die Betroffenen sträuben sich, denn auch in ihrer Heimat sind sie nicht willkommen.
Von Fiona Ehlers, Katrin Elger, Jan Friedmann, Annette Großbongardt, Wolf Wiedmann-Schmidt und Steffen Winter
Die anderen Häftlinge schlafen noch, als Samir, 36, von den Wärtern geweckt wird. Es ist 5.30 Uhr, Anfang April, die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Er muss sich leise anziehen. Polizisten mit schwarzen Sturmhauben führen den Tunesier in den Hof der Justizvollzugsanstalt Dresden.
Samirs braune Haare sind kurz geschnitten, sein Bart wächst bis hoch an die Schläfen. Er trägt eine rote Daunenweste und Jeans. Im Hof wartet ein schwarzer Mercedes-Transporter, der Wagen für seine letzte Reise durch Deutschland.
Sie fahren zum Flughafen Leipzig/ Halle, von dort soll Samir abgeschoben werden. Leipzig hat sich zu einem Drehkreuz für Abschiebungen entwickelt, mehr als 2100 Ausländer wurden von hier aus im vergangenen Jahr ausgeflogen.
Den Germania-Charterflug ST 2828, der Samir und 16 weitere Abschiebepassagiere nach Tunesien bringen soll, begleiten 67 Bundespolizisten, dazu zwei Ärzte und zwei Dolmetscher. "Germany Escort" steht auf ihren Taschen. Regelmäßig wird Terminal A für die Abschiebeflüge genutzt, für die U.S. Army war das Gate jahrelang ein Zwischenstopp, um ihre Soldaten in den Irak oder nach Afghanistan zu schicken. Jetzt sitzen hier ein paar Tunesier, schwer bewacht von der Polizei. Vor dem Eingang stehen zwei blaue Dixi-Toiletten. Wer austreten muss, bleibt in Handschellen, ein Bundespolizist lässt den Fuß in der Tür. Als sich einer über die Fesseln beklagt, wird er auf Sächsisch belehrt: "Da gib dir mal Mühe, mei Guter."
Die Beamten sind bei Tunesiern besonders vorsichtig. Viele "Schüblinge", wie sie genannt werden, wehren sich oder verletzen sich selbst, um ihre Abschiebung zu verhindern. Es gab schon einige, die den Akku ihres Mobiltelefons verschluckten, andere steckten sich Rasierklingen in die Mundhöhle oder zogen plötzlich ein Cuttermesser aus dem Gürtel. Deshalb passen immer gleich drei "Personenbegleiter Luft" auf einen Tunesier auf.
Bei der Kontrolle muss sich Samir vollständig entkleiden. Ein Arzt wird alle Körperöffnungen auf möglicherweise geschmuggelte Gegenstände untersuchen.
Danach wirkt Samir ruhig, deshalb haben sie ihm die Handschellen erspart. "In Tunesien hatte ich keine Hoffnung und keine Zukunft", erzählt er. 2008 fuhr er mit einem Schlepperboot von Libyen über das Mittelmeer nach Italien, dort lebte er ein Jahr lang und reiste dann nach Belgien, Holland und in die Schweiz. Im Mai 2014 kam er nach Deutschland und beantragte Asyl. Er habe hier ein neues Leben anfangen und arbeiten wollen, sagt Samir. Mit zwölf Jahren verließ er in Tunesien die Schule und arbeitete bei einem Friseur, sonst habe er nichts gelernt. Mit zehn habe er angefangen, regelmäßig Haschisch zu rauchen, sagte er vor Gericht.
Die Behörden lehnten den Asylantrag ab, doch abgeschoben wurde er nicht. Samir bekam eine Duldung. Er wurde Drogenhändler am Dresdner Hauptbahnhof, war abhängig von Crystal Meth und soff, jeden Tag sieben bis zehn Bier oder eine Flasche Wodka. Sein Pech: Einige der Kunden, denen er Haschisch verkaufte, waren Zivilfahnder. Im Juli 2016 verurteilte ihn das Dresdner Amtsgericht wegen mehrerer Diebstahls- und Drogendelikte zu einer Strafe von einem Jahr und neun Monaten. Seine Drogensucht, so die Prognose, werde ihn jederzeit wieder zu Straftaten verleiten.
Um 12.20 Uhr hebt Flug ST 2828 Richtung Enfidha ab. Er habe "die Schnauze voll von Deutschland", sagt Samir kurz vor dem Abflug. Sein Traum von Europa ist zu Ende.
Keine andere Ausländergruppe ist in Deutschland in den vergangenen Jahren so in Verruf geraten wie die der jungen Männer aus Marokko, Tunesien und Algerien. Nur 2,4 Prozent der Asylsuchenden kamen 2016 aus den Maghreb-Staaten, Menschen von dort stellen aber 11 Prozent der tatverdächtigen Zuwanderer. In Köln zeigten Stichproben, dass 2015 mehr als 40 Prozent der Migranten aus dem Maghreb bereits im ersten Jahr nach ihrer Einreise einen Raub oder Diebstahl verübten, sagt Kriminaldirektor Thomas Schulte, der die Ermittlungen nach den Silvesterübergriffen von Köln leitete.
Es war jene traumatische Nacht, die Deutschlands Blick auf die Flüchtlinge, die das Land zu Hunderttausenden aufgenommen hatte, nachhaltig veränderte. In jener Nacht wurde der böse Flüchtling geboren. Ein Großteil der Tatverdächtigen, die Frauen sexuell belästigt und bestohlen hatten, waren Nordafrikaner - "Nafris", wie die Polizei nordafrikanische Intensivtäter intern nennt. Auch das sorgte für Debatten, als die Polizei am jüngsten Silvesterabend in Köln Hunderte junge Ausländer kontrollierte, die sie für verdächtige "Nafris" hielt.
Vor allem in Köln und Düsseldorf kämpfen die Sicherheitsbehörden schon seit Jahren gegen Kriminelle aus Marokko, Algerien und Tunesien. Allein 2016 ermittelten sie gegen 400 Tatverdächtige aus dem Maghreb. Doch nun fiel auf, wie viele Nordafrikaner auch anderswo unter den Straftätern waren. In Sachsen kamen die meisten der Mehrfach- und Intensivtäter unter den Zuwanderern aus einem Land des Maghreb. Im Frankfurter Bahnhofsviertel dominieren Nordafrikaner den Drogenhandel, in Karlsruhe beging eine Gruppe von Migranten in kurzer Zeit so viele Diebstähle, dass dort eine "Ermittlungsgruppe Mehrfachtäter Zuwanderung" eingerichtet wurde, viele Tatverdächtige stammten von der nordafrikanischen Küste. Dass die Zahl der Straftaten in Karlsruhe inzwischen zurückgeht, führt die Polizei auch auf die sinkenden Flüchtlingszahlen zurück.
Viele der kriminellen Migranten sind Mehrfachtäter. Auch ein Marokkaner, 34, der im Dezember eine Frau in der Damentoilette einer Bar an der Hamburger Reeperbahn vergewaltigt haben soll, war vorbestraft. Doch die zuständigen Behörden sahen sich nicht in der Lage, ihn abzuschieben. Tatsächlich wurden 2016 nur 660 Algerier, Marokkaner und Tunesier außer Landes gebracht, aber fast 9000 waren ausreisepflichtig. Deshalb will die Bundesregierung nun schneller abschieben.
Vor einigen Wochen hat der Bundestag erneut das Asylrecht verschärft. So wird die Höchstdauer des Abschiebegewahrsams von vier auf zehn Tage verlängert, außerdem soll die Abschiebehaft für ausreisepflichtige "Gefährder" und ihre Überwachung erleichtert werden. Es soll verhindert werden, dass ein abgelehnter Asylbewerber wie der Tunesier Anis Amri, der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt, einen Anschlag begehen kann. Bloß, so einfach ist das nicht. Viele Nordafrikaner haben ihre Papiere verschwinden lassen, manche sind abgetaucht, die Herkunftsländer kooperieren nur widerwillig.
Deutschlands Polizisten und Behörden sind mit den Kriminellen aus den Unterschichten Marokkos, Tunesiens und Algeriens in vielerlei Hinsicht überfordert. Die jungen Männer haben häufig bereits eine kriminelle Vorgeschichte, wenn sie hier ankommen, sie waren Straßendiebe in Casablanca oder Algier oder handelten mit Drogen. "Viele haben offenbar keine Schule besucht, einige konnten noch nicht einmal ihren eigenen Namen schreiben", sagt Jörg Grethe, Leiter der Karlsruher Ermittlungsgruppe. Anders als Georgier seien die Nordafrikaner in der Regel nicht in Banden organisiert. Die Männer lernten sich meist in den Flüchtlingsunterkünften kennen.
Viele stehen unter Drogen, so die Erfahrung der Ermittler. Häufig dröhnten sie sich mit Alkohol, Marihuana und Medikamenten zu, die sie schmerzunempfindlich machten und in eine "Scheißegal-Haltung" versetzten, sagt Kripomann Schulte, der 2013 das Polizeiprojekt "Nafri" leitete, eine umfangreiche Analyse zu den Straffälligen aus den Maghreb-Staaten. Er spricht von einer "hohen Gewaltbereitschaft", rücksichtslos setzten sie bei ihren Raubzügen auch Messer ein und verletzten Opfer oder Polizeibeamte. Sie benutzten häufig falsche Identitäten, schwiegen in Vernehmungen, nur selten zeigten sie Reue. "Das offenbart eine hohe Missachtung unseres Rechtssystems", sagt Schulte.
In der Justizvollzugsanstalt Wiesbaden lebten bis Anfang 2016 mehr als ein Dutzend junge nordafrikanische Täter in Wohngemeinschaften. Doch weil sie randalierten und ihre Zimmer demolierten, mussten sie in Erwachsenengefängnisse verlegt werden. Manche hätten abgebrochene Löffel oder Glasscherben geschluckt, so die Gefängnisleitung. Vielen von ihnen scheint alles egal zu sein. Sie haben keine Perspektive in Deutschland - nicht einmal vier Prozent der Asylanträge der Marokkaner, Tunesier und Algerier werden bewilligt.
Abdul, 19, sitzt in seinen blauen Gefängnisklamotten im Besucherzimmer der Jugendstrafanstalt Wittlich in Rheinland-Pfalz. Es ist ein kleiner Raum, ein Fenster, ein paar Stühle, ein Tisch. Draußen nieselt es. Am nächsten Tag wird sich Abdul gemeinsam mit einem Syrer, dessen Identität fragwürdig ist, vor Gericht verantworten müssen. Die beiden sind unter anderem wegen räuberischen Diebstahls angeklagt. Am Trierer Hauptbahnhof sollen sie einen schlafenden Mann überfallen und ausgeraubt haben. Dabei fiel das Opfer ins Gleisbett und wurde verletzt.
Seit einem halben Jahr sitzt Abdul in Untersuchungshaft, es ist nicht das erste Mal. Er ist vorbestraft wegen Diebstahls. Beim letzten Prozess gab die Jugendrichterin dem Marokkaner noch eine Chance und setzte die Strafe auf Bewährung aus, damit er seine Ausbildung zum Metallbauer beenden kann. Sie muss Potenzial in dem Jugendlichen gesehen haben, vielleicht hatte sie auch Mitleid.
Zehn Jahre alt war Abdul, so erzählt er es, als er sein Heimatdorf in Marokko verließ. Einen halben Tag lang lief er ohne Gepäck und Geld auf einer staubigen Straße Richtung Fés, einer Großstadt im Norden des Landes. Am Anfang hatte er Angst, dass sein Vater ihn finden und verprügeln würde. Doch irgendwann wurde Abdul klar, dass niemand nach ihm suchte. Seine Stiefmutter nicht, die ihn nicht mochte, und auch sein Vater nicht, der der neuen Frau gefallen wollte. In Fés schmuggelte sich Abdul in einen Zug und fuhr an die Küste. Eine Weile lebte er auf der Straße in der Nähe der spanischen Exklave Melilla.
Irgendwann habe er Schleuser kennengelernt, die ihm einen Job verschafften: Abdul half dabei, nachts an der Grenze Zwischenwände aus Holz zu zimmern und zu bemalen, die sie dann heimlich in parkende Lkw einbauten. In dem Raum dahinter konnten sich mehrere Menschen verstecken. Wenn Polizisten die Laster ausleuchteten, fielen sie meist auf die Attrappe herein. Der Junge sah viele Marokkaner nach Europa verschwinden. "Die meisten sind jetzt in Luxemburg und haben viel Geld", glaubt er.
Irgendwann entschied Abdul, es auch zu versuchen. Er hängte sich unter ein Postauto und gelangte so auf eine Fähre nach Málaga. "Das war ein schöner Moment", erinnert er sich.
In Spanien erwischte ihn die Polizei beim Klauen, und er kam in ein Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Danach, in Frankreich, habe er meist "auf der Straße gelebt und gebettelt", sagt Abdul. Manchmal schlief er in einem Obdachlosenheim. Schließlich wollte er sich "einmal anschauen, wie es in Deutschland ist", und fuhr an einem Julitag im Jahr 2013 mit dem Zug Richtung Frankfurt am Main. Kurz hinter der Grenze, in Saarbrücken, griffen ihn Polizisten auf und brachten ihn in ein Heim für minderjährige Flüchtlinge, da war er 15 Jahre alt. Er habe kaum die Schule besucht, beherrsche aber Französisch und Spanisch "ziemlich gut", wie er sagt. Auch Deutsch habe er recht schnell gelernt. "Ich bin nicht dumm", sagt Abdul. Sven Collet, sein Anwalt, bescheinigt ihm, im Vergleich zu vielen anderen ein "gewitztes Kerlchen" zu sein. Der Pflichtverteidiger vertritt seit Jahren junge Nordafrikaner vor Gericht. "Wenn ich hier raus bin, will ich es wirklich schaffen", sagt Abdul.
Mimoun Berrissoun, 30, will straffälligen Jugendlichen helfen. Der Kölner Sozialarbeiter mit marokkanischen Wurzeln hat das mehrfach ausgezeichnete Projekt "180 Grad Wende" gegründet. Er und sein Team versuchen, junge Migranten aus der Kriminalität zu holen und zu verhindern, dass sie sich radikalisieren. Die Streetworker haben eine Beratungsstelle in Köln-Kalk und sind viel auf den Straßen unterwegs. Sie sprechen Arabisch und Türkisch und versuchen, auch mit den Nordafrikanern ins Gespräch zu kommen. "Wir kennen viele von denen, die bekannt dafür sind, Stress zu machen", sagt Berrissoun. Viele von ihnen würden erst in Deutschland für Straftaten rekrutiert. Ohne Zukunftschancen seien sie leichte Beute für Berufskriminelle.
Berrissoun würde deshalb gern ein Pilotprojekt starten mit ausgewählten Jugendlichen: "Jungs, die echtes Interesse haben." Die Idee ist ein Anreizsystem: Die jungen Männer sollen Punkte sammeln und am Ende mit dem Bleiberecht belohnt werden. Wer die Deutschprüfung besteht, bekommt einen Punkt, wer einen Ausbildungsplatz findet, auch. Ihm sei klar, dass das rechtlich kompliziert sei, sagt der Sozialarbeiter. "Aber wir müssen anfangen, neue Ideen zu entwickeln, wenn wir das Kriminalitätsproblem lösen wollen." Manche werfen Berrissoun vor, er sei sozialromantisch. "Die Alternative ist, die Jungs abzuschieben und zu warten, bis sie zurückkommen und noch schwerer zugänglich sind", sagt er. "Zu glauben, dass sich Europa abschotten könne, das finde ich naiv. Es wird niemals Staatsgrenzen ohne Lücken geben."
Auch der Düsseldorfer Sozialpädagoge Samy Charchira, der selbst in Marokko aufgewachsen ist, fordert mehr Prävention. Er appelliert an die maghrebinischen Kultur- und Sportvereine in Deutschland, sich stärker in der Jugendhilfe zu engagieren. "Sie sprechen dieselbe Sprache und kennen die Kultur und Religion der Jugendlichen", sagt er. "Sie können viel schneller an die Jungs herankommen." Natürlich gebe es Schwerkriminelle, die nicht resozialisierbar seien. "Da können auch Streetworker nichts ausrichten", sagt er. Manche Jungs brauchten aber einfach Ansprechpartner und Vorbilder, an denen sie sich orientieren könnten.
Doch viele der alteingesessenen Maghrebiner, die bereits seit Generationen in Deutschland leben, wollen mit den Problemjugendlichen aus den Armutsvierteln Marokkos oder Algeriens genauso wenig zu tun haben wie der Rest Deutschlands. Die Silvesternacht 2015 sei ein "Schock für alle gewesen", sagt Moncef Slimi, Leiter des Deutsch-Maghrebinischen Instituts für Kultur und Media. ,"Wir müssen uns besser vernetzen und neue Projekte entwickeln."
2014 startete das NRW-Innenministerium ein Präventionsprojekt in Dortmund, Köln und Duisburg. "Klarkommen" heißt die Initiative, die derzeit 70 Jugendliche betreut. Die Mentoren sprechen die Dialekte des Maghreb oder Französisch. Sie beraten die jungen Männer, helfen ihnen bei den Behörden oder beim Deutschunterricht - und sie unterstützen sie bei der Rückkehr in ihr Heimatland. Zur Erfolgsquote sagt die Behörde: Die Sprach- und Bildungsförderung zeige "gute Resultate", die Zahl der Straftaten unter den Betreuten sei "deutlich reduziert" worden.
Hätte auch Abdul aus Trier bloß mehr Hilfe und Halt gebraucht, damit er nicht mehr kriminell wird? Die traurige Wahrheit ist, dass er jede Menge Unterstützung bekommen hat.
Nachdem der Junge im Zug aufgegriffen wurde, nahm ihn das Jugendhilfezentrum Don Bosco Helenenberg auf, das vom Salesianerorden betrieben wird. Es ist eine schöne Anlage auf einem Hügel nahe Trier. Es gibt dort auch Wohngruppen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Basketballfelder, eine Kletterwand und einen Raum für Bodybuilding. Abdul ging dort in die Hauptschule, schaffte es aber nicht. "Es war zu schwer", sagt er. Es gelang ihm nicht, mit 15 Jahren plötzlich Pflichtbewusstsein zu entwickeln und jeden Morgen aufzustehen, um fast ein Jahrzehnt Schulstoff nachzuholen. Trotzdem durfte er die Lehre als Metallbauer beginnen, eine zweite Chance. Bevor er den Abschluss machen konnte, landete er im Gefängnis.
Zeitweise lebte er sogar bei einer deutschen Pflegefamilie, "die echt okay" gewesen sei. Aber auch sie konnte ihn nicht davon abhalten, zu trinken und in Schwierigkeiten zu geraten. Als Abdul diesmal vor den Richter tritt, kommt er nicht mehr so glimpflich davon wie zuvor. Das Urteil lautet, unter Berücksichtigung der Vorgeschichte, zwei Jahre und sechs Monate Jugendstrafe. "Den Angeklagten wurde von Deutschland Gastrecht gewährt, das sie nicht gewürdigt haben", sagt der Richter. "Sie müssen lernen, sich unserem Rechtssystem anzupassen." Dass sie das selbst in Freiheit schaffen, sei allerdings illusorisch, durch ihren Lebensweg seien sie in ihrer Reife verzögert.
Nun rückt auch Abduls Abschiebung näher. Er versteht nicht, warum er nicht als Flüchtling anerkannt wird; dass Perspektivlosigkeit kein Grund für Asyl ist, weiß er offenbar nicht. "Das marokkanische Generalkonsulat hat doch bestätigt, dass meine Mutter tot ist", sagt er. Die Behörden wüssten das, und trotzdem helfe ihm niemand. "Wenn man mich abschiebt, bleibe ich nicht länger als einen Tag in Marokko", verkündet er. "Was soll ich da?"
Das Königreich Marokko gilt unter den Maghreb-Staaten als politisch stabil. Anders als Tunesien, wo das Volk den Diktator Zine el-Abidine Ben Ali stürzte, führte der Arabische Frühling dort nicht zu einem Umbruch. Viele Marokkaner stehen noch immer hinter König Mohammed VI. Die marokkanische Polizei allerdings ist für ihre Härte verschrien. "Die schlagen sofort zu", sagt Abdul, "auch bei Kindern."
Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass in den Maghreb-Staaten noch immer gefoltert wird. Das geplante Gesetz, mit dem die Bundesregierung die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer einstufen wollte, scheiterte im Bundesrat. Länder mit Regierungsbeteiligung von Grünen und Linken stimmten dagegen.
Algerien ist abhängig vom Erdöl und -gas. Da die Preise in den vergangenen Jahren stark gesunken sind, hat die Wirtschaft gelitten. Mehr als zehn Prozent der Algerier sind arbeitslos, bei den Jugendlichen sind es offiziell 25 Prozent. Häufig ist die einzige Ausbildung der Kinder eine Lehre auf der Straße in Taschendiebstahl. Zudem hat das autokratisch geführte Land viele islamistische Extremisten hervorgebracht.
Auch viele tunesische Männer sehen nur zwei Möglichkeiten: entweder das Boot nach Lampedusa zu besteigen oder für den "Islamischen Staat" in den Kampf zu ziehen. Sechs Jahre nachdem sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi in Sidi Bouzid aus Protest angezündet und die Aufstände ausgelöst hat, liegt die Jugendarbeitslosigkeit in Tunesien bei 40 Prozent, in den abgelegenen Regionen auch höher. Die wirtschaftliche Misere gilt als Hauptgrund dafür, dass ausgerechnet das Musterland des Arabischen Frühlings zur Brutstätte des Terrors wurde. Aus keinem anderen Land der Welt gehen so viele junge Männer als Dschihadisten nach Syrien, in den Irak oder ins benachbarte Libyen. Die Regierung in Tunis spricht von knapp 3000, andere Schätzungen gehen von 7000 aus. Rund 800 dieser Kämpfer sollen inzwischen wieder in Tunesien leben, als tickende Zeitbomben, voller Hass auf ihre Heimat und die junge Demokratie.
Der Germania-Charterflug ST 2828 aus Leipzig landet an einem Mittwoch im April um 13.35 Uhr in Enfidha-Hammamet, 100 Kilometer südlich von Tunis - an Bord auch Samir, der abgeschobene Drogendealer aus Sachsen. Vor ein paar Jahren noch war dies ein belebter Ort, Taxischlangen säumten die palmenbestandenen Alleen, fliegende Händler boten Trockenfrüchte für die Urlauber an. Seit dem Terroranschlag am Strand bei Sousse 2015, rund 50 Kilometer weiter südlich, ist das Leben hier erloschen, das stählerne Flughafengebäude sieht aus wie ein in der Ödnis gestrandetes Raumschiff.
Tunesische Grenzpolizisten führen die Männer aus dem Flugzeug ab. In den kleinen Verhandlungsräumen entlang der endlosen Flure im Flughafen beginnt jetzt das Muskelspiel eines langjährigen Polizeistaates. Die Polizisten verhören die Rückkehrer, legen ihnen Fotos von Anis Amri und dem Attentäter von Nizza vor, fragen nach Hintermännern und wie oft sie beten. Draußen in der Ankunftshalle warten währenddessen ein paar Familien auf ihre verlorenen Söhne; es ist still, niemand spricht, die Scham über die Heimkehrer ist groß.
Nach neuneinhalb Stunden, die Sterne stehen längst am Himmel, dürfen die 17 Männer den Flughafen verlassen. Heimlich, durch einen Seiteneingang, werden sie zu einer Tankstelle gebracht, wo endlich drei der Familien ihre Söhne umarmen dürfen. Der Rest sitzt in zwei Bussen Richtung Sousse und Tunis, unter ihnen auch Samir. Kein Familienmitglied hat ihn am Flughafen erwartet.
Zwei Tage später sitzt er im Innenhof seines rosa getünchten, halb fertig gebauten Elternhauses. Er sieht blass aus, schnupft und hustet und trägt noch immer die Klamotten vom Tag der Abschiebung: Jeans, ein schwarz-grünes Sweatshirt und die knallrote Daunenweste, obwohl es 25 Grad warm ist.
Er hat das Haus noch nicht verlassen, niemand soll wissen, dass er nach neun Jahren in Europa zurück in der Heimat ist, ein Straftäter, hinausgeworfen, abgeführt von der Polizei. Noch im Frühjahr demonstrierten seine Landsleute in Tunis gegen die Rückkehrer. Auf ihren Transparenten stand in holprigem Deutsch: "Angela Merkel, Tunesien ist nicht die Abfall von Deutschland."
Nun versteckt sich Samir in dem Nest am Rande der Wüste. Schön ist es hier, Kakteen, canyonartige Felsformationen, die gelegentlich als Kulisse für Filme über den Krieg in Afghanistan dienen - und doch trügt die Idylle, es gibt keine Arbeit, jeder zweite junge Erwachsene hier hat keine Aussicht, je einen Job zu finden.
Samir stammt aus El Guettar, einer Oasensiedlung in der Nähe der Provinzhauptstadt Kafsa. Sie liegt in einem Bergbaugebiet, in dem Phosphate aus den Felsen geholt werden. Man macht Dünger aus ihnen und Waschpulver. Doch sie bringen auch radioaktive Schwermetalle ins Trinkwasser, das für die erhöhten Krebsraten in der Region verantwortlich gemacht wird.
Vor neun Jahren kam es hier zu Arbeiteraufständen, Samirs Nachbarn kämpften gegen ihre Ausbeutung, gegen den Raubbau an der Natur und das Regime des Diktators Ben Ali. Daher gilt die Kafsa-Region als Keimzelle des Arabischen Frühlings.
Samir gehörte nicht zu den Freiheitskämpfern, er machte sich lieber auf den Weg nach Europa, ein "Harraga", so nennen sie hier die Flüchtlinge, die ihre Papiere verbrennen, bevor sie das Boot nach Lampedusa besteigen.
Neun Jahre später sitzt er im Wohnzimmer seiner Eltern wie ein Fremder. Mit jedem Satz, den er widerwillig hervorpresst, wird klar, dass nichts von dem haltbar ist, was er in Leipzig vor seiner Abschiebung behauptet hat. Zwei Taxis habe er sich in der Heimat von seinen Einkünften angeschafft, das Geschäft wolle er künftig ausbauen. Er sehe seine Zukunft in der Selbstständigkeit. Und eine Familie wolle er gründen. Es waren, ganz offenkundig, die Worte eines Aufschneiders.
Noch prahlt er von seiner Zeit als Drogendealer. Es sei "ein geiles Leben" gewesen, "voller Drogen, Geld und Frauen", sagt er, und: "Was hätte ich denn anderes tun sollen, man ließ mich ja nicht arbeiten." Er habe selbst zwei Jahre lang Drogen genommen und deshalb keine Skrupel gehabt, das Zeug zu verkaufen: "Mich hat es doch auch nicht umgebracht, wenn ich es nicht verkaufe, tut es ein anderer."
Spätestens als seine Mutter das Wort ergreift, eine resolute Frau Ende fünfzig mit einem braunen Tuch um den Kopf, wird klar, dass Samir als Versager zurückkehrt - und seine Familie ihm das nicht verzeiht. Die zwei Taxis hat es nie gegeben. Auch den Anbau des Elternhauses hat nicht er bezahlt, sondern sein Bruder. Der schickt monatlich Geld, das er legal als Koch in Thüringen verdient.
Samir, so scheint es, ist schon immer den Weg des geringsten Widerstands gegangen, früher in Tunesien und später als Drogendealer in Zürichs Rotlichtviertel und am Dresdner Hauptbahnhof. Er hat kaum Deutsch gelernt in neun Jahren, schaut einem nicht in die Augen, ist voller Wut und herrscht seine Mutter an, sie solle nicht mit den Fremden sprechen.
Niemand hat hier auf seine Rückkehr gewartet. "Mehrere Tausend Dollar mussten wir uns von den Nachbarn für deine Flucht leihen, wir schulden sie ihnen bis heute", schimpft seine Mutter. "Und du wagst es, mit nichts nach Hause zu kommen? Was für eine Verschwendung."
Das deutsch-tunesische Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration liegt im Gebäude der tunesischen Arbeitsagentur in der Hauptstadt. Entwicklungsminister Gerd Müller hat es im März eingeweiht.
Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit kümmern sich in dem kleinen Büro seit knapp drei Monaten um die Jobvermittlung von Tunesiern und Rückkehrern aus Europa. Sie bieten ihnen Umschulungen und Fortbildungen an. Zudem werden Ausreisewillige über legale Möglichkeiten der Jobsuche und ein Studium in Deutschland informiert. Für Männer wie Samir gilt das aus Deutschland mitfinanzierte Angebot nicht: Beraten werden nur freiwillige Rückkehrer, keine Kriminellen.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge plant zudem, bald Jugendheime in Marokko zu errichten, in die ausreisepflichtige minderjährige Migranten zurückkehren könnten, auch Straftäter. In erster Linie seien die Einrichtungen aber für Straßenkinder gedacht, heißt es in einem Papier. In den Unterkünften soll es eine Schule und medizinisch-pädagogische Betreuung geben. Die Grünen kritisieren die Pläne, weil sie die Abschiebung von Minderjährigen beförderten.
Innenminister Thomas de Maizière drängt die nordafrikanischen Staaten seit der Silvesternacht von Köln zu mehr Kooperation. Jahrelang verzweifelten die Behörden an dem Versuch, abgelehnte Asylbewerber in den Maghreb abzuschieben. Oft fehlten die Papiere, und die Herkunftsländer hatten keine Eile, Ersatzpässe auszustellen. Oder sie behaupteten schlicht: Der ist keiner von uns.
Im Februar 2016 flog de Maizière mit einer Delegation nach Nordafrika. In Tunis, Algier und Rabat schüttelte er die Hände von Innenministern und Regierungschefs. Danach wurde es zwar ein bisschen besser. Aber wie der Fall Anis Amri zeigt, verzögerten die nordafrikanischen Behörden in vielen Fällen immer noch die Rücknahme ihrer Staatsbürger. Bei Amri verhinderten die Tunesier monatelang eine Abschiebung, indem sie keine Papiere für ihn ausstellten. Erst am 21. Dezember 2016 bestätigte das Generalkonsulat in Bonn, dass Amri Tunesier sei - zwei Tage nachdem er zwölf Menschen ermordet hatte.
Ob die Tunesier nun ein schlechtes Gewissen plagt oder die subtilen Drohungen nach dem Anschlag Wirkung zeigen: Fakt ist, dass das Land in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits 50 Landsleute zurückgenommen hat - im Vorjahreszeitraum waren es gerade mal 8. Nach Marokko und Algerien konnten 207 Menschen abgeschoben werden, mehr als elfmal so viele wie im ersten Quartal 2016. Die Zusammenarbeit mit den Maghreb-Staaten bei Abschiebungen von Gefährdern habe sich erheblich verbessert, sagt das Innenministerium nun.
In El Guettar ist es inzwischen Nachmittag geworden. Der Muezzin ruft zum Gebet, und Samir verheddert sich in wirren Theorien. Anis Amri habe gar nicht am Steuer des Lkw gesessen, der in den Berliner Weihnachtsmarkt steuerte, das sei alles nur eine "große Verschwörung", um "solche wie mich zurück nach Tunesien zu schieben". Er sei "fertig mit Europa", sagt Samir. Dann schnappt er die rote Daunenweste und stürmt zur Tür hinaus, ohne ein weiteres Wort. Welche Zukunft hat er in Tunesien? Seine Familie wird vorerst für ihn aufkommen müssen. Nur einmal, sagt seine Mutter, sei er zu etwas nütze gewesen: als er seiner kranken Schwester eine Niere spendete.
Nun tröstet sich Samirs Mutter mit dem Gedanken, dass er wenigstens nicht zum Islamisten geworden ist.