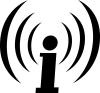In Deutschland angekommen dachten sie: Jetzt wird alles besser. Doch für viele Frauen beginnt in den Unterkünften ein neuer Leidensweg. Sie berichten von Übergriffen - durch Personal und eigene Partner.
Von Yasmin Polat und Pascale Müller, Daria Sukharchuk
Wenn Sally Abazeed Angst hat, dann kann sie sich nicht wehren. Wenn Sally traurig ist, dann kann sie sich nicht bewegen, nichts sagen.
Das wissen die Männer um sie herum. Die in den Uniformen der Sicherheitsfirma und die in den Betten nebenan. Die Männer kommen dann und tun so, als ob sie ihr helfen wollten. Umarmen sie. Fassen sie an. Aber das ist keine Hilfe, das ist etwas anderes.
Als Sally besonders traurig ist, will sie raus. Raus aus der Notunterkunft mit den hunderten Menschen, raus aus dem Geruch und der Enge. Doch an der Pforte sagen ihr die Mitarbeiter, dass sie die Unterkunft nicht alleine verlassen soll. Da ein Kollege des Sicherheitsdiensts sich aber gerade einen Döner holen will, bietet er an, Sally mitzunehmen.
Sally denkt: Wow, der wird mich beschützen.
Aber auf dem Weg sagt er: „Sag dem Lageso, dass du zu mir ziehst.“
Dann: „Kann ich deine Nummer haben?“
Dann: „Ist dir kalt?“
Er zieht ihre Hand zum Mund und küsst sie. Zurück im Heim fragt er immer wieder nach ihrer Nummer, wochenlang stellt er ihr nach.
Ihr Schicksal ist kein Einzelfall
Sallys Schicksal ist kein Einzelfall, auch wenn seitens Berliner Behörden immer wieder bekräftigt wird, dass sexualisierte und häusliche Gewalt gegen geflüchtete Frauen kein großes Problem sei. In den letzten anderthalb Jahren ging es vor allem darum, den vielen Flüchtlingen, die in Berlin und Deutschland Zuflucht suchten, ein Dach über dem Kopf zu organisieren. Dabei dachte kaum jemand an die Gefahren, die geflüchteten Frauen auch in Deutschland drohen. Erst langsam wird klar, wie schwerwiegend sich die Situation in den Unterkünften auf ihre Sicherheit auswirkt.
In den letzten sechs Monaten haben wir mit einem Dutzend Frauen wie Sally gesprochen. Die vor Angst, nachts alleine auf die Toilette gehen zu müssen, so lange einhalten, bis sie Blasenschmerzen bekommen. Deren Männer auf der Flucht gewalttätig geworden sind. Die von anderen Bewohnern ungefragt berührt, von Sicherheitskräften bedrängt werden. Denen ein Heimleiter versucht, ihr Kopftuch herunterzureißen. Die gegen ihren Willen geküsst und betatscht werden, vor allem, wenn sie alleinstehend sind.
Sexualisierte und häusliche Gewalt, auch Belästigung, betrifft alle Frauen, aber geflüchtete Frauen besonders, weil Not- und Gemeinschaftsunterkünfte kein sicherer Ort für Frauen und Mädchen sein können. 404 015 Frauen haben seit 2015 in Deutschland erstmals einen Asylantrag gestellt, deutlich weniger als männliche Antragsteller. Und im Gegensatz zu Männern sind diese Frauen nicht nur von Heimleitung, Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern abhängig, sondern auch von ihrem Partner, der häufig den Asylantrag stellt. In Berliner Not- und Gemeinschaftsunterkünften leben laut Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) derzeit 31 032 Geflüchtete (Stand: März 2017). Wie viele davon Frauen sind, wird nicht erfasst.
Diese Frauen sind besonders gefährdet und gelangen schlechter an Hilfe, wenn ihnen bereits etwas passiert ist. Weil sie aufgrund von fehlenden Deutschkenntnissen kaum Zugang zu Beratungsstellen oder Frauenhäusern haben. Weil sie oftmals ihre Rechte nicht kennen. Aber vor allem, weil sie an einem Ort leben, an dem Türen nicht abschließbar sind, wo Bettlaken Zimmerwände ersetzen und Sicherheitsmitarbeiter sich überall Zutritt verschaffen können.
Sie lebt in ständiger Angst
Aus einer schriftlichen Umfrage, die wir an ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter verschickt haben, geht hervor, dass das Thema Gewalt gegen Frauen viele von ihnen beschäftigt. Obwohl die Angaben keine statistische Aussagekraft haben, werden typische Probleme sichtbar. So schreibt etwa eine ehrenamtliche Helferin von Tempelhof Welcome: „Ein Mann ist nachts in das Zimmer einer Frau eingedrungen und wollte Sex. Die Frau konnte ihn abwehren.“ Der Täter wurde der Unterkunft verwiesen, doch an den Zuständen dort habe sich wenig geändert. Die Frau lebe seitdem in ständiger Angst.
Angesprochen auf Gewaltvorfälle gegen Frauen in Berliner Flüchtlingsunterkünften sieht Sascha Langenbach, Pressesprecher des LAF, kein großes Problem. Auf Nachfrage antwortet er: „Nach meinem Kenntnisstand nach zahlreichen Gesprächen mit Betreibern kann ich Ihnen versichern, dass eine auffällige Häufung in Not- oder Gemeinschaftsunterkünften nirgendwo berichtet wird.“ Wenn es Konflikte gebe, so Langenbach, dann in der Regel zwischen jungen Männern.
In den Statistiken der Berliner Polizei tauchen kaum Fallzahlen auf. So gab es laut Polizei im Jahr 2016 nur zehn „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ von Frauen in Flüchtlingsunterkünften. Nach der Kölner Silvesternacht begann die Polizei auch „Beleidigung auf sexueller Grundlage“ als Delikt in die Statistik aufzunehmen. Auch hier sind die gemeldeten Fälle, in denen Frauen in Geflüchtetenunterkünften die Geschädigten sind, verschwindend gering: Lediglich zwei Fälle wurden im dritten Quartal 2016 gemeldet.
Doch um in dieser Statistik überhaupt aufzutauchen, muss eine Frau ihre Unterkunft alleine verlassen, einen Dolmetscher und vor allem den Mut für eine Aussage finden. Bei den meisten stellt das eine so große Hürde dar, dass Frauenberatungsstellen bei sexualisierter Gewalt von hohen Dunkelziffern ausgehen. Für geflüchtete Frauen ist es daher umso wichtiger, dass die Hilfe zu ihnen kommt, so wie die mobile Beratung von Lara es tut, einem Krisen- und Beratungszentrum für vergewaltigte und sexuell belästigte Frauen. Lara berät Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, auch unabhängig davon, ob der Vorfall zur Anzeige gebracht wird oder nicht. Seit Herbst 2016 gibt es zwei Beraterinnen, die sich um Geflüchtete kümmern.
Sie haben von Oktober bis Dezember vergangenen Jahres 190 Frauen in Unterkünften beraten, die alle Opfer von Gewalt wurden. „Drei Viertel davon waren Fälle von sexualisierter Gewalt“, sagt die Sozialarbeiterin Elnaz Farahbakhsh. Ihre Kollegin von der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (BIG) hat, seitdem sie ihre Arbeit im November vergangenen Jahres aufnahm, 84 Beratungen durchgeführt. Lara B. sagt: „Das ist ungewöhnlich viel.“
Auch Sally saß im vergangen Jahr auf dem blauen Sofa der Beratungsstelle. Ihr gegenüber in einem geräumigen Zimmer in einem Schöneberger Altbau die Frau, der sie sich anvertrauen möchte, auf dem Tisch ein Glas Wasser und eine Packung Taschentücher. Die Frau drängt nicht, sie lädt Sally erst einmal ein, anzukommen, kurz durchzuatmen. Wie viele Frauen, die Gewalt erlebt haben, wählt Sally ihren Platz so, dass sie die Tür im Blick hat. Sie trinkt einen Schluck aus dem Glas. Dann fängt sie an, leise und auf Englisch.
Vor diesem Besuch bei Lara war Sally schon bei der Polizei und bei einem Arzt. Zweimal wurde ihr gesagt, dass man ihr nicht helfen könne. Dreimal hat sie deshalb versucht, sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen, weil sie so verzweifelt war.
„Es war alles so unfair“, sagt sie später. „Mir war etwas Schlimmes passiert, ich habe aber keinen Therapieplatz gefunden. Ich wusste nicht, wer mir helfen kann.“
Sie fragt, bevor sie flucht
Sally geht und spricht wie ein Mensch, der immer auf der Hut ist. Leise und vorsichtig, aber mit fester Stimme und ohne innezuhalten. Sie fragt immer, bevor sie flucht. Ihre arabischen Nudelgerichte kocht sie mit großen Mengen Knoblauch und lässt sie kalt werden, während sie in aller Seelenruhe Teller und Besteck auf dem Tisch verteilt.
Meistens sitzt sie abends auf ihrem Bett, schaut die Sterne an, die sie an ihre Decke geklebt hat und die den kleinen Raum erleuchten. Dann schreibt sie ihren Freunden auf Facebook Nachrichten, garniert mit aberwitzigen Emoticons, und hört syrischen Pop.
Es war im September 2016, als sie in ihrem Bett lag und alle Tabletten schluckte, die sie angesammelt hatte. Sie wohnte da schon in einer WG, ihr Zimmer mit nur einem Fenster befand sich am Ende einer steilen Treppe. An jenem Tag war es dort wie in einer dunklen Höhle, die sie einsaugte. Auf dem Teppich verstreut lagen leere Packungen von starken Schmerz- und Schlafmitteln, die ihr verschiedene Ärzte wegen ihrer Panikattacken verschrieben hatten. Als ihre Mitbewohner sie fanden, reagierte Sally schon nicht mehr. Sie riefen den Rettungswagen.
Drei Tage später liegt sie in einem Bett der psychiatrischen Notaufnahme des Vivantes-Klinikums in Neukölln. Ihr Haar orange, die Hennafarbe hat auf das weiße Kopfkissen abgefärbt. Sie sieht unendlich müde aus. Auf dem Bett sitzt ein großes Plüscheinhorn, dass ihre Mitbewohner ihr in der Nacht mitgegeben haben. Sie drückt es fest an sich.
Sally kommt aus Damaskus, ist 21 Jahre alt. Ihre Haarfarbe wechselt jeden Monat. Ihre Familie hat sie nicht mehr gesehen, seitdem sie Syrien verlassen hat. Für ihre Eltern war es ein Problem, dass sie nicht gläubig ist. Geflohen ist Sally aber, weil sie als bisexuelle Frau in Syrien nicht sicher war.
Flashbacks und Panikattacken
Weil sie alleine nach Deutschland kam, hat sie niemanden, der sie unterstützt. Sie sagt noch heute: „Ich habe das Gefühl, dass ich nicht existiere.“ Besonders an ihren ersten Abenden in den Notunterkünften ist es schlimm, sie bekommt Panikattacken. Kann sich nicht mehr bewegen, kann nicht sprechen. Es ist, als ob sie einfriert, erstarrt wie eine Puppe.
Dabei kennt sie sich eigentlich als fröhlichen Menschen, probiert gerne Neues aus, ist mutig. Als eine Bekannte sie vor der Überfahrt von der Türkei nach Griechenland im Stich lässt, fährt sie alleine los. Auf sich allein gestellt, fühlt sie sich verloren. In Berlin, wo die Angst ein Ende haben sollte, zeigt sie Symptome einer traumatischen Belastungsstörung, da kommen die Panikattacken irgendwann jeden Tag.
Männer um sie herum merken, wie verletzlich sie ist. Nutzen es aus, um sie zu berühren, sie zu streicheln, gegen ihren Willen. Sally ist vor Angst wie gelähmt, ist kaum bei sich, während fremde Männer sie betatschen. „Frauen, die Gewalt erlebt haben, sind traumatisiert“, sagt Elnaz Farahbakhsh, „sie haben Flashbacks oder Panikattacken.“ Es bedeute, dass sexuelle Übergriffe, die sie an frühere Ohnmachtserfahrungen erinnern, sie komplett zurückwerfen und paralysieren.
Auch Sally will raus aus dem Heim, egal wie. „Alles war nur noch scheiße“, sagt sie.
Sally erzählt von einem Abend in der Notunterkunft der Darßerstraße, an dem sie in einer Toilettenkabine sitzt und in ihrem Tagebuch schreibt. Ein Sicherheitsmitarbeiter kommt erst in den Waschraum und schaut dann über die Kabinentür, fragt, was sie dort treibe. Es gibt keinen Ort, an dem sie alleine, an dem sie sicher ist.
In vielen Unterkünften, denen mit einzelnen Zimmern, haben die Security-Mitarbeiter Generalschlüssel. Aus Brandschutzgründen. Doch sie schließen Türen auch dann auf, wenn es dahinter nicht brennt.
Die Berliner Wissenschaftlerin Nivedita Prasad kritisiert diesen Zustand. Sie lehrt an der Alice-Salomon-Hochschule und forscht zu menschenrechtsbasierter sozialer Arbeit mit Geflüchteten. Prasad erzählt von einem Fall, in dem ein Security-Mitarbeiter in einem Heim der damaligen Betreiberfirma Pewobe das Zimmer einer Frau betrat, die nur in ein Handtuch gewickelt war. Der Mann hatte zwar geklopft, die Frau ihn aber nicht gehört. „Da muss ich keine Kopftuchträgerin sein, um entsetzt zu reagieren“, sagt Prasad.
Privatsphäre gibt es für viele geflüchtete Frauen nicht. Besonders zeigt sich das anhand der Sanitäranlagen. Alle Frauen, mit denen wir gesprochen haben, fürchten sich vor dem Toilettengang. Zina, 49, eine Bewohnerin der Notunterkunft Tempelhof, sagt: „Ich habe oft starke Schmerzen, weil ich nachts nicht auf die Toilette gehen will. Ich fürchte mich.“ Andere bitten ihre Kinder, mit ihnen zu gehen oder sich für die Dauer ihrer Abwesenheit im Zimmer einzuschließen. Manchmal liegen die Toiletten auch außerhalb des Heims.
„Wir können in Not- und Gemeinschaftsunterkünften von einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer sexuell motivierter Übergriffe ausgehen“, sagt Claudia Kruse. Die Therapeutin des Zentrums für Überleben meint, das Problem sei „nicht neu, es hat sich durch die Notunterkünfte nur verschärft“. Die Frauen berichten in der Therapie von unsittlichen Berührungen, von Männern, die in ihrer Gegenwart anzügliche Geräusche machen, die sie anglotzen oder ihnen nachstellen.
Der Heimleiter wurde handgreiflich
In der Notunterkunft Gürtelstraße in Friedrichshain spitzte sich die Situation vor einem Jahr zu. Der Verein Friedrichshain Hilft, der dort aktiv war, wandte sich am 16. März 2016 schriftlich an das LAF, um eine Vielzahl von Missständen zu beklagen. Unter anderem heißt es in dem Schreiben, dass weibliche Bewohnerinnen wegen ihrer Kopftücher angegangen wurden. In einem Fall sei der Heimleiter gar handgreiflich gegen die Frauen geworden, indem er ihnen ihre Kopfbedeckung habe herunterziehen wollen. Des Weiteren seien an einem Abend die an den Betten von Frauen als Sichtschutz aufgehängten Tücher entfernt worden. Eine Bewohnerin soll sich unter Tränen an eine Helferin gewandt und um Hilfe gebeten haben wegen anhaltender Verbalattacken. Zusammenfassend heißt es, die Bewohnerinnen hätten sich „häufig massiv belästigt“ gefühlt.
In der Folge fanden zwar Kontrollen der Notunterkunft statt, doch diese sollen Vereinsvorstand Thomas Barthel zufolge mehr oder weniger angekündigt gewesen sein. Der umstrittene Heimleiter ließ sich von Bewohnerinnen per Unterschrift bestätigen, dass sie zufrieden mit ihm seien. Der Helferverein glaubt, dass diese Unterschriften durch Drohungen erzwungen wurden, indem man die Betreffenden glauben machte, sie würden der Turnhalle verwiesen und in die Tempelhofer Hangars geschickt. Belege gibt es dafür nicht.
Im Herbst 2016 schlägt eine Ärztin, die ebenfalls in der Gürtelstraße aktiv ist, Alarm. Nachdem ihr zugetragen wurde, dass Personal sich mit Mädchen in den Schiedsrichterkabinen der Turnhalle eingeschlossen habe, meldet sie den Fall dem Referat für Qualitätsmanagement des LAF. Sie sagt heute darüber: „Was genau da drinnen passiert ist, kann niemand sagen, weil man es einfach nicht weiß.“ Versuche, einen der Betroffenen ausfindig zu machen, blieben erfolglos.
Auch die Mitarbeiter von Friedrichshain Hilft verfassen im Oktober 2016 ein erneutes Beschwerdeschreiben an das LAF. Daraufhin wird die Behörde aktiv, schenkt auch den Beschwerden über den Umgang mit Helferinnen und Bewohnerinnen Glauben. Es gibt ein Mediationsgespräch, in dem der Heimleiter mit sofortiger Wirkung den Dienst quittiert. Kurze Zeit später wird die Unterkunft geräumt. Den betroffenen Frauen wurden nach eigenen Angaben keine Beratungsangebote vermittelt. Auch gab es seitens des LAF keine Bestrebungen, zu klären, wie viele Frauen in der Unterkunft belästigt wurden. Was das LAF dementiert: „Aussagen hinsichtlich einer sexuellen Belästigung durch einen Beschäftigten waren mangels valider Zeugenaussagen nicht hinreichend belegt“, erklärt es, „respektive wurden sogar im Gespräch mit einem vermeintlichen Opfer zurückgezogen.“
Auch eineinhalb Jahre nach dem chaotischen Sommer 2015 hängt deshalb noch immer das meiste vom Willen und Können des Betreibers ab. Im Februar 2017 haben die wenigsten Unterkünfte ein Gewaltschutzkonzept, obwohl das Entwickeln eines solchen mittlerweile vertraglich festgeschrieben ist. „Beratungen untergebrachter Frauen zu Schutzangeboten vor häuslicher und sexueller Gewalt sowie zum Thema Gleichberechtigung der Geschlechter“ sind Bestandteil von Musterverträgen.
Sexualisierte Gewalt wird nicht thematisiert
Doch wie genau die Einhaltung dieser Leistungen kontrolliert wird, ist nicht klar, genauso wenig, wie die Sanktionen aussehen. Und es fehlt noch an etwas viel Wichtigerem. „Ich glaube, in erster Linie ist die Unterbesetzung das Problem. Geflüchtete Frauen brauchen eben viel mehr Begleitung“, sagt Elnaz Farahbakhsh von Lara. In vielen Unterkünften aber sind besonders am Wochenende nicht genügend Mitarbeiter und noch weniger Mitarbeiterinnen vor Ort. Außerdem sind die meisten von ihnen nicht ausreichend geschult, um auf Vorfälle sexualisierter oder häuslicher Gewalt zu reagieren oder sie überhaupt zu erkennen.
Eine ehrenamtliche Helferin in einer Notunterkunft des Deutschen Roten Kreuzes schreibt: „Sexualisierte Gewalt wird meiner Erfahrung nach vonseiten der BetreiberInnen nicht thematisiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass engagierte Mitarbeiterinnen, die die Situation von Frauen verbessern wollen, von der Leitung sogar ausgebremst wurden. Ich vermute, die Leitung möchte so Missstände in den Unterkünften vertuschen.“
Diesen Eindruck teilen auch andere Helfer, mit denen wir gesprochen haben. Statt Aufklärung zu betreiben, verpassen einige Betreiber Sozialarbeitern einen Maulkorb, Bezirke und das LAF versuchen, problematische Unterkünfte eher schnell zu schließen, als Übergriffe oder permanente sexuelle Belästigung gegenüber Bewohnerinnen – wie im Fall der Notunterkunft Gürtelstraße – aufzuarbeiten. Betroffene Frauen geben an, nicht an Beratungsstellen weitervermittelt worden zu sein.
Auch für Sally ist die größte Hürde, Hilfe zu finden. Als sie es in der Unterkunft nicht mehr aushält, sucht sie in einer Facebook-Gruppe Rat, die von Syrern wie ihr selbst genutzt wird. Ein junger Mann in Hamburg erzählt ihr von einer Frau, die Geflüchtete bei deutschen Familien unterbringt. Am 16. Januar 2016 kauft sie eine Fahrkarte für den Fernbus nach Hamburg. Noch bevor sie am Busbahnhof eintrifft, schreibt ihr der Syrer, dass die Frau, die ihr helfen wolle, gerade in Frankreich sei. Aber sie könne so lange bei ihm unterkommen.
In seiner Wohnung versucht er sich ihr immer wieder zu nähern. Er fasst sie an, sie zieht sich in ein anderes Zimmer zurück. Er versucht es wieder. Sie bekommt Angst, und wie immer, wenn sie Angst bekommt, wird sie ganz starr. Sie denkt: Ich weiß nicht, wie ich wieder nach Berlin komme, es ist Nacht, ich warte einfach, bis es vorbei ist. Aber es bleibt nicht bei Berührungen. Am Morgen vergewaltigt er sie. Dann sagt er ihr, wie sie zum Busbahnhof kommt, und setzt sie vor die Tür.
Sie reden ihr ein, dass alles ihre Schuld sei
Zurück in Berlin merkt erst niemand, dass ihr etwas zugestoßen ist. Für eine Nacht kommt sie bei Bekannten unter, die ihr einreden, dass alles ihre Schuld sei. Erst nach zwei Tagen ermutigt eine deutsche Freundin sie, ins Krankenhaus zu gehen, doch dort schickt man sie zur Polizei. Damit ist Sally eine der wenigen Frauen, die eine Vergewaltigung anzeigen. Heute sagt sie: „Ich wünschte, ich hätte es nicht getan.“
Sally fühlt sich von den Beamten nicht ernst genommen. Die fragen sie immer wieder, warum sie sich nicht gewehrt oder die Wohnung verlassen habe. Sie sagt, sie habe sich nicht bewegen können, sei wieder wie eingefroren gewesen, habe nicht gewusst, wo sie hätte hingehen sollen, in einer fremden Stadt, in einem fremden Land, wo sie doch die Sprache nicht versteht. Die Polizisten schicken sie nicht weiter zu einer Beratungsstelle, sondern zurück nach Tempelhof.
Wieder ist es die engagierte Freundin, die sich mit ihr hilfesuchend an Lara wendet. Eine Anwältin, die ihr durch Lara vermittelt wird, sieht wenig Aussicht auf eine erfolgreiche Klage, der Fall wird geschlossen. Doch für Sally ist nichts geschlossen und nichts vorbei. Ihre Freundin vermittelt ihr eine Bleibe im SOS-Kinderdorf in Moabit. Dort ist sie sicher, aber ganz allein. Sie hat jetzt, wie sie bei einem Treffen in jener Zeit erzählt, jede Nacht Albträume. Das Schlimmste für sie: „Ich habe irgendwann selbst geglaubt, dass ich daran schuld bin. Die wollen eine Frau mit vielen blauen Flecken sehen, eine, die sich gewehrt hat, die festgebunden wurde – sonst ist es keine Vergewaltigung.“
Dabei ist sich Sally sicher: Wäre es in Tempelhof nicht so unerträglich gewesen, wäre sie niemals nach Hamburg gefahren und vergewaltigt worden.
Doch es sind nicht nur fremde Männer, die für die Frauen gefährlich werden. Auch der eigene Partner wird nach einer Flucht oft gewalttätiger. „Viele Frauen haben schon vorher häusliche Gewalt erfahren, aber für alle ist es durch die Flucht schlimmer geworden“, sagt Sarah Trentzsch von BIG. So auch bei Bahar Abdallah, die im Januar 2015 aus Syrien nach Berlin kam und in Wirklichkeit unter einem anderen Namen in Deutschland lebt. In den 17 Jahren, die sie mit ihrem Mann verheiratet war, hatte er sie immer wieder geschlagen. Doch so schlimm wie jetzt in Deutschland war es noch nie.
Eines Abends wollen Bahar, ihr Mann und die drei gemeinsamen Kinder zu einer Hochzeit. Bahar schminkt sich, zieht sich an. Sie ist eine Frau, die Jeans trägt und gerne ihren eigenen Haarsalon eröffnen würde. Ihr Mann macht abfällige Bemerkungen, sagt, sie sehe aus wie eine Prostituierte. Bahar bleibt ruhig – sie will nicht streiten, keinen Skandal unter den Augen der anderen Heimbesucher verursachen. Als sie von der Hochzeit zurückkehren, prügelt ihr Mann auf sie ein. „Er hat mich überall geschlagen“, sagt die 30-Jährige. „Auch in den Nacken. Ich bin auf den Boden gefallen.“ Dann kommen Security-Mitarbeiter ins Zimmer und bringen den Mann weg.
Seither lebt er ein Haus weiter. Die Kinder sieht er regelmäßig. Immer wieder droht er, Bahar umzubringen. Die versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Ohne die Begleitung von Security-Kräften kann er sie nicht mehr besuchen. „Aber er ist immer noch sehr nah.“
Ihrer neunjährigen Tochter sagt sie, dass sie sich im Zimmer einsperren soll. Denn auch vor den anderen Männern in der Unterkunft hat Bahar Angst. Diese Angst geht so weit, dass sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Während eines Treffens in einem Café am Kurt-Schumacher-Platz sagt sie immer wieder: „Ich habe Angst um meine Kinder.“
Es bräuchte ein richtiges Gewaltschutzkonzept
Auch wenn ein Vorfall von häuslicher Gewalt der Heimleitung bekannt und der Mann der Unterkunft verwiesen wird, bleibt der Partner häufig im unmittelbaren Lebensumfeld der Frau. Um ihn dessen zu verweisen, bräuchte es ein richtiges Gewaltschutzkonzept. „Eines, das parteiisch für die Frauen ist“, sagt Forscherin Prasad. Sie weiß von Fällen, in denen der Täter mit Security-Männern befreundet war. Sein Hausverbot wurde der Security nicht mitgeteilt, am Wochenende war kein weiteres Personal da. „Da kam der Mann wieder in die Unterkunft und hat die Frau verprügelt.“
Bahar ist nicht geschieden. Frauen wie sie sind in einer Zwangslage, denn sie wissen nicht, was im Falle einer Anzeige oder Scheidung mit ihnen passiert. Zu groß ist die Sorge, abgeschoben zu werden, wenn der Asylgrund beim Ehemann liegt. Zu stark der emotionale Druck, dafür verantwortlich zu sein, dass der eigene Partner oder Vater der Kinder womöglich in ein Kriegsgebiet zurückgeschickt wird.
„Die Frauen denken: Wir haben doch zusammen den Asylantrag gestellt – wenn ich ihn wegen Gewalt verlasse, muss er zurück“, erklärt Prasad. In vielen Fällen ist das eine Fehleinschätzung: Nach Syrien wird zurzeit niemand abgeschoben, im Unterschied etwa zu Afghanistan. Trotzdem geht die Angst vor aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen so weit, dass geflüchtete Frauen sich niemandem anvertrauen: keiner Beratungsstelle, keiner Vertrauensperson, keiner anderen Frau. Das macht es für geflüchtete Frauen umso wichtiger, die eigene aufenthaltsrechtliche und familienrechtliche Situation in einem Beratungsgespräch klären zu können. Nur mit dem Wissen um ihre eigenen Rechte fühlen sie sich ausreichend gestärkt, um aus Gewaltbeziehungen auszubrechen, Täter zu benennen und Schutz einzufordern. Es sei wichtig, die Akten und Sozialleistungen schnell zu trennen, so Lara-Beraterin Elnaz Farahbakhsh. „Das muss gleich in den ersten Wochen passieren, da es ein riesiger behördlicher Akt ist.“
Sie fordert ein verbessertes Beschwerdesystem
Doch auch freiwillige Helfer und Ehrenamtliche wissen oft nicht genug über die rechtliche Situation der Geflüchteten, wie uns verschiedene Freiwillige berichten. Das liegt unter anderem daran, dass Gewaltschutz und Asylrecht in der Praxis nicht ausreichend verknüpft sind. In Berlin gibt es Anwälte, die sich in Sachen Gewaltschutz auskennen, und solche, die sich auf Asylrecht spezialisiert haben. Nur wenige sind in beiden Themengebieten erfahren.
Berliner Frauenberaterinnen sind sich einig: Es bräuchte mehr Unterkünfte, die ausschließlich für Frauen da sind, besser noch abschließbare Wohneinheiten mit eigenem Bad. Zusätzlich fordert Prasad ein verbessertes Beschwerdesystem. Unabhängig müsste es sein, leicht zu kontaktieren und bekannt unter den Bewohnerinnen. Die Ombudsperson sollte eine Frau sein und der Beschwerdeweg transparent gemacht werden. Die Briefkästen selbst müssten allerdings sichtgeschützt und außerhalb der Unterkunft angebracht sein – sonst fürchten Bewohner, von anderen beim Einwurf beobachtet zu werden. Bei Testläufen, bei denen sich Bewohner auch über Whatsapp melden konnten, beschwerten sich in kurzer Zeit viele Menschen über Heimleitung und Security.
Wer aber eine Rolle als Beschwerdeinstanz einnehmen könnte, bleibt unklar. Denn es bräuchte die politische Macht, etwas an den Verhältnissen zu ändern, um das Verfahren effektiv zu machen.
Sally ist sicher, dass sie sich schon viel früher an jemanden gewendet hätte, wenn da eine unabhängige Person gewesen wäre, der sie hätte vertrauen können: „Aber in dem ersten Heim von den dreien, in denen ich war, gab es nicht einmal Sozialarbeiterinnen.“
Mehr als jede zehnte geflüchtete Frau hat Selbstmordgedanken
Ist einer Frau wie ihr bereits etwas zugestoßen, egal ob in der Unterkunft oder auf der Flucht, benötigt sie dringend psychologische Betreuung – doch erhält sie die viel zu selten. Die Psychiaterin Meryam Schouler-Ocak hat in einer Ende März erschienenen, repräsentativen Befragung der Berliner Charité herausgefunden, dass mehr als jede zehnte geflüchtete Frau in Deutschland Selbstmordgedanken hat. Weniger als jede Zehnte hat die Möglichkeit, mit einem Psychologen oder Therapeuten zu sprechen. Vielen fehlt medizinische Unterstützung.
Auch Sally hatte Probleme, eine passende Therapie zu finden. Erst nach dem dritten Suizidversuch wurde sie endlich an einen niedergelassenen Arzt vermittelt, bei dem sie sich wohlfühlt.
Vier Uhr an einem Märztag in der Sporthalle am Mariannenplatz in Kreuzberg. Draußen wird es dunkel, drinnen ziehen Rollschuhfahrerinnen von Bear City Rollerderby ihre Bahnen. Es läuft ein Lied von Beyoncé: „Wer regiert die Welt?“, fragt der Text. „Mädchen!“ Die meisten fahren schnell, gehen beim Fahren in die Hocke, üben Kehrtwenden und Drehungen. Nur eine fährt ganz langsam, sie trägt Leggings und einen Tüllrock.
Sally muss erst sicher auf den acht Rollen stehen können, bevor sie Spiele bestreiten darf. Jede Woche trainiert sie hier, gemeinsam mit einer Mitbewohnerin. Seit ein paar Monaten hat sie subsidiären Schutz, lebt in einer WG in Britz und trägt ihr Haare in allen Farben des Regenbogens. Sie nimmt Antidepressiva, es geht ihr besser. Nur am Abend, da kommen sie noch oft, die Erinnerungen und das Gefühl, nichts wert zu sein. Deshalb geht sie in die Halle. Und dreht Runden, bis ihr Gesicht rot glüht. Alle zehn Meter fällt sie hin, auf ihre Knieschoner, atmet schwer, rappelt sich hoch und fährt weiter.