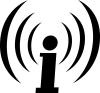Ein Gedankenexperiment: Im März 1933, wenige Wochen nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten, werden alle jüdischen Deutschen aus ihren Wohnungen und Häusern gezerrt und aus den Fabriken, Kanzleien, Praxen, Universitäten, Schulen geholt, in Reihen geordnet und zum Bahnhof eskortiert, wo sie dann in Güterwaggons gepfercht und nach Osten zur Vernichtung abtransportiert werden. Ihr Hab und Gut wird versteigert, ihre Geschäfte übernehmen nichtjüdische Deutsche. Nach wenigen Wochen ist keiner mehr da.
Wäre das 1933 möglich gewesen? Nein. Denn zu diesem Zeitpunkt hätte sich jeder nichtjüdische Deutsche, egal ob Antisemit oder nicht, fraglos einem moralischen Universum zugeordnet, in dem humanistische Werte und Standards galten. Aber: Exakt das alles ereignete sich nur acht Jahre später in der Wirklichkeit des "Dritten Reichs", und alle Nichtbetroffenen hielten das inzwischen für erwartbar und normal, vereinbar mit ihren Moralvorstellungen und ihrem Weltbild.
Zwischen 1933 und 1941 hatte sich eine moderne Gesellschaft des christlich-abendländischen Kulturkreises innerhalb von nur acht Jahren in eine radikale Ausgrenzungsgesellschaft verwandelt – und zwar so, dass die nichtjüdischen Deutschen die tiefe Veränderung ihrer Welt und ihrer Moral selbst gar nicht bemerkten und die ganze Zeit über in der Lage waren, ihre gegenmenschlichen Haltungen mit dem Selbstbild in Einklang zu bringen, gute Menschen zu sein.
Dieselben Bürgerinnen und Bürger, die 1933 für undenkbar gehalten hätten, dass Deportationszüge vom Berliner Bahnhof Grunewald abfahren, konnten wenige Jahre später genau das bezeugen. Nicht wenige von ihnen hatten inzwischen "arisierte" Kücheneinrichtungen, Wohnzimmergarnituren oder Kunstwerke gekauft. Nicht wenige saßen auf den Arbeitsplätzen, Lehrstühlen, Beamtenstellen, von denen man ihre jüdischen Mitbürger entfernt hatte. Und sie fanden das völlig normal.
Wir sehen hier nicht das absolute Grauen des Holocausts, keine Gaskammern und keine Leichenberge, sondern das unspektakulärere, alltäglichere Bild einer Gesellschaft, die zunehmend verbrecherisch geworden ist. Oder genauer gesagt: die moralisch umdefiniert hat, was als erwünscht und verwerflich, gut und schlecht, ordnungsgemäß und kriminell gilt.
Alle Einzelschritte der radikalen Ausgrenzung der jüdischen Deutschen fanden in der Öffentlichkeit statt, bis hin zu ihrem Abtransport. Das Deportationsgleis 17, von dem mehr als 50.000 jüdische Deutsche deportiert worden sind, lag mitten im Berliner Stadtteil Grunewald, einem der bürgerlichsten und reichsten Wohnviertel der Reichshauptstadt.
Dies ist das negative Paradebeispiel einer shifting base line – jenes faszinierenden Phänomens, dass Menschen immer exakt jenen Zustand ihrer Umwelt für den "natürlichen" halten, der mit ihrer aktuellen Lebens- und Erfahrungszeit zusammenfällt. Veränderungen der sozialen und physischen Umwelt werden nicht absolut wahrgenommen, sondern immer nur relativ zum eigenen Beobachterstandpunkt. Und der Veränderungsprozess ist im Alltag auf so kleine Einzelschritte und Verschiebungen in Sprache und Umgangsweisen aufgeteilt, dass es dem Einzelnen gar nicht auffällt, wie er seine Wahrnehmungen und Einstellungen mit seiner sich verändernden Welt selbst verändert.
Plötzlich ist denkbar, was eben noch unmöglich galt
Die Kaskade der antijüdischen Gesetze und Maßnahmen wurde von den meisten nichtjüdischen Deutschen aus einem einfachen Grund kaum zur Kenntnis genommen: weil sie sie nicht betrafen, also ihre eigene Normalität nicht veränderten. Man lebt normal weiter in einer immer unnormaler werdenden Welt. Die Zeiten ändern sich eben. Radikal, in nur acht Jahren.
Shifting baselines sind gerade in Zeiten großer politischer Dynamik ein Problem, weil die Nachrichten, Begriffe, Konzepte und Provokationen so beschleunigt und vielfältig einander abwechseln, dass man kaum bemerkt, wie das, was gestern noch als unsagbar galt, heute schon Bestandteil eines scheinbar normalen politischen Diskurses ist. Genau deshalb ist die kalkulierte Grenzüberschreitung auf der begrifflichen Ebene, wie sie die Neurechten seit Jörg Haider immer wieder mit Erfolg praktizieren, so erfolgreich: Da spricht man vom "Schießbefehl" an den Grenzen oder von der angeblich unerwünschten Nachbarschaft eines nichtweißen Deutschen, und die leicht erregbaren Medien fungieren in einer Weise als Resonanzverstärker, dass plötzlich für denkbar gehalten wird, was zuvor noch als ganz und gar unmöglich gegolten hätte.
"Obergrenze" wäre noch so ein Wort, "völkisch", "Flüchtlingskrise" und vieles mehr. Da Begriffe immer auch Weltwahrnehmungen sind, spielt ihre Einführung in den "normalen" Sprachgebrauch eine wichtige Rolle für die shifting baselines, insofern erfordern sie besondere Aufmerksamkeit. In der zur politischen Kampfzone auserkorenen Flüchtlingsthematik war zu sehen, wie sich der Sprachgebrauch hin zur Inhumanität verschob, ohne dass dies skandalisiert worden wäre. Da forderte ein FAZ-Kommentator eine "Verabschiedungskultur", da sah man das deutsche Volk an der "Belastungsgrenze", und da meinte der Generalsekretär der CSU sagen zu können: "Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese. Der ist drei Jahre hier – als Wirtschaftsflüchtling –, den kriegen wir nie wieder los." Hätte der Generalsekretär einer Regierungspartei sich vor zwei Jahren derart rassistisch geäußert, hätte er sein Amt sofort niederlegen müssen. Heute darf er es sagen – shifting baseline.
Wie bemerkt man solche Verschiebungen, und wie stemmt man sich dagegen?
Dafür gibt es kein Patentrezept, schließlich ist man als Mitglied einer
Gesellschaft stets Teil einer sich verändernden sozialen Gemeinschaft.
Aber vielleicht kann man sich darin üben, gelegentlich "Augenblick mal!"
zu sagen, wenn einem etwas so vorkommt, als habe man es kurz zuvor
nicht mal denken, geschweige denn sagen wollen. Und das nicht nur zu
sich selbst, sondern auch gegenüber anderen, wenn der Arbeitskollege
oder die Cousine oder der Wirt von "Lügenpresse", "Völksverrätern",
"Kopftuchmädchen" spricht. Einfach mal den Rede- und Denkfluss
unterbrechen, die
baseline
am Verschieben hindern. Den eigenen moralischen Kompass eichen.
Oder es so machen wie eine studentische Initiative in Österreich, die vor der Präsidentenwahl alle Gleichaltrigen dazu aufrief, ihren Omas und Opas anzudrohen, dass sie nie wieder zu Besuch kämen, wenn diese den FPÖ-Kandidaten wählen würden. Das hat nicht nur deshalb geholfen, weil nicht wenigen Omas bei dieser Drohung das Blut in den Adern gefroren sein muss. Sondern weil genau dies Anlass bot, politisch zu diskutieren, das scheinbar normal Gewordene in den Bereich des Unnormalen zurückzuholen. Die bewusste, explizite Auseinandersetzung ist gewiss das beste Mittel gegen jenes Mitdenken, aus dem allzu schnell ein Mitlaufen wird.