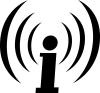Und nun steht sie wieder einmal an einem Tatort. Mirjam Blumenthal blickt einen Moment schweigend auf das Giebelhaus vor ihr, auf die Rußspuren an der weiß getünchten Fassade. Es ist früh am Morgen, der Wind weht durch stille Wohnstraßen im Süden von Neukölln, über Buchsbaumhecken und gefegte Hofeinfahrten. Zwei Monate lang hat es keinen Brandanschlag mehr gegeben. Aber die Bezirkspolitikerin hat sich nie etwas vorgemacht. „Keiner von uns dachte, dass nun Ende ist“, sagt sie, „wir haben alle darauf gewartet, dass der nächste Anschlag passiert.“
Auf der anderen Seite der Stadt, in einem Backsteinbau auf dem Gelände des alten Lageso, wo in den Jahren 2015 und 2016 Flüchtlinge zum Teil tagelang im Freien auf ihre Registrierung warteten, sitzt Diana Henniges in einem engen Büro und blickt einem Rechtsaktivisten aus Weißensee ins Gesicht. Sie hat das Foto des Mannes an die Glastür geklebt, damit die Mitglieder des Vereins „Moabit hilft“ wissen, dass sie sich in Acht nehmen müssen, wenn er wieder an der Straße vor dem Büro auftaucht.
Wenn die Gelegenheit günstig ist
Nicht weit entfernt, an der Beusselstraße in Moabit, läuft ein junger Mann vorbei an fleckigen Betonblocks und Spielotheken. Er steuert einen Eingang neben einer Kirche an; im dritten Stock liegen die Räume einer Opfer-Beratungsstelle. Fares Naem hatte Glück. Seine blutige Lippe, die Prellungen sind wieder abgeheilt. Und doch hat sich im Leben des Syrers etwas Grundlegendes verändert. „Ich vertraue den Menschen nicht mehr“, sagt er, „ich versuche, nicht aufzufallen.“
Drei Menschen in Berlin. Eine rundliche Frau mit blonden Haaren, die für die SPD Bezirkspolitik macht. Eine Historikerin, die einen Verein gegründet hat, um Flüchtlinge zu unterstützen. Ein Elektroingenieur aus einem Ort südlich von Damaskus. Was sie eint, ist der Hass der Rechtsextremisten.
Die Zahlen rechts motivierter Gewalttaten sind gestiegen, 2015 sprunghaft um fast 80, 2016 um weitere 20 Prozent auf 380; die Fälle hat das Netzwerk Berliner Register dokumentiert. 500 Menschen waren betroffen, darunter 41 Kinder. „Was seit einigen Jahren passiert, ist, dass die Tabus immer weiter fallen“, sagt Sabine Seyb von der Opferberatungsstelle Reach out, die mit dem Berliner Register zusammenarbeitet.
Von den meisten Fällen wisse niemand, weil sie nicht gemeldet werden. Lassen sich nach Angriffen auf linke Politiker oder Zivilgesellschaftsaktivisten Täter ermitteln, handele es sich in der Regel um organisierte Neonazis. Bei rassistischer Gewalt gegen Migranten dagegen sei das anders. „In der Mehrheit sind das keine Organisierten, sondern Leute mit rassistischem Gedankengut im Kopf, die zuschlagen, wenn die Gelegenheit günstig ist.“
„Rote Drecksau“ und „linke Ratte“
Als Mirjam Blumenthal auf das Haus mit den Rußflecken zusteuert, denkt sie zurück an das Feuer vor ihrer eigenen Wohnung, in der ihr Kind schlief, und an ihr brennendes Auto vor dem Fenster. Die SPD-Politikerin lebt in der Nähe, ihr Auto wurde im Januar angezündet. Der jüngste Anschlag ist zwei Wochen her. Sie kennt die Frau gut, die es zuletzt traf, eine engagierte Bürgerin, aber niemand, der in der Öffentlichkeit stünde. „Die müssen richtig recherchiert haben. Die gehen jetzt in die Tiefe.“
Ein Rentner schlurft über die Straße. „Ob man die Leute auch mal kriegt, die so einen Mist verzapfen?“, schreit er. Blumenthal hebt die Schultern, „wir hoffen’s“. Neukölln, so schätzt es der Senat ein, ist der „am stärksten mit rechtsextremistischen Straftaten und Aktivitäten belastete Bezirk im Westteil Berlins“.
Seit fast genau einem Jahr gibt es Brandanschläge in Berlin, die sich gegen Politiker, Gewerkschafter, Kirchenmitglieder und Buchhändler richten, 44 insgesamt, davon 35 allein in Neukölln und 7 im Wedding, Beleidigungen, in roter Sprühfarbe an die Hauswände geworfen, „rote Drecksau“, „linke Ratte“, mit Steinen eingeworfene Fensterscheiben, angezündete Autos.
Mirjam Blumenthal ist Gruppenleiterin bei der sozialistischen Jugendorganisation Die Falken, einem Hassobjekt der Rechten; fast hat sie sich daran gewöhnt, dass zwei Mal am Tag ein Polizeiauto bei ihr vorbeifährt. „Wir lassen uns von der Angst, die da ist, nicht den Alltag bestimmen“, sagt sie.
Aber da ist noch etwas anderes, was ihr zu denken gibt, nicht nur die Pöbeleien auf Facebook, sondern auch, dass die Leute inzwischen enthemmt oder wütend genug sind, sie direkt anzugehen. „Judenhure“, „Demokratieschwein“, es passiert, dass sie solche Worte hört, wenn sie sich auf Veranstaltungen den Weg durch die Menge bahnt, sagt sie. „Da fragt man sich doch: Was ist hier eigentlich los?“
Einschüchterungen wegen Flüchtlingshilfe
Einige Tage später sitzt die Frau, die in dem Giebelhaus lebt, auf ihrer Couch und versucht, sich einen Reim auf die Sache zu machen. Mieke Fischer heißt eigentlich anders, eine stille Frau Anfang 40 mit kurzen Haaren, Mutter zweier Kinder. Im Elternbeirat ist sie aktiv, im Sportverein, sie kümmert sich um die Website der Initiative „Hufeisensiedlung gegen Rechts“ und hat Sportangebote für junge Flüchtlinge organisiert, aber das ist schon eine Weile her. Was davon war es, das sie zum Ziel gemacht hat? „Ich sollte eingeschüchtert werden“, sagt sie leise, „aber ich weiß nicht, wofür.“
Für Diana Henniges, Gründerin des Vereins „Moabit hilft“, sind die Drohungen Alltag, die Beleidigungen, die ihr täglich im Internet entgegenschwappen. Mal steigt der Pegel, mal geht er zurück, auf null sinkt er nie. „Das ist gängige Praxis“, sagt sie, auch, dass Männer vor dem Büro stehen, auf und ab laufen, fotografieren.
Die Gesichter kennt sie von den Facebook-Seiten rechter Gruppen, „die haben sich hier auch schon als Mitarbeiter eingeschlichen“. Hinter der Glastür schwärmen Helfer und Flüchtlinge zwischen mit Jacken beladenen Stangen und Kisten voll Schuhen, Zahnpasta und Windeln. Der Verein ist zu einer Chiffre für zivilgesellschaftliches Engagement geworden. Damit haben sich die Mitarbeiter viele Feinde gemacht.
„Mich stachelt das eher an“
Diana Henniges bekommt SMS mit dem Namen ihres Kindes und Fotos von seiner Kita. Neulich schrieb einer, das Kind solle aufpassen an der Haltestelle, an der es täglich umsteigt. Es gibt Wochenenden, an denen sie 40 Pizzen geliefert kriegt. Dann fahren 30 Taxen bei ihr zu Hause vor.
„Die haben unsere Bankdaten und verwenden die bei Bestellungen“, sagt Christiane Beckmann am Schreibtisch hinter ihr, auch sie gehört zum Kern des Vereins. Ein, zwei Dutzend Anzeigen haben sie erstattet. Meist wurden die Verfahren eingestellt, ab und an müssen die Täter eine Geldbuße zahlen; an ihrer Situation änderte das nichts. „Es muss immer erst was passieren“, sagt Beckmann.
Sie steigt nun immer als Letzte aus dem Bus aus und schaut, wohin alle anderen steuern, ehe sie sich auf den Heimweg macht. Aber aufgeben wegen der Schikane? Kommt nicht infrage, sagt Diana Henniges. „Mich stachelt das eher an.“ Christiane Beckmann sagt: „Man ist hin- und hergerissen zwischen der Sorge um das Kind und dem Jetzt-erst-recht.“
Auch Fares Naem will sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Deshalb erzählt er seine Geschichte, unter seinem Namen. Der Syrer sitzt in einem kargen Raum mit weißen Wänden, neben ihm ein Psychologe von Opra, einer Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt. Naem, ein schmaler Mann, Jeans und Hemd, spricht schon ziemlich gut Deutsch. Seit anderthalb Jahren lebt er in Berlin, er sagt: „Berlin ist eine schöne Stadt. Aber es gibt Leute, die Flüchtlinge nicht akzeptieren.“
„Es ist schlimm“
Er zieht Papiere aus dem Rucksack, den Bericht des Krankenhauses, die Anzeige. Es war ein Freitag vor ein paar Wochen, gegen 23 Uhr, er saß in der Tram M13 Richtung Warschauer Straße und kriegte mit, dass drei Männer einen schwarzen Fahrgast drangsalieren. Er hörte sie sagen: „Afrikaner nach Afrika.“ Er begann, mit dem Handy zu filmen, dann ging er dazwischen: „Ihr dürft solche Dinge nicht sagen.“ Die Männer sagten:
„Scheiß Flüchtling.“ Und: „Das ist unser Land.“ Dann merkten sie, dass er alles gefilmt hat. Sie nahmen ihm das Handy weg, er müsse mit ihnen zur Polizei gehen. Stattdessen führten sie ihn in eine Seitenstraße. Einer trat auf ihn ein, einer schlug ihm ins Gesicht. Naem geht nun abends nicht mehr oft aus. Er sagt: „Ich dachte, Rassismus ist in Deutschland Vergangenheit. Es ist schlimm, dass es noch Hass gibt wegen der Herkunft von Menschen.“
Spontane Gewalt gegen Flüchtlinge ist das eine. Das andere sind gezielte Angriffe auf Politiker, Aktivisten und engagierte Bürger. Beides hat zugenommen. Das eine greift in das andere. „Das gesellschaftliche Klima hat sich verändert“, sagt Simon Brost von der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus; die Debatte um den Zuzug der Flüchtlinge trage zunehmend rassistische Züge, „die Täter nehmen für sich in Anspruch, für eine schweigende Mehrheit zu handeln“.
Oft fehlen die Beweise
Viel spricht dafür, dass wenige polizeibekannte Neonazis für die Anschläge verantwortlich sind. „Wir haben es mit einer kleinen, sehr konspirativen Gruppe zu tun“, sagt Brost. Der mehrfach vorbestrafte Neonazi Sebastian T., früherer Chef der NPD Neukölln, kam im Mai 2016 aus dem Gefängnis. Kurz danach begann die Anschlagserie in dem Bezirk. T. soll mit den „Freien Kräften Neukölln“ in Verbindung stehen, einer Gruppierung, die im Internet eine Karte mit Adressen politischer Gegner verbreitete.“
Das Landeskriminalamt ermittelt nun. Zudem kümmert sich am Polizeiabschnitt 56 in Rudow eine spezialisierte Ermittlungsgruppe. Ermittlungserfolge aber gibt es bisher nicht, manche Betroffene fühlen sich allein gelassen. Einzelheiten könne sie nicht mitteilen, schreibt die Polizei: „Bis zum heutigen Tage wird mit hoher Intensität an der Aufklärung der Straftaten ermittelt.“
An der Endhaltestelle der U7, Rudow, breitet sich eine Kreuzung aus, die Rudower Spinne. Der Verkehr donnert vorbei an einer Imbissbude, die als Treffpunkt der rechten Szene gilt. Männer mit rasierten Schädeln sind nicht zu sehen, nur ein Mann mit Brille und Funktionsanorak sitzt auf einer Bank. Sebastian Schmidtke, Bundesorganisationsleiter der NPD, hat den Ort vorgeschlagen. Zu den Anschlägen könne er nicht viel sagen: „Bis heute ist kein Beweis da, dass NPD-Leute beteiligt sind.“ Wahrscheinlich sei die Gewalt auf Rivalitäten innerhalb der linken Szene zurückzuführen.
Schmidtke kommt aus der Kameradschafts-Szene und gilt als Bindeglied zwischen „Freien Kräften“ und NPD. Er stand mehrmals vor Gericht, wegen Körperverletzung und Volksverhetzung. Im Gespräch gibt er sich besonnen und höflich. Er hetzt nicht gegen Flüchtlinge, sondern spricht ganz ruhig über soziale Ungleichheit.
„Wir haben nicht nur in Berlin den Fall, dass Verdrängungsprozesse stattfinden“, sagt er, Ursache sei auf der einen Seite die Gentrifizierung. Und auf der anderen Seite dann doch die Flüchtlinge. „Der Konkurrenzkampf wird härter“, sagt er, und davon werde die NPD profitieren. Einstweilen nutzen die Ressentiments vor allem der AfD. Schmidtke sieht die Entwicklung trotzdem positiv: „Noch vor fünf Jahren konnte man nicht offen über die Islamisierung in Deutschland reden. Da haben die AfD und auch Pegida viel verändert.“
„Gemeint sind alle“
Der Tonfall im politischen Diskurs hat sich verschoben – in dem Punkt würde Anne Helm, Mitglied der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus und Sprecherin für Strategien gegen Rechts, Schmidtke zustimmen. „Ich glaube, der Anstieg der Gewalt steht in Zusammenhang mit dem Rechtsruck der Gesellschaft; der führt dazu, dass die rechtsextreme Szene aktionsorientierter wird und die NPD zurückgeht in gewaltorientierte Strukturen“, sagt sie in ihrem Büro in Neukölln. Den Tätern gehe es um die Vorherrschaft im Süden des Bezirks: „Es trifft einen, und gemeint sind alle.“
Sie wurde im rechten Milieu vor drei Jahren zum Feindbild. Halbnackt trat sie in Dresden auf, auf ihrer Brust stand: „Thanks Bomber Harris“, eine Protestaktion gegen einen Neonazi-Aufmarsch. In der Folge erhielt sie schubweise Todesdrohungen.
Helm ist ein Extremfall, aber nicht die einzige Politikerin, die der Hass trifft. 2016 zählte die Berliner Polizei 431 Straftaten gegen Politiker, davon 142 gegen Mitglieder der Linken. Gerade erfuhr Helm, dass sie auf der Liste möglicher Ziele von Franco A. stand, des unter Terrorverdacht stehenden Bundeswehroffiziers. „Das ist qualitativ ein großer Unterschied, weil es ja nicht um Einschüchterung ging, sondern darum, ein Vorhaben umzusetzen.“ Das LKA sagte ihr, man sehe für sie keine konkrete Gefahr. Beruhigt hat sie das nicht. „Ich fühle mich hilflos. Man weiß ja nicht, ob da nicht noch eine Zelle dranhängt.“
In Neukölln haben sie Solidaritäts-Demonstrationen für die Betroffenen der Anschläge organisiert. Sie haben einander Mut gemacht und getan, was in solchen Situationen gefordert wird: Gesicht zeigen gegen Rechts. Mieke Fischer wollte keine Kundgebung vor ihrem Haus. „Man weiß nie, wer hier alles wohnt“, sagt sie. „Wenn wir auf der Liste stehen, dann kennt unseren Namen ein bestimmter Personenkreis. Aber der muss sich jetzt nicht noch erweitern.“