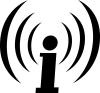Vorurteile gegen Sinti und Roma halten sich hartnäckig. Doch die Menschen sind nicht für alle Probleme verantwortlich - und humanitäre Hilfe erfahren sie auch in Frankfurt nur selten.
Es waren Bilder, die um die Welt gingen. Trauben von Menschen an deutschen Bahnhöfen. Hunderte Freiwillige, die bereitstanden, um Flüchtlinge in Empfang zu nehmen, sie mit dem Nötigsten zu versorgen. Auch Rinaldo Strauß, stellvertretender Vorsitzender des hessischen Landesverbands der Sinti und Roma, hat diese Bilder im Spätsommer und Herbst 2015 gesehen. Sie haben ihm gefallen – und gleichzeitig nachdenklich gestimmt. „Für Roma“, sagt Strauß, „gilt diese Willkommenskultur nicht.“
Wer über die größte europäische Minderheit reden möchte, kommt nicht daran vorbei, sich über die Wirkung von Bildern Gedanken zu machen. „Bilder im Kopf“, wie Rinaldo Strauß sagt. Von herumziehenden Familienverbänden, von Lagerstätten im öffentlichen Raum, von Slums, Schmutz und Kriminalität. „Das sind Bilder, die bei Bedarf abgerufen werden“, sagt Strauß, „und das ist der Kern des Problems.“
Derartige Bilder des Elends waren in Frankfurt in den letzten Jahren häufiger zu sehen: 2013 etwa als sich das Occupy-Camp am Willy-Brandt-Platz binnen weniger Monate von einem Protest- zu einem Notlager für wohnungslose Roma wandelte. Kurze Zeit später entstand auf einem Teilstück einer 13.000 Quadratmeter großen Brache an der Gutleutstraße eine Barackensiedlung, in der zu Hochzeiten mehr als 50 Menschen Obdach fanden – nicht ausschließlich, aber größtenteils Roma. 2016 beschäftigten größere Gruppen von Roma, die an der Weißfrauenkirche und am Wiesenhüttenplatz im Bahnhofsviertel nächtigten, Politik und Medien. Im Februar 2017 schließlich wurde die Barackensiedlung an der Gutleutstraße geräumt und abgerissen.
Die „Natur der Verelendung“
In jedem dieser Fälle schienen sich die Vorurteile, die „Bilder im Kopf“, von denen Rinaldo Strauß spricht, zu bestätigen. Die unhygienischen Zustände, der Müll, der Lärm. In der öffentlichen Debatte wurde daraus nicht selten eine Eigenart der Roma, Ausdruck ihrer Kultur und mangelnder Bereitschaft zur Anpassung. Für Joachim Brenner, Geschäftsführer des Fördervereins Roma in Frankfurt, aber liegen solche Zustände in der „Natur der Verelendung“. „Das ist die logische Konsequenz aus der Tatsache, dass die Leute sich irgendwie selbst helfen müssen.“
Ende 2016 hat der Bundestag beschlossen, dass arbeitslose EU-Ausländer künftig erst nach fünf Jahren Anspruch auf Sozialleistungen haben. Zuvor hatte die Ausschlussfrist sechs Monate betragen. Und noch vor wenigen Jahren oblag die Zahlung von Sozialhilfe an EU-Ausländer der Einzelfallprüfung – wer sich auf Arbeitssuche befand, hatte grundsätzlich Anspruch darauf.
Doch als Anfang 2014 die volle Freizügigkeit für rumänische und bulgarische Staatsbürger innerhalb der EU in Kraft tritt, machen vor allem die Kommunen Druck. Es gelte, eine „Zuwanderung in die Sozialsysteme“ zu verhindern, hieß es damals.
Mit den Folgen wird der Förderverein heute in seiner Beratungsstelle konfrontiert. „Wir haben seit geraumer Zeit mit Fällen zu tun, in denen die Leute einfach gar nichts mehr haben“, sagt Joachim Brenner. Immer öfter ginge es um das Notwendigste: Kleider, Nahrung, Milchpulver für Babys. Manchmal könne man mit kleinen Geldbeträgen aushelfen. Doch das reiche nicht. Und die Stadt ziehe sich auf ordnungspolitische Maßnahmen zurück. „Das Motto scheint zu sein: Wenn man nicht hilft, kommen sie auch nicht“, sagt Brenner.
Tatsächlich bieten die Frankfurter Behörden, wie gesetzlich vorgeschrieben, meist nur noch einen Monat lang Überbrückungshilfe. Das Ziel ist klar: Diese Zeit lässt man den Betroffenen, um eine Rückkehr in die Ursprungsländer vorzubereiten – mehr nicht. Das Vorgehen zielt nicht speziell auf Roma. „Das ist für uns keine relevante Kategorie“, sagt Manuela Skotnik, Referentin der Frankfurter Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld (CDU), „wir unterscheiden da nicht.“ Doch auch im Sozialdezernat ist bekannt, dass es vor allem Roma sind, denen es nicht gelingt, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren – zumindest nicht im klassischen Sinne. „Das Problem bleibt die Bildungsferne“, sagt Skotnik.
Dennoch versuchten die meisten Roma, die in seiner Beratungsstelle aufschlagen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, betont Brenner. „Das gegenteilige Bild, das da immer kolportiert wird, entspricht nicht unseren Erfahrungen.“ Nur seien es eben oft Tätigkeiten wie Flaschen- und Altmetallsammeln oder der Handel mit Flohmarktware, mit denen sich die Roma in Frankfurt über Wasser zu halten versuchten. Wer einen Teil der Einnahmen auch noch einer Familie im Ursprungsland zukommen lassen möchte, dem bleibt oft nicht genug, um eine Wohnung anzumieten. Es bleiben nur Barackensiedlungen und das Quartiernehmen im öffentlichen Raum. Die Logik der Verelendung.
Stadt löst illegale Unterkünfte auf
Ihr begegnet die Stadt in erster Linie ordnungspolitisch. „Das Ziel ist, wenn sich so etwas im öffentlichen Raum bildet, das direkt aufzulösen“, erklärt Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU). Für die Betroffenen, darin herrscht Einigkeit zwischen den zuständigen Dezernaten, gäbe es genug Alternativen: Obdachlosenunterkünfte und im Winter die B-Ebene der Hauptwache. Niemand müsse auf öffentlichen Flächen kampieren, lautet die Devise.
„Probleme werden nicht gelöst, indem man sie verschiebt“, sagt hingegen Rinaldo Strauß vom Landesverband. Joachim Brenner spricht von einer „Ersetzung von Sozial- durch Ordnungspolitik“. Medial wird diese Prioritätensetzung durch den Boulevard befeuert. „Elends-Bettler zurück im Gutleut“, titelte am 17. April dieses Jahres die Frankfurter Lokalausgabe der „Bild-Zeitung“, als eine kleine Gruppe Roma erneut an der Weißfrauenkirche nächtigte. Einen Tag später verkündete das Blatt die Räumung des „Lagers“ unter der Dachzeile: „Markus Frank greift durch“.
„Es gibt keine ernsthafte Auseinandersetzung darüber, wie man diesen Menschen humanitär helfen kann“, beklagt Brenner. In Sachen humanitärer Hilfe haben Roma in Frankfurt eigentlich nur einen wirklichen Verbündeten: Novak Petrovic, vermögender Immobilienhändler, der sich selbst als „Romafreund“ bezeichnet.
Seit Jahren vermittelt Petrovic Jobs, zahlt Rechnungen, bringt Roma in seinen Wohnungen unter. Etwa 45 Roma, sagt er, würden derzeit in einigen seiner Immobilien wohnen. Frankfurt habe einen guten Ruf unter Roma, betont Petrovic. Die Stadt gilt als reich und liberal. Deshalb glaubt er, dass im Sommer wieder mehr Roma nach Frankfurt kommen werden. Einige davon werden wohl wieder auf der Straße landen. „Und auf der Straße, betont Petrovic, „da sieht man das Elend.“