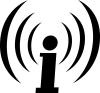Druckerei, Wäscherei, Schlosserei: Justizvollzugsanstalten sind regelrechte Großbetriebe. Die Gefangenen müssen zu Niedrigstlöhnen arbeiten. Und die Konkurrenz in der freien Wirtschaft stöhnt.
Elf Jahre und vier Monate lang hat Theodor K. in der Tischlerei gearbeitet, jeden Tag, von morgens sieben bis zum frühen Nachmittag. K. hat Holz an der Kreissäge zurechtgeschnitten, Büroeinrichtungen gezimmert, Spielzeug, Brutkästen für Vögel. Mit Lohnstufe zwei, erzählt er, habe er am 1. November 2005 angefangen.
Er war geschickt, wurde zum Vorarbeiter, bekam eine Beförderung und zum Schluss eine Leistungszulage.
Auf dem "Lohnschein für den Februar 2016", dem letzten Arbeitsmonat, steht schließlich: "Gesamtnettobezüge: 311,65 Euro". Umgerechnet nicht einmal drei Euro pro Stunde.
Eigentlich gilt in Deutschland mittlerweile ein Mindestlohn, der fast dreimal so hoch ist. Es gibt nur wenige Ausnahmen, darunter ein kleiner Bereich: der Knast. Ein großer Teil der rund 63.000 Strafgefangenen muss wie Theodor K. für sehr viel weniger Geld arbeiten.
2005 wurde Theodor K. wegen versuchten Mordes an einer Bekannten verurteilt, der er gelegentlich im Garten half. Die folgenden Jahre verbrachte K. in der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Fuhlsbüttel, Haus 2, Abteilung 2B5, dort war seine Zelle. Jeden Morgen um sechs Uhr wurde er geweckt: Antreten zum Dienst.
"Insassen werden systematisch ausgebeutet"
In den meisten Bundesländern sind Gefangene zur Arbeit verpflichtet. Die JVA Fuhlsbüttel etwa unterhält zu diesem Zweck einen regelrechten Gewerbepark. Dazu zählen außer einem Holzverarbeitungsbetrieb: eine Elektrowerkstatt, eine Bäckerei, eine Klempnerei, eine Schlosserei, eine Maurerei.
Als Theodor K. im Mai 2015 den Mindestlohn von damals 8,50 Euro in der Stunde einklagen wollte, scheiterte er. "Als Strafgefangener erbringt der Antragsteller Arbeitsleistungen im Holzverarbeitungsbetrieb der Justizvollzugsanstalt im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses und nicht aufgrund eines geschlossenen Arbeitsvertrages", befand das Hamburger Landgericht. Das Mindestlohngesetz gelte daher nicht. Theodor K. findet: "Die Insassen werden systematisch ausgebeutet."
In deutschen Gefängnissen ist eine Parallelwirtschaft entstanden, die die Sozialstandards des Landes unterläuft. Das muss aufhören, meint Oliver Rast, der vor drei Jahren die erste bundesweite Gefangenengewerkschaft gegründet hat. Rast war Mitglied der "Militanten Gruppe", wurde als Linksterrorist verurteilt, saß und arbeitete eineinhalb Jahre in der JVA Tegel, für 11,85 Euro - am Tag. Inzwischen kämpft Rast nicht mehr gegen den Staat, sondern für die Rechte der Gefangenen. 100 Mitglieder hat die Gewerkschaft eigenen Angaben zufolge, in 80 Anstalten ist sie demnach vertreten - und muckt auf.
Häftlinge im Bummelstreik
Etwa in der JVA Butzbach. Dort organisierten Gewerkschaftsmitglieder im vergangenen Jahr einen Bummel- und Hungerstreik. In der JVA Chemnitz konnten die Gewerkschafter kürzlich durchsetzen, dass sie künftig alle zwei Wochen in einem Raum konferieren dürfen. "Es kann nicht sein, dass in einem kleinen Teil der Gesellschaft vorwilhelminische Arbeitsverhältnisse existieren", sagt Rast.
Man könnte dagegenhalten, dass die schlecht bezahlte Arbeit ein Teil der Strafe wäre. Aber das lässt Rast nicht gelten. "Nicht das Lohndumping ist die Strafe, sondern der Freiheitsentzug", sagt er. "Und glauben Sie mir: Das ist hart genug." Vor allem: Die Billigarbeit treibe die Gefangenen in die Armut - was nicht dazu beitragen dürfte, dass sie sich nach der Strafe wieder gut in die Gesellschaft einfinden.
Auch das kann man am Beispiel von Theodor K. beobachten: Der größte Teil des Lohnes, den er für seine Arbeit in der JVA-Tischlerei erhielt, wurde direkt abgezweigt und als sogenanntes Überbrückungsgeld auf einem Konto für die Zeit nach der Entlassung geparkt. "Zwangssparen" heißt das im JVA-Jargon. Viel kommt dabei nicht herum: Als Theodor K. am 29. Februar 2016 aus der Haft entlassen wurde, hatte er ganze 1616 Euro auf dem Gefangenenkonto. "Das ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein", sagt er. Die Ersparnis aus elf Jahren Tischlerarbeit sei zunächst komplett fürs Hotel draufgegangen, 31 Euro pro Nacht im Mehrbettzimmer. Eine Wohnung musste er ja erst einmal finden.
Elf Jahre ohne Rentenbeiträge
Dramatischer ist auf Dauer aber vielleicht das: Von dem mickrigen Knastlohn werden die Gefangenen zwar arbeitslosenversichert, wenn auch zu schlechteren Konditionen. Sie zahlen aber nichts in die Rentenkasse ein - was bei langen Haftstrafen gewaltige Lücken reißt. Im Alter droht Armut. Theodor K. macht sich keine Illusionen: "Ich denke nicht, dass ich eine nennenswerte Rente bekommen werde. Die vielen Jahre kann ich ja unmöglich nachbezahlen." Ganz abgesehen davon, dass es gar nicht so einfach ist, überhaupt einen neuen sozialversicherungspflichtigen Job zu finden, wenn man 53 Jahre alt ist, nicht mehr ganz fit und: vorbestraft.
Das Problem wollte die Politik schon seit einiger Zeit angehen - seit 1977. Mit dem Inkraftreten des Strafvollzugsgesetzes wurde damals auch eine Regelung für die Rentenversicherung angekündigt. Gekommen ist sie aber nie. Seit 2006 ist der Strafvollzug Ländersache. Auf Anfrage verweist Rheinland-Pfalz, das derzeit den Vorsitz der Justizministerkonferenz innehat, auf Arbeitsgruppen, in denen das Thema seit geraumer Zeit seine Runden dreht. Im vergangenen Jahr beschlossen die Justizminister, die Frage an ihre Kollegen in den Finanz- und Sozialministerien weiterzureichen. Diese sollen bis Dezember dieses Jahres geklärt haben, wie teuer eine Rentenversicherung für Gefangene würde. Mit einer Entscheidung sei daher in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen, heißt es aus Mainz. Das Schicksal der Strafgefangenen - ein dringendes Anliegen scheint es der Politik nicht unbedingt zu sein.
Womöglich auch deshalb, weil sich die Länder an die Einnahmen aus der Billigarbeit gewöhnt haben. Denn die Gefängnisse produzieren längst nicht mehr nur Büromöbel für die Verwaltung oder Roben für Richter. Sie bieten ihre Zulieferdienste auch eifrig Privatunternehmen an. Ein lukratives Geschäft: Allein Rheinland-Pfalz erwirtschaftet mit seinen Produktionsstätten im Knast zuletzt 9,2 Millionen Euro jährlich für die Landeskasse. Unter der staatlichen Dumping-Konkurrenz leiden derweil Unternehmen außerhalb der Gefängnismauern.
Konkurrenz aus dem Knast
Das zeigt die Geschichte von Raik Weigelt, 51 Jahre, aus Burgdorf bei Hannover. 2001 machten er und seine Frau sich als Verpackungsdienstleister selbstständig. Sie holen tonnenweise Schrauben und Nägel vom Großhändler und füllen sie in 250-Stück-Blister für den Baumarkt. Lange lief das Geschäft gut, ziemlich gut sogar. Weigelt kaufte eine Halle mit Arbeitsräumen, warb Mitarbeiter an. Zwischenzeitlich halfen 60 Leuten in seinem Unternehmen mit.
Doch dann eröffnete, nur 20 Autominuten entfernt, im Dezember 2004 in Sehnde eine neue JVA, mit 534 Plätzen eine der größten in Niedersachsen. Das Gefängnis betreibt eine Wäscherei, eine Lackiererei, Werkstätten für Metall- und Holzbau - und einen Verpackungsdienst. Seither, sagt Weigelt, gehe es für ihn bergab.
Für die gleiche Leistung berechne die JVA ihren Kunden 40 Prozent weniger. "Ich kann von meinem Preis keinen Euro runter, ich müsste eher noch hoch", sagt Weigelt. Allein im vergangenen Jahr sei der Umsatz um 30 Prozent zurückgegangen. Von den einst 60 Helfern seien fünf Mitarbeiter geblieben, für die Weigelt Mindestlohn und Rentenversicherung zahlt - wie es eigentlich jeder Arbeitgeber tun müsste.
Die JVA Sehnde wirbt derweil bei der Wirtschaft ziemlich unverhohlen mit dem Dumping-Vorteil. "Die Lohnkosten entsprechen in etwa denen in 'Billiglohnländern', in die die Unternehmen zunehmend Produktionsbereiche verlagern", preist sie sich auf der Homepage an. "Unser Angebot macht diese Maßnahme unnötig".