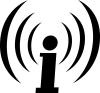Baden-Württemberg will, dass zukünftig DNA-Material zur Feststellung von Augen-, Haar- und Hautfarbe verwendet werden kann, was umstritten und zuverlässig unmöglich ist
Von Ralf Streck
Der Mord an einer Freiburger Studentin hat die Gemüter nicht nur in Südwestdeutschland schwer erregt. Seither tobt eine Debatte, die in der Stadt der sogenannte "Bund gegen Anpassung" forciert hat, der sofort in einem breit verteilten Flugblatt in Richtung der Flüchtlinge nach den Tätern Ausschau hielt. Der behauptete, man könne per "DNA-Analyse ganz leicht" den Täter eingrenzen: "Nichts ist so leicht durch DNA-Analyse zu ermitteln wie die Rasse." Zwar schmückt sich die Gruppe mit Hammer und Sichel, doch aus ihrer rechtsradikalen Gesinnung machen die Fans des irakischen Ex-Diktators Saddam Hussein keinen Hehl, die einst auch die Republikaner unterstützt haben. Doch über den Freiburger Polizeichef ist der Vorstoß schnell in die Landesregierung gelangt. Und Justizminister Guido Wolf (CDU) hat nun eine entsprechende Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht.
Wolf hatte bereits im Rahmen der Ermittlungen und der Festnahme eines mutmaßlichen afghanischen Flüchtlings Anfang Dezember mehr Möglichkeiten bei der Auswertung von DNA-Spuren gefordert, was bislang unmöglich und auch ethisch bedenklich ist. Und schon damals hatte er diese Initiative angekündigt. Der Freiburger Polizeipräsident Bernhard Rotzinger erklärte im vergangenen Dezember, eine umfassendere Auswertung von DNA-Spuren bei Fahndungen hätte der Polizei bei der Tätersuche im Fall Maria "massiv geholfen". Und er fügte hinzu: "Wir hätten wesentlich konzentrierter die Ermittlungen vorantreiben können."
Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen 17-Jährigen handeln, der 2015 als unbegleiteter Flüchtling aus Afghanistan eingereist sein soll. Er lebte bei einer Freiburger Pflegefamilie und stand unter der Vormundschaft des Jugendamtes Breisgau-Hochschwarzwald. Zwar schweigt sich der mutmaßliche Täter weiter aus, doch seine Täterschaft soll durch ein am Tatort gefundenes Haar, durch Videoaufnahmen und andere Beweise belegt sein. Nun soll vor allem sein Alter über ein rechtsmedizinisches Gutachten festgestellt werden, denn davon hängt das Strafmaß ab.
Dass es sich tatsächlich um einen Minderjährigen handelt, darf bezweifelt werden. Denn als Hussein K. wegen eines versuchten Raubmords im Jahr 2013 in Griechenland verhaftet und dort danach zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt wurde, gab er schon einmal an, 17 Jahre alt zu sein. Es ist unmöglich, drei Jahre lang ein 17-Jähriger zu bleiben. Allerdings wurde er in Griechenland trotz der hohen Jugendstrafe schon Ende Oktober 2015 wieder auf Grund einer Sonderregelung freigelassen, hinter der offensichtlich der griechische Geldmangel im Rahmen der massiven Sparauflagen stand, die dem Land aufgezwungen werden.
Er tauchte schnell 2015 unter und reiste nach Deutschland weiter. Hier wusste die Polizei aber nichts von seiner brutalen Vorgeschichte in Griechenland. Dort hatte er im Mai 2013 auf Korfu der Geschichtsstudentin Spyridoula Chaidou aufgelauert und Geld von ihr geraubt. Doch trotz der freiwilligen Herausgabe warf er sie über ein Straßengeländer. Die trainierte Sportlerin fiel etwa zehn Meter in die Tiefe und überlebte den Raub schwerverletzt. Hätten die Griechen aber nach dem Abtauchen von Hussein K. nicht nur national nach ihm gefahndet, sondern einen internationalen Haftbefehl ausgestellt oder wenigstens einen Eintrag in internationale Datenbanken vorgenommen, hätte er die 19-jährige Studentin in Freiburg vermutlich ein Jahr später weder vergewaltigen noch umbringen können.
So ist erstaunlich, dass nun nicht gefordert wird, die Zusammenarbeit und den Austausch von Daten innerhalb der EU und eine bessere Ausstattung für die Polizei in Griechenland oder anderen Ländern zu stärken, die massiv unter Sparauflagen leiden. Denn dadurch hätte sich das Verbrechen verhindern lassen. Doch es wird nun eine zweifelhafte Erweiterung von DNA-Analysen gefordert, die bestenfalls - und auch das steht im Zweifel - eine bessere Aufklärung ermöglichen soll.
Genanalyse soll Geschlecht, Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das biologische Alter verraten
Statt das Naheliegende zu tun, hat sich die grün-schwarze Koalition im Ländle darauf geeinigt, zu versuchen, die Verfolgung von schweren Straftaten zu verbessern, statt zu versuchen, sie zu verhindern. Es drängt sich der Eindruck auf, dass hier die öffentliche Aufregung über den Mord an der Studentin instrumentalisiert wird, um ein umstrittenes Verfahren durchzudrücken. Jedenfalls soll der Vorstoß aus Baden-Württemberg schon in der nächsten Bundesratssitzung am 10. Februar beraten werden. Die "Südwest Presse" hat berichtet, dass künftig auch Spurenmaterial verwendet werden soll, um Feststellungen über das Geschlecht, die Augen-, Haar- und Hautfarbe sowie das biologische Alter machen zu können. Technisch sei das nach Angaben von Justizminister Wolf möglich. Der hatte schon vor Wochen auch bei Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) um Unterstützung geworben.
Bei den Grünen gab es nur Vorbehalte dagegen, auch die "biogeografische Herkunft" ermitteln zu wollen. Denn gerne wird auch behauptet, man könne ohne weiteres - wie in der Fernseh-Serie CSI dargestellt - herausfinden, ob ein Verdächtiger aus Europa, Afrika oder Asien stammt und welchen ethnischen Hintergrund eine Person hat, oder gar ein Phantombild erstellen. Dagegen hätten aber sogar die Grünen Bedenken gehabt, weshalb eine ursprünglich für den Dienstag vorgesehene Kabinettsbefassung wegen eines sogenannten Fraktionsvorbehalts vertagt werden musste. "Bei diesem Punkt sehen wir verfassungsrechtliche Probleme. Das wäre ein erheblicher Eingriff in die Grundrechte, weil ganze Gruppen unter Generalverdacht gestellt würden", sagte der Grünen-Rechtsexperte Jürgen Filius. Die anderen Punkte könne seine Partei aber mittragen, fügte er an.
Justizminister ist Wolf ist jedenfalls zufrieden: "Es ist ein schöner Erfolg, dass wir uns in der Regierungskoalition schnell einigen konnten." Aus dem Kompromiss soll nun schnell ein konkreter Vorschlag formuliert werden, den das Kabinett spätestens am kommenden Dienstag beschließen soll. "Baden-Württemberg ist damit Vorreiter für ein Ermittlungsinstrument, das unseren Strafverfolgungsbehörden insbesondere bei schlimmen Verbrechen wie Mord oder Sexualstraftaten enorm weiterhelfen kann", meint Wolf. Man passe nur die Strafprozessordnung an die heutigen technischen Möglichkeiten an. Der grüne Filius meint, die Haar-, Augen- und Hautfarbe sowie das Alter ließen sich aus einer DNA-Analyse hinreichend exakt bestimmen. "Wir wollen Regelungen und Instrumente, die eine noch effektivere Verfolgung von Straftaten möglich machen", begründet er die grüne Zustimmung.
Doch die Spezialisten, die sich eingehend mit dem Thema beschäftigen, sehen das ziemlich anders. Ihrer Ansicht nach sind diese erweiterten DNA-Analysen keineswegs unproblematisch, wie häufig dargestellt wird. Sie bergen eine große Gefahr von Fehlinterpretationen und Stigmatisierungen. Das hatte eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Deutschland und Großbritannien schon im Dezember in einem offenen Brief dargelegt, zu denen auch die Freiburger Professorinnen Veronika Lipphardt und Anna Lipphardt gehören.
Im Gespräch mit Telepolis, erläutert Veronika Lipphardt, die am Freiburger University College zur Populationsgenetik sowie zur Geschichte der Lebenswissenschaften forscht, dass die Techniken bei weitem nicht in allen Details so genau sind, wie man es sich für den forensischen Einsatz wünschen würde. Der Genetiker Manfred Kayser, ein im Bereich der Bestimmung äußerer Merkmale führender Experte, sei daher in der Frage der biogeografischen Herkunftsbestimmung äußerst vorsichtig, so Lipphardt: "Ausgewiesene Experten wie Kayser sagen, wirklich gut auseinanderhalten könne man mit DNA-Analysen nur Ostasiaten, Südostasiaten sowie Menschen aus dem subsaharischen Afrika und amerikanische Ureinwohner." Eurasier könne man aufgrund der vielen historischen Wanderungsbewegungen zwischen dem Mittleren Osten und Europa nicht präzise genug unterscheiden. "Das bedeutet aus meiner Sicht, dass die Aussagekraft dieser Methoden doch sehr beschränkt ist - wenn es etwa darum geht, eurasiatische Flüchtlinge von eurasiatischen Ansässigen zu unterscheiden."
Deshalb hätte diese Bestimmung im Freiburger Fall gar nichts gebracht. Selbst wenn sich ein ziemlich unseriöses Labor gefunden hätte, das einen westasiatischen Ursprung angenommen hätte, wäre alles Mögliche in Frage gekommen, meint Veronika Lipphardt. Das hätte die Ermittler nicht weitergebracht. Und die Nationalität, da sind sich die Experten des renommierten EUROFORGEN-Projektes einig, lässt sich auf keinen Fall mit DNA-Analysen bestimmen. Präzisere geografische Angaben, wie etwa "südosteuropäisch", "mediterran" oder "nordafrikanisch", werden von den Ermittlern sehr unterschiedlich interpretiert und erlauben, wenn man etwa Kaysers vorsichtigen Angaben folgt, keine verlässliche Ermittlungsgrundlage. Wie auch: Selbst in einer Stadt wie Freiburg dürfte das den Pool für die Ermittlungen nicht sinnvoll eingrenzen.
Anders als in der öffentlichen Debatte behauptet, haben die Länder, in denen die erweiterten Analysen bereits eingesetzt werden, keineswegs nur gute Erfahrungen erzielt, wie gerne behauptet wird. In den Niederlanden und in Großbritannien haben Ermittler mit ähnlichen Angaben bereits auch schon mal Bauchlandungen erlitten, wie ausgewiesene Sozialwissenschaftler für diese Länder, etwa Viktor Toom, Amade M'charek, Barbara Prainsack und Matthias Wienroth, in zahlreichen Publikationen überzeugend demonstrieren. Dazu meint Veronika Lipphardt: "Dass man diese Wissenschaftler, die alle deutsch sprechen, nicht als Experten in die Debatte einbindet, ist ein großer Fehler." Diese Länder hätten entsprechend reagiert, wenigstens teilweise die Technologien umsichtig reguliert, Monitorings eingeführt und umfassende Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.
Ermittlung der biogeografischen Herkunft beruht auf unrealistischen Vorannahmen
Auch haben andere europäische Länder bereits erkannt, dass polizeiliche DNA-Datenbanken, die für den ganz regulären Abgleich von DNA-Profilen genutzt werden, datenschutzrechtlich problematisch sein und zur Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen beitragen können. Von einem solchen Problembewusstsein ist man in Deutschland noch weit entfernt, und entsprechende sozialwissenschaftliche Forschung gibt es hierzulande kaum, so Veronika Lipphardt: "Die derzeitige Initiative von Herrn Wolf lässt ein umsichtiges Vorgehen jedenfalls nicht erkennen."
Offensichtlich war es angesichts dieser Lage auch den Grünen zu heikel, die biogeografische Bestimmung aufzunehmen, die nach Angabe von Anna Lipphardt auf "Referenzdatenbanken" beruhe, "die von vornherein sehr geprägt sind von den Vorannahmen der Wissenschaftler, die sie anlegen". Die Referenzpopulationen in diesen Datenbanken erhielten oft Populationsnamen, die keineswegs naturwissenschaftlich, sondern kulturell geprägt seien. Das Konzept der "biogeographical ancestry", so Veronika Lipphardt, beruhe auf der Annahme, dass Menschen aus derselben Region auch genetisch ähnlich seien. Das Verfahren funktioniere so, dass man eine Einzel-DNA mit diesen Referenzpopulationen vergleiche, statistische Ähnlichkeiten feststelle und die Person so einer der Populationen zuzuordnen versuche. Genau genommen gehe es dabei um Ähnlichkeiten von Vorfahren, die vor Dutzenden von Generationen in derselben Region gelebt und daher genetische Ähnlichkeiten aufwiesen.
Allerdings, so Lipphardt, beruhe dieses Vorgehen auf der Vorannahme, dass Familien über einen langen Zeitraum in einer Region ansässig sind und deren Mitglieder nur in Familien in der näheren Umgebung einheiraten. Es ignoriert große Teile der historischen Bevölkerung Eurasiens, die keinen solchen Lebensstil pflegten: Unternehmer, Händler, Akademiker, Wanderarbeiter, Vertriebene und so fort. Außerdem werde jeder Proband nur einer einzigen Population zugeordnet; Individuen mit einem vielfältigeren Hintergrund lassen sich mehr schlecht als recht zuordnen.
Die Aufnahme jedes einzelnen Probanden in eine Referenzpopulation einer Referenzdatenbanken werde sehr unterschiedlich gehandhabt: nach der Selbstangabe oder aber nach der Zuordnung durch den, der die Daten erhebt. Schließlich erzeuge die Bestimmung der biogeografischen Herkunft etwa im Fall der Eurasier überhaupt keine verlässlichen Hinweise auf äußerliche Merkmale; zwei mitteleuropäische Polizisten könnten z.B. ganz verschiedene Vorstellungen davon haben, wie ein Südosteuropäer, ein Südostasiate oder ein Nordafrikaner aussehen.
Öffentlichkeit nicht ausreichend informiert
Für Veronika Lipphardt steht fest, dass sich die Öffentlichkeit über die Probleme mit den DNA-Analysen nicht im Klaren ist: "Die Öffentlichkeit glaubt, dass es hier wunderbare eindeutige Ergebnisse geben wird." Sie weist deshalb auch auf das Problem hin, dass nicht einmal Augen oder Haarfarbe eindeutig bestimmbar sind. So heißt es oft, man könne mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 bis 95% die Augenfarbe bestimmen. Aber selbst diese Bestimmbarkeit gelte nur für ganz dunkle und ganz helle Augen. Ähnliches gilt auch für Haarfarbe, wo mit ähnlich hoher Wahrscheinlichkeit rote sowie ganz dunkle und ganz helle Haarfarben bestimmt werden können. Hautfarben lassen sich mit ähnlicher Verteilung, aber insgesamt mit schlechterer Wahrscheinlichkeit bestimmen. Somit könne darüber also nur in Ausnahmefällen eine sinnvolle Eingrenzung vorgenommen werden. Und, so könnte man den grünen Filius fragen, ob es kein "erheblicher Eingriff in die Grundrechte" ist, wenn "ganze Gruppen unter Generalverdacht" gestellt werden, wie schwarzhaarige-dunkeläugige oder weißhäutige Menschen.
Es gibt also nur ziemlich ungenaue Ergebnisse, die sich gegenseitig zudem verstärken. Gute Zuschreibungen und Ermittlungsansätze ergeben sich darüber kaum. Selbst wenn man Augen-, Haut- oder Haarfarbe mit einer Sicherheit von 95% bestimmen könnte, läge die Technik bei 20 Fällen jeweils in einem Fall daneben, erklärt Veronika Lipphardt: "Das ist viel." Und noch einmal weist sie darauf hin, dass auch diese Wahrscheinlichkeiten nur für Extremwerte angetroffen werden. "In den Publikationen wird nicht angegeben, wie dunkel ein Haar oder ein Auge sein muss, damit die Farben mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit eruiert werden können." Es sei ja ein Unterschied, ob jemand schwarze oder braune Haare hat. "Zählt dunkelbraun jetzt schon zu intermediär und damit zu einer noch schlechteren Wahrscheinlichkeit?" Die gleiche Frage gelte auch für die Haut- oder Augenfarbe. Da ohnehin nur die Extreme - sehr hell oder sehr dunkel - einigermaßen gut bestimmt werden können, würden aber auch diese Gruppen verstärkt über diese Technik in den Fokus der Ermittler geraten. Denn bei allen Schattierungen dazwischen wäre der Ermittlungsansatz viel zu breit, der Einsatz viel zu teuer, weshalb die Ermittler das verwerfen und diese Leute natürlich in Ruhe lassen würden. Allein darüber würden Minderheiten in den Fokus gelangen, weil die Mehrheiten über diese Technik über eine nicht händelbare Masse ausscheiden, die jeden Ermittlungsrahmen sprengen würde.
Die Freiburger Forscherin erklärt das an einem Beispiel in Dessau: Hier hat ein deutsches Pärchen im Mai 2016 eine Asiatin brutal vergewaltigt und ermordet; die Täter wurden bereits nach wenigen Wochen gefasst. Wäre dies nicht so schnell gelungen, hätte bei erweiterten DNA-Analysen das Ergebnis gelautet: Eurasier; eventuell Ortsansässiger; mittelbraune Haare, gemischte Augenfarbe, helle Haut. Dann hätte die Polizei sich ausrechnen können, wie teuer und aufwendig es wäre, alle in Frage kommenden Dessauer zum freiwilligen DNA-Test zu bitten. Weil diese Mischwerte ohnehin keine gute Wahrscheinlichkeitsprognose gehabt hätten, hätte man sich sicherlich gegen einen solchen Einsatz entschieden. Über die Jahre würde dies dazu führen, dass Minderheiten mit extremen Haar- und Augenfarben überproportional oft zu DNA-Tests herangezogen würden.
Im Freiburger Fall hätten die Ermittler also eventuell die Haarfarbe auch von der DNA ableiten können, wenn dies schon erlaubt gewesen wäre. "Aber selbst ein korrektes Ergebnis hätte die Ermittler nicht viel weitergebracht, denn schwarzhaarige Personen gab es auf den Video-Aufnahmen sicherlich viele", schreiben die Wissenschaftler in ihrem offenen Brief mit Blick auf die vielen Aufnahmen aus Straßenbahnen und anderen Kameras. "Entscheidend waren die Hinweise auf die auffällige Färbung, die Länge, die ungewöhnliche Frisur. Nur so konnten Videoaufnahmen und Haardaten zusammenwirken. DNA hätte diese Umstandsdaten niemals liefern können", verweisen sie darauf, dass die Polizei den mutmaßlichen Täter letztlich auf Grund der üblichen Ermittlungsmethoden gefunden hat.
Anna Lipphardt, weist gegenüber Telepolis zudem noch einmal auf die Probleme mit den DNA-Analysen hin, die schon längst bekannt sind, selbst wenn Marker - wie eine Spermaspur - einer bestimmten Person zuzuschreiben ist, es also nicht nur um Haar-, Augen- oder Hautfarbe geht. "Auch das findet immer in einem Spannungsfeld zwischen der DNA-Analyse und polizeilicher Ermittlungsarbeit und Erfahrungswissen statt." Es werde nicht nur einfach eine Technik angewendet, sondern "an der Schnittstelle können immer wieder auch soziokulturelle Deutungen und Vorurteile einfließen". Es sei zwar schon sehr viel machbar, doch die vielen Fehlerquellen, Risiken und ethischen Probleme, die man sich damit einhandelt, würden momentan in der Diskussion ausgeblendet. Die Technik sei nicht so "einfach, trivial und machbar", wie es in der öffentlichen Diskussion suggeriert werde.
Sie erklärt dies am Beispiel des sogenannten "Heilbronner Phantoms", wozu auch auf Telepolis so einiges geschrieben wurde (Unnatürliche Todesfälle). Denn dazu forscht Anna Lipphardt seit einigen Jahren. Zugeschrieben wird der Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter bisher allein dem NSU-Trio Böhnhardt, Mundlos, Zschäpe, allerdings gibt es an der bisherigen Theorie einige Zweifel und die Ermittlungen laufen alles andere als reibungslos (Kiesewetter-Mord), was hier aber nicht das Thema ist. Am Fahrzeug von Kiesewetter und ihrem Kollegen Martin Arnold, der den Anschlag schwerverletzt überlebte, wurde eine DNA-Spur gefunden, die schon in der Datenbank des Bundeskriminalamts gespeichert war. "Es handelte sich um die Spur einer unbekannten weiblichen Person (UWP), die schon an anderen Tatorten auch in Frankreich, Holland, Deutschland und bis Österreich gefunden worden war", erklärt die Kulturanthropologin.
Am Heilbronner Tatort Theresienwiese hielten sich am Tattag auch Schausteller und eine Roma-Familie auf. Vor diesem Hintergrund wurde die DNA-Probe der "UWP" schließlich interpretiert. Aus Österreich - wo, anders als in Deutschland, die DNA-Analysen auf die sogenannte "bio-geographische Herkunft" überprüft werden dürfen - habe man die Rückmeldung bekommen, dass die Probe auf einen osteuropäischen Hintergrund der Spurenverursacherin hinweise. In der Sonderkommission (SoKo) in Heilbronn ging man von einer hohen Mobilität und zudem einem Schweigecode aus, weil niemand die Frau jemals an den Tatorten gesehen hatte. Auf Basis dieser völlig falschen Zuschreibungen wurde schließlich breit unter "Landfahrern" oder "Zigeunern" ermittelt, wie es wie es von Ermittlern gegenüber Medien immer wieder hieß. Offensichtlich standen dabei insbesondere osteuropäische Roma im Fokus.
Es habe eine regelrechte "Medienkampagne" gegeben, die auch von "Qualitätsmedien" getragen wurde, wie der Zeit und dem Stern, "wo die Jagd auf das Phantom eröffnet wurde". So fragte der Stern: "Eine Sinti- oder Roma-Frau, worauf der Fall in Worms hinweisen könnte? Schon ab Ende 2001 machen die Ermittler einen großflächigen Gentest: Mehr als 3000 Junkies, Drücker und Wohnungslose, die sich zur betreffenden Zeit in der Nähe der Tatorte aufgehalten haben, müssen eine Speichelprobe - im Polizeideutsch "speicheln" genannt - abgeben." Doch das blieb erfolglos, aber man hatte sich auf die "mobilen sozialen Gruppen" wie Sinti und Roma eingeschossen. "Diese Gruppen kann man nicht flächendeckend speicheln", zitiert der Stern den Freiburger Kriminalhauptkommissar Bruno Bösch, der damit die Erfolglosigkeit begründete, anstatt den Ansatz in Frage zu stellen.
Man hielt an der Spur fest, basierte sie doch auf einer DNA-Probe. Und so schrieb der Stern weiter: "Die Spur in Kreisen der Sinti und Roma gilt im Moment in Heilbronn als die heißeste. Offiziell will das niemand bestätigen, aber 'wir prüfen auch intensiv im Zigeunermilieu', sagt ein Ermittler vage und politisch unkorrekt. Alles passte nur zu gut in das Vorurteilsbild. "Tatorte wie Freiburg, Heilbronn oder Worms liegen in der Nähe bekannter Stützpunkte großer Sinti- und Roma-Clans. Viele von ihnen nutzen ein Busunternehmen, das von Heilbronn aus regelmäßig nach Rumänien fährt, etappenweise aber auch nach Österreich und Frankreich."
Anna Lipphardt spricht angesichts ihrer wissenschaftlichen Arbeit über das Heilbronner Phantom von einer "wirkmächtigen Fiktion". Sie fragt, wie diese hergestellt wurde und wie sie gewirkt hat. Sie sieht ein fatales Zusammenspiel: "Über die Medien wird ein Generalverdacht in die Welt gebracht, auch um Zeugenaussagen zu generieren." Parallel dazu gibt es die DNA-Reihenuntersuchung unter Frauen, die nach Ansicht der Heilbronner SoKo "dem kriminellen Raster" der UWP entsprachen. Dass es nur 800 waren, wie offiziell erklärt wird, bezweifelt die Forscherin.
Dieser Fall zeigt, wie unglaubliche Ermittlungsressourcen auf Grund einer angeblich klaren DNA-Spur sinnlos vergeudet wurde. Die Wahrheit ist, wie längst herauskam, dass die DNA von einer Mitarbeiterin der Firma kam, welche die Wattestäbchen herstellt und verpackt hat, mit denen eben am Tatort DNA-Spuren gesichert werden. Es handelte sich um eine polnische Arbeiterin und damit der Hinweis auf eine mögliche osteuropäische Herkunft der mutmaßlichen Täterin. Und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, hätten Ermittler auch nach der Enttarnung des Phantoms als Fiktion noch an ihrer These festgehalten. So wurden auch danach noch Personen überwacht, zu denen das erratische Profil passte und entsprechende Anfragen an das Bundeskriminalamt und an die Geheimdienste formuliert. Das geht aus dem Bericht des Bundestags-Ermittlungsausschuss hervor.
Aus den Fehlern, mit denen sich die Ermittler massiv blamiert haben, die sich in der ganzen NSU-Ermittlungen in verschiedene Sackgassen verrannt haben oder verrennen wollten, wurde aber offensichtlich nichts gelernt. Die Debatte um DNA-Spuren und die Ausweitung der Analysen wird nämlich weiter so geführt, als hätte man es mit einer wertfreien Technik zu tun, die automatisch auf die richtige Spur führt. Eine wirkliche Debatte um dieses Thema ist nicht gewollt und offensichtlich werden Fälle, wie die Vergewaltigung und die Ermordung der Freiburger Studentin Maria instrumentalisiert. Tatsächlich hätte dieser Fall verhindert werden können und letztlich wurde er über "übliche" Ermittlungsmethoden aufgedeckt.
Die Forscher kritisieren deshalb auch, dass Gegenstimmen und Bedenken in der Diskussion nicht berücksichtigt oder ausgeblendet würden. So hätte der Badischen Zeitung zum Beispiel der Offene Brief schon vor seiner Veröffentlichung vorgelegen. In der Zeitung hat man sich aber gegen ein Abdrucken entschieden und auch keinerlei Verweis darauf gebracht. Auch die Freiburger Universität sei nicht bereit gewesen, eine Presseerklärung dazu herauszugeben.
Die Frankfurter Universität hatte damit allerdings kein Problem. Sie verweist ausdrücklich in einer Erklärung auf den Offenen Brief, an dem auch die Soziologen Dr. Victor Thom und Prof. Dr. Thomas Lemcke mitgearbeitet haben: "Wer behauptet, DNA-Analysen in der polizeilichen Ermittlungsarbeit seien einfach, trivial, zuverlässig, unproblematisch und eindeutig, und damit impliziert, die Technik bedürfe keiner sozialen, ethischen und rechtlichen Eingrenzung, der irrt nicht nur: Er handelt unverantwortlich", zitiert die Presseerklärung der Frankfurter Uni den Schlusssatz des Offenen Briefes.