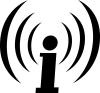Der gambische Diktator Yahya Jammeh hat die Präsidentschaftswahl verloren, klammert sich aber an die Macht. Die Nachbarn drohen mit einem Einmarsch.
Von Isabel Pfaff
Arm an Skurrilitäten war der Kleinstaat Gambia noch nie, in den vergangenen sechs Wochen aber hat sich das Land selbst übertroffen. Erst holte der Oppositionskandidat Adama Barrow bei den Wahlen am 1. Dezember völlig unerwartet den Sieg - 22 Jahre nach dem letzten Machtwechsel, der eigentlich ein Putsch war. Dann ließ sich der abgewählte Diktator Yahya Jammeh dabei filmen, wie er gut gelaunt seinem Rivalen am Telefon zum Sieg gratulierte. Wohlgemerkt: Noch Wochen vorher hatte er Oppositionspolitiker einsperren lassen, internationale Wahlbeobachter verboten und schließlich zum Wahltermin das Internet abgestellt. Dann, acht Tage nach dem Gratulationsvideo, die Volte: Jammeh ruderte zurück und kündigte an, das Wahlergebnis anzufechten.
Der Noch-Präsident lässt die Muskeln spielen. Tausende sind geflohen - auch der Wahlsieger
Seither leben die knapp zwei Millionen Gambier in einem Schwebezustand. Und wohl erst am kommenden Donnerstag, dem Tag der geplanten Amtseinführung des neuen Präsidenten, wird sich entscheiden, wohin es für sie geht: in Richtung Machtwechsel und einer wohl demokratischeren Zukunft oder zurück in die Diktatur und damit wahrscheinlich in eine Phase der Gewalt.
Beide Kandidaten beanspruchen weiterhin den Wahlsieg für sich, obwohl das offizielle Ergebnis eindeutig und Wahlfälschung angesichts der Machtverhältnisse im Land unwahrscheinlich ist: 45, 5 Prozent für Herausforderer Barrow, 36,7 Prozent für Amtsinhaber Jammeh. Der spricht nun von Unregelmäßigkeiten und hat vor dem Obersten Gerichtshof Gambias eine Beschwerde eingereicht. Nur: Das Gericht kann eigenen Angaben zufolge wegen fehlender Richter erst in einigen Monaten darüber entscheiden. Mangels eigener Juristen ist Gambia auf Richter aus dem Ausland angewiesen. Deshalb versucht Jammeh nun, die Amtseinführung gerichtlich zu stoppen, bis ein Urteil vorliegt. Angeblich hat sein Anwalt beim Obersten Gericht eine entsprechende einstweilige Verfügung eingereicht.
Gleichzeitig lässt der Präsident jene Muskeln spielen, die er formal noch bis Donnerstag hat: Im Dezember ließ er in den großen Städten zur Einschüchterung Soldaten aufmarschieren, seit Jahresbeginn hat er mehrere kritische Radiosender schließen lassen. Mittlerweile sind Tausende Gambier aus Angst vor Gewalt in die Nachbarländer geflohen, auch ein Minister hat sich ins Ausland abgesetzt - und inzwischen sogar der Wahlsieger. Wie am Sonntag bekannt wurde, hält sich Adama Barrow in Senegal auf. Was die geplante Vereidigung in wenigen Tagen zu einer noch heikleren Angelegenheit macht.
Denn obwohl Gambia winzig und geopolitisch einigermaßen unbedeutend ist, hat sich der Machtkampf zwischen Jammeh und Barrow zu einer regionalen Krise ausgewachsen. Westafrika hat sich in den vergangenen Jahren verändert, in mehreren Staaten der Region haben friedliche Machtwechsel stattgefunden, eine neue Generation von Politikern ist an die Macht gekommen. Nun zeigt sich, dass Staatschefs wie Muhammadu Buhari in Nigeria, Macky Sall in Senegal und Ellen Johnson-Sirleaf in Liberia nicht bereit sind, ein Verhalten wie das von Jammeh zu tolerieren. Schon zwei Mal hat der westafrikanische Staatenblock Ecowas eine Vermittlermission in die gambische Hauptstadt Banjul entsandt, um Jammeh zur Machtübergabe zu bewegen, zuletzt am vergangenen Freitag. Bisher ohne Erfolg.
Doch Jammehs Noch-Kollegen sind offenbar bereit, bis zum Äußersten zu gehen: Sie wollen zur Not ein UN-Mandat für ihre regionalen Truppen erwirken, um in Gambia einzumarschieren und so dem Wahlsieger ins Amt zu helfen, wie der UN-Gesandte für Westafrika, Mohamed Ibn Chambas, am Freitag in New York mitteilte. Dieses Szenario wäre eine Premiere. Noch nie haben afrikanische Staatschefs einen ihrer Kollegen dermaßen unter Druck gesetzt, damit dieser sich an demokratische Regeln hält. Sicher, Gambia ist eher ein Leichtgewicht unter den westafrikanischen Staaten; ein Einmarsch dort birgt weniger Risiken als etwa im straff regierten Tschad.
Dennoch: Dass die Möglichkeit im Raum steht, ist bemerkenswert - zumal das Ausland (in Afrika und darüber hinaus) jahrelang großzügig über die Eskapaden Jammehs hinweggesehen hatte. Dabei gehört der Ex-Offizier schon seit seinen ersten Regierungsjahren zu Afrikas schlimmsten Diktatoren. In Gambia werden nicht nur Regierungskritiker und Journalisten verfolgt, sondern auch Homosexuelle; Jammeh verfolgt sogar Menschen, die angeblich der Hexerei nachgehen. Seit einiger Zeit kann auch Europa nicht mehr ignorieren, was in dem kleinen Küstenstaat vor sich geht. Unter den Mittelmeerflüchtlingen des vergangenen Jahres fanden sich erstaunlich viele Gambier.
Paradoxerweise sehen Beobachter ausgerechnet in Jammehs Unberechenbarkeit Anlass zur Hoffnung. Peter Fabricius vom südafrikanischen Think Tank Institute for Security Studies erinnert daran, dass Jammeh die Wahlen wohl mühelos hätte fälschen können - "aber er tat es nicht". Ähnlich überraschend: Bisher hat Jammeh weitgehend auf Waffengewalt verzichtet und sein Ziel auf juristischem Weg verfolgt. Am Sonntag, so berichten gambische Medien, habe der umstrittene Präsident seine Kollegin Johnson-Sirleaf in Liberia angerufen, um sie um Hilfe bei der Suche nach Richtern für das Oberste Gericht zu bitten. Es wird also noch gesprochen. Bis zur Vereidigung ist noch Zeit für ein paar Telefonate.