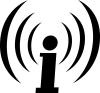Berlin streitet über ein teilbesetztes Haus: Die Rigaer94 sei ein Hort linker Gewalt, sagt der Innensenator. Dennoch halten viele Anwohner zu den Hausbesetzern. Warum?
Altbauten, ein paar Lindenbäumchen, zwischendurch noch ein Rest Kopfsteinpflaster: Die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain wirkt auf den ersten Blick nicht so, doch die Polizei zählt sie zu den "Gefährlichen Orten" der Stadt. Geht man die Straße von Osten nach Westen entlang, kommt man an Spielplätzen, einem frischgestrichenen Kindergarten und einem Bioladen vorbei. An die Fassade eines grauen Hauses hat jemand "hässlich!" gesprüht. Gegenüber von einem Lidl, der auch bald abgerissen werden soll, wird schon gebaut: Bis 2017 soll hier ein Haus mit hohen Fenstern und 133 neuen Mietwohnungen entstehen. Artikel über diesen "trendigen Stadtteil", wie die zuständige Immobilienfirma Friedrichshain nennt, werden in den letzten Wochen allerdings bevorzugt mit brennenden Autos bebildert.
Grund ist das Haus mit der Nummer 94: Einst war es besetzt, mittlerweile haben die Bewohner Mietverträge, im Erdgeschoss sind jedoch noch Räume besetzt und werden für Veranstaltungen genutzt. Besonders der Berliner Innensenator Henkel hatte sich seit Anfang des Jahres mehrfach für ein hartes Vorgehen der Polizei gegen das Projekt ausgesprochen, die Gegend als "No-Go-Zone" für Polizisten und die 94 als Ausgangspunkt autonomer Gewalt bezeichnet.
Nachdem am 22. Juni die Räume im Erdgeschoss, die Kadterschmiede, mit 300 Polizeibeamten geräumt worden waren, patrouillierte die Polizei drei Wochen lang offiziellen Aussagen zufolge mit 30 bis 40 Beamten und drei Mannschaftswagen vor Ort, sperrte Teile der Straße und hielt Besucher davon ab, das Haus mit der Nummer 94 zu betreten. Währenddessen renovierten Bauarbeiter im Auftrag der unbekannten Hausbesitzer die Räume. Am 13. Juli entschied ein Berliner Verwaltungsgericht, dass die Räumung illegal gewesen war, und einen Tag später zogen Polizei und Bauarbeiter unter dem Jubel von Sympathisanten und Anwohnern ab.
Geeint durch die Angst vor steigenden Mieten
An diesem Sommernachmittag wirkt die Straße friedlich: Eltern gehen mit Kindern spazieren, Leute sitzen auf dem Bürgersteig vor den Häusern in der Sonne, andere unterhalten sich vorm Späti. In unmittelbarer Nähe der Hausprojekte liegen eine Grundschule und Kindergärten. Linke Gewalt ist nicht die Hauptsorge vieler Anwohner: Kerstin Neugebauer, die seit 1999 im Kiez wohnt, und Jana*, die hier drei Kinder großzieht, sind vor allem von der Polizeipräsenz genervt. Mit den Bewohnern der Hausprojekte teilen sie die Sorge vor steigenden Mieten und Gentrifizierung. Es klingt nicht nach einem Kiez, der sich mehrheitlich Polizeischutz vor vandalierenden Linken herbeiwünschte. Der Graben, den der Berliner Innensenator und die Polizei zwischen Hausbesetzern und ihren Nachbarn aufmachen, existiert so offenbar nicht.
Friedrichshain im Osten Berlins war eigentlich ein traditionelles Arbeiterviertel, das auch heute im Vergleich zum Rest der Stadt ein niedriges Durchschnittseinkommen und hohes Armutsrisiko hat. Auch Hausbesetzungen und die daraus geborenen Wohnprojekte gehören schon lange zum Kiez: 1990 wurden zahlreiche Häuser in der ehemaligen DDR besetzt, darunter nahezu die gesamte Mainzer Straße ganz in der Nähe der Rigaer. Während die Mainzer unter großem Polizeiaufgebot in einer regelrechten Straßenschlacht geräumt worden war, wurden viele der Projekte in der Rigaer legalisiert und werden teils heute noch von den Leuten bewohnt, die sie vor 26 Jahren besetzt hatten.
Gleichzeitig ist der Stadtteil in den letzten Jahren zunehmend zum Magneten für Touristen und Wahlberliner aus aller Welt geworden: Mit ihnen teilen sich nun Anwohner aus DDR-Zeiten und ehemalige Hausbesetzer ihren Kiez. Das macht sich auch bei den Mieten bemerkbar, die seit 2009 bei Neuvermietungen um fast 60 Prozent gestiegen sind. Viele der Neubauten in der Rigaer werden als Symbole für diese Entwicklung angegriffen: Man erkennt sie an eingeworfenen Scheiben oder frisch gestrichenen Fassaden, die mit Farbbeuteln beworfen wurden. Keine andere Straße wurde dieses Jahr so oft zusammen mit den Worten "linksautonome Gewalt" erwähnt.
"Was soll man denn machen, wenn einem nie jemand zuhört?"
Ein Grund dafür, dass nicht alle Nachbarn das als Problem ansehen, könnte sein, dass sie von der Kriminalität nicht unbedingt betroffen sind: Straftaten wie Körperverletzung richten sich Statistiken zufolge fast ausschließlich gegen Polizisten. Den größten Teil der Straftaten machen Sachbeschädigungen aus, die tendenziell eher die Neubauten und frisch renovierte Häuser treffen. Für Kerstin Neugebauer, die seit 17 Jahren in einem Mietshaus neben der umstrittenen 94 wohnt, kann von Unsicherheit keine Rede sein.
Was Gewalttaten angeht, ist sie beschwichtigend: Die Leute in der 94 sind ihre Nachbarn, die seien das bestimmt nicht gewesen. Auch die berühmten brennenden Autos gebe es direkt in der Rigaer schon länger nicht mehr. Für die studierte Architektin ist ihre Straße kein krimineller Brennpunkt, im Gegenteil: "Hier hilft man einander, lebt zusammen auf der Straße und bekommt mehr voneinander mit, als woanders."
Neugebauer ist bewusst in die Rigaer Straße gezogen – und geblieben. Deswegen war es ihr auch so wichtig, dass die Anwohner ihre Straße zurückbekommen: Von der Polizei, der Politik und den Medien, die im Juli alle plötzlich die Deutungshoheit über den Stadtteil beanspruchten.
Doch in den Augen von Bewohnerinnen wie Neugebauer wird die Straße ihnen weiterhin weggenommen: Durch gesichtslose Neubauten in ehemaligen Baulücken, die die alten Bewohner verdrängen. "Das sind ja letztendlich Eigentumswohnungen, die für viele hier nicht interessant sind – hier wohnen eher Leute, die nicht so gut betucht sind," sagt sie. "Gewalt und Zerstörung kann ich absolut nicht gutheißen. Aber was soll man denn machen, wenn einem nie jemand zuhört? Da setzt auf allen Seiten Frustration ein, auch bei der Polizei und den Bewohnern."
Für Zugezogene, die sich über Farbbomben ärgern, hat Kerstin Neugebauer wenig Verständnis: Die Hausprojekte und die linke Szene gehörten zum Kiez. Wer herzieht, sollte sich dessen bewusst sein – genau wie jemand, der in ein Kneipenviertel zieht, sich dort schlecht über Lärm beschweren kann.
Weiter die Straße hinunter liegt ein wichtiger Ort für den Kiez, den auch Neugebauer schätzt, der sogenannte Dorfplatz: die Kreuzung der Rigaer mit der Liebigstraße. Nur ein Haus weiter liegt die Rigaer94 mit ihrem Wohnprojekt im Hinterhaus, Einzelmietern im Vorderhaus und der wiedereröffneten Kadterschmiede im Erdgeschoss. Direkt an der Kreuzung stehen die Liebig34, ein queerfeministisches Wohnprojekt, und die ehemalige Liebig14, die vor den letzten Berliner Senatswahlen 2011 in einem Großeinsatz geräumt worden war. Mit Bänken und Sofas wird er besonders von den Bewohnern der Hausprojekte wie ein ausgelagertes Wohnzimmer benutzt, aber auch Anwohner aus den Mietshäusern nennen ihn Dorfplatz.
Direkt am Dorfplatz liegt auch eine Bäckerei, die im Juni für Aufregung gesorgt hatte: Kurz hing ein Zettel im Fenster, der den omnipräsenten Polizisten ein Hausverbot erteilte. Während des dreiwöchigen Intensiveinsatzes hatten sie den Laden vor allem wegen der Toilette besucht. Mittlerweile ist die Polizei, und mit ihr der Großteil der Presse, von ihrem Dauereinsatz abgezogen, fährt aber in regelmäßigen Abständen über die Kreuzung. In der Bäckerei merkt man davon nichts – die Angestellten scherzen mit einer Anwohnerin, die an einem der Fenster sitzt. Lola und Phillip, zwei Bewohner der Hausprojekte, haben die Bäckerei als Treffpunkt vorgeschlagen, in der auch sie von den Angestellten wie alte Bekannte begrüßt werden.
Die Polizeikontrollen haben die Nachbarn zusammengebracht
Seit die Rigaer Straße Ziel der Polizeieinsätze und -kontrollen ist, sind die Hausprojekte untereinander enger zusammengerückt – und auch mit ihren Nachbarn: Teils gingen sie von Tür zu Tür, um Anwohner nach ihrer Meinung über sie zu fragen, auf Zetteln wurde vor der Demonstration am 9. Juli gewarnt, man möge vielleicht sein Auto umparken, und es wurde Hilfe für die Besitzer beschädigter Kleinwagen angeboten. "Willkürlich irgendwelche Autos anzuzünden, an denen vielleicht eine Existenz hängt, finde ich bescheuert", kommentiert Phillip. Für beide ist klar, dass nicht ihre Nachbarn der Feind sind, und das würden sie gerne weitergeben. Sie konzentrieren sich auf das gemeinsame Problem der steigenden Mieten, nicht die Differenzen.
"Wir wollen vermitteln, dass wir ein solidarisches Miteinander und ein besseres Leben für alle wollen", erklärt Lola. Beide sind überrascht von der Entwicklung im Kiez und der Unterstützung, die die 94 von vielen Anwohnern bekommen hat: Durch Kiezversammlungen, die im Januar von den Hausprojekten ins Leben gerufen wurden, würden sich nun auch Teile der Nachbarschaft politisch gegen Gentrifizierung und die anhaltende Polizeipräsenz einsetzen.
Phillip, der in der 94 wohnt, spricht von polizeilicher Willkür. Er zählt auf: Die illegale Räumung im Juni, durchgeschnittene Internetkabel, permanente Polizeipräsenz im Haus, rausgedrehte Sicherungen und drei Tage ohne Strom. "Einmal habe ich einen Polizisten gefragt, warum ich keinen Besuch haben kann, und da war die Antwort nur: ‚Weil ich es sage’." Ein Polizeisprecher sagt auf Nachfrage, dass ihm zu diesen Sachverhalten keinerlei Informationen vorlägen. Und nicht die Polizei, sondern allein eine private Sicherheitsfirma habe den Einlass kontrolliert. Allerdings: Auch Journalisten wurden daran gehindert, das Haus zu betreten und von Securitys weggeschickt – hinter ihnen im Hauseingang standen sechs Polizisten.
"Ohne brennende Autos hätte sich niemand für uns interessiert"
Lola und Phillip sehen in solchen Situationen Gewalt als legitime Notwehr. "Rein rechtsstaatlich gesehen sollte die Polizei doch die Straftäter suchen – nicht ein Haus und den ganzen Stadtteil bestrafen", sagt Phillip. Und die Gewalt in der Straße? Steine seien nach Polizeiautos geworfen worden, nicht nach Menschen, und in dem Kinderzimmer, das mit einer Stahlkugel beschossen wurde, hätte zu dem Zeitpunkt noch niemand gewohnt – hätten sie gehört. Den Nutzen brennender Autos sehen sie durchaus: Ohne die hätte sich doch nie jemand für sie interessiert. Vielleicht klingt so die Frustration, von der auch ihre Nachbarin Neugebauer gesprochen hatte.
Doch nicht alle Nachbarn unterstützen die Bewohner der Hausprojekte. Einige von ihnen ärgern sich über den Lärm aus den Häusern, andere über betrunkene Männer vor den linken Kneipen. Eine Mutter hat keinerlei Sympathie: "‘I hate cops’, was soll das denn? Die sollen mal erwachsen werden!", sagt sie. Die Grundschule ihrer Tochter hatte sich zwischenzeitlich so sehr um die Sicherheit der Schüler gesorgt, dass sie nicht alleine nach Hause gehen durften. Doch obwohl sie seit acht Jahren in einer angrenzenden Straße wohnt, haben sie die Hausprojekte bis vor Kurzem nicht wirklich gestört. Jetzt wurde auch bei ihrem Auto eine Scheibe eingeschlagen.
Jana, die in der Nähe der Wohnprojekte in einer Altbauwohnung drei Kinder großzieht, sieht die Situation deutlich gelassener. Gewalt findet sie unvertretbar – doch in der Schule ihrer Kinder ganz um die Ecke sei das nie Gesprächsthema gewesen. Keine der Seiten in dem Konflikt hätte sich nur richtig oder nur falsch verhalten: "Beide müssten toleranter werden. Ich kann verstehen, dass Nachbarn die Hausprojekte nicht unterstützen wollen, wenn sie an den Kneipen blöd angemacht werden, weil sie nicht szenetypisch aussehen," meint sie, "aber auch wie die Polizei Leute behandelt, nur, weil sie mal nicht schnell genug weitergehen, ist doch nicht in Ordnung. Was ist das denn für ein Bild, das unseren Kindern da vermittelt wird?"
Ihr 15-jähriger Sohn wurde auf dem Weg zu einer Party von der Polizei kontrolliert und etwa eine Stunde festgehalten. Sie ärgert sich darüber: Warum kontrolliert die Polizei Schüler, die an einer Straßenecke stehen, und sammelt Bastelscheren von Grundschülern ein, aber macht nichts gegen laute, betrunkene Touristen? Und was machen die Kräfte überhaupt hier, wenn die Revaler Straße, die für Drogenkriminalität bekannt ist, nur wenige Autominuten entfernt ist?
"Wer von Solidarität spricht, muss auch für die Oma auf die Straße gehen"
Doch obwohl sie die Hausprojekte unterstützt, steht sie den "solidarischen Strukturen" von denen die Bewohner der Hausprojekte sprechen, skeptisch gegenüber: "In einem wirklich solidarischen Kiez würden genauso 200 Leute auf die Straße gehen, wenn der Oma in der Mietwohnung zwangsgekündigt wird, wie dann, wenn die Polizei ein Hausprojekt räumt."
Eine perfekte Welt wäre für sie ein Kiez, der bleibt, wie er ist – mit der älteren Dame, die hier die DDR, die Wende und die Hausbesetzungen erlebt hat, den Bewohnern der Hausprojekte, Besuchern der Bars und Events und eben den Neuen in den modernen Wohnungen. Doch dass es zwischen den verschiedenen Gruppen auch auf absehbare Zeit weiter zu Reibereien kommen wird, ist wahrscheinlich: Investoren, die in der Straße bauen, scheinen keinerlei Interesse an einem Baustopp zu haben, und der Eigentümer der Rigaer94 hat vor Gericht neue Klagen eingeleitet. Die Forderungen nach Alternativen von allen Seiten bleiben vage: Die einen wünschen sich sozialen Wohnungsbau, die anderen, dass die Brachflächen einfach den Anwohnern überlassen werden. Eine Frau schlägt vor, dass ein Gebäude mit Eigentumswohnungen doch zum Ausgleich ein Stockwerk mit billigen Mietwohnungen haben könnte.
Der Weg aus der Straße heraus führt an einem Späti vorbei, vor dem sich zwei Männer unterhalten. Der eine hat selbst 1990 eines der Häuser in der Rigaer besetzt, und beide ärgern sich darüber, wie über ihre Straße geredet wird: "Illegale Kneipen, illegale Menschen, alles ist hier illegal!" Von der anderen Straßenseite winkt jemand aus einem Imbiss – das Mittagessen des Spätibesitzers ist fertig. Er ruft zurück und läuft hinüber. Seinen Laden lässt er offen.
* Alle nur mit Vornamen vorgestellten Personen haben darum gebeten, nicht mit ihrem richtigen Namen genannt zu werden