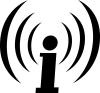Beleidigt, bespuckt, bedroht: Wer in Dresden anders als Einheimische aussieht, wird oft nicht nur schräg angeschaut. Seit Pegida auf der Straße ist, zeigt Alltagsrassismus hemmungslos seine hässliche Fratze.
In Dresden scheint die Angst vor Fremden besonders groß. Selbst wenn sie in so zierlicher Gestalt daherkommen wie Ana aus Indonesien. Ihren ersten Tag in der sächsischen Landeshauptstadt wird sie nie vergessen. Als die Studentin der Erziehungswissenschaften im Herbst 2011 das erste Mal zur Uni wollte und auf den Bus wartete, zeigte ein junges Mädchen mit dem Finger auf sie und machte abfällige Bemerkungen. Für Ana brach eine Welt zusammen: "Ich war erschrocken und musste weinen. Ich dachte, in Deutschland sind die Leute gebildet. Ich hatte doch nur auf den Bus gewartet."
Seither hat Ana noch andere Demütigungen erdulden müssen. Als Muslima ist sie für Ausländerfeinde gut erkennbar. "Muslim-Schwein" oder "Scheiß Muslim" sind Ausdrücke, die sie immer wieder zu hören bekommt. Einmal habe ein etwa elfjähriger Junge sie gefragt, ob sie Auschwitz kenne. "Als ich das bejahte, sagte er nur: 'Du wirst dort enden.'"
Vor allem wenn IS-Terroristen wieder für Schlagzeilen sorgten, werde auf sie geachtet. Ana hat dann das Gefühl, wie eine Täterin behandelt zu werden. In einer Straßenbahn habe ihr ein Junge seinen Finger wie eine Pistole an den Kopf gehalten. "Ein Mann hat das gesehen, gesagt hat er nichts", erzählt sie.
"Meine Brüder sagten mir, dass Dresden 'speziell' sei"
Dass die Mehrheit schweigt und Einzelne gewähren lässt, hat auch Nathalie aus Kamerun schon zu Beginn ihrer Dresdner Zeit erfahren. Gemeinsam mit einer Freundin saß sie im Frühjahr 2011 in einer Straßenbahn, als ein Mann ihr ins Gesicht schaute und sie anspuckte. "Es war 11 Uhr am Vormittag, die Bahn war voll, es war Frühling und draußen sehr schön", sagt die 25-Jährige, die an der Technischen Universität Elektrotechnik studiert und in Deutschland promovieren will - "aber nicht in Dresden". Mit der Stadt habe sie abgeschlossen, zu viel sei passiert in letzten Jahren.
Dabei war Nathalie von ihren beiden Brüdern gewarnt worden. Ihr Onkel arbeitete damals als Professor in Dresden - für die jungen Kameruner Grund genug, auch in der Elbestadt zu studieren. "Meine Brüder sagten mir schon, dass Dresden sehr "speziell" sei", berichtet die junge Frau. Eine nette Umschreibung für das, was das Leben in Dresden für Menschen aus anderen Kulturkreisen mitunter zur Hölle macht. Es muss nicht immer ein direkter Angriff oder eine Bedrohung sein. Auch das ungenierte Anstarren, Beschimpfungen oder Beleidigungen sind ein Teil von Alltagsrassismus. Manchmal muss Nathalie daran denken, wie Weiße in ihrer Heimat empfangen werden: "Man behandelt sie wie Könige."
"Ich will nicht von einem Neger behandelt werden"
Rassismus ist nicht auf einzelne Schichten beschränkt. Junge, Alte, Arbeiter und Akademiker - alle machen mit. Nathalies Bruder, der als Zahnarzt in Dresden arbeitet, bekam von einem Ingenieur zu hören, dass er "nicht von einem Neger behandelt" werden wolle. Nathalie sagt: "Ich reise viel und bin auch schon in Asien in Dörfern gewesen, wo man bis dahin noch nie einen schwarze Frau gesehen hatte. Aber die Leute waren neugierig, wollten meine Haut anfassen. In Dresden dagegen wird man beschimpft, selbst von Kindern. Die Mütter stehen daneben. Ich möchte wissen, was aus denen wird, wenn sie mal 18 Jahre alt sind."
Humberto wiederum stammt aus Mexiko und hat Dresden - als er 2007 ankam - anfangs von seiner besten Seite kennengelernt. "Ich fand damals die Anonymität in Deutschland schön. Ich mag es zwar, in Gesellschaft zu sein, brauche aber auch Zeit für mich allein." Das alles habe er in Dresden gefunden. Doch seit etwa zwei Jahren habe sich die Situation verändert: "Man wird fast jeden Tag in der einen oder anderen Form auf der Straße beleidigt", erzählt der 32-Jährige, der Stadtplanung studierte. Jetzt wohnt er in einer Wohngemeinschaft im Viertel Johannstadt und geht wie viele Ausländer abends nicht mehr auf die Straße - aus Angst vor Übergriffen.
Dabei kennt Humberto, dem man in Dresden auch schon Schläge androhte, solche Zustände sonst nur aus der Heimat. Dort sei es mancherorts gefährlich, abends das Haus zu verlassen. Deshalb habe er in Dresden zu Beginn so viel Freiheit empfunden: "Ich bin auch nach Deutschland gekommen, weil ich mich hier gefahrlos bewegen konnte." Seit etwa zwei Jahren habe sich eine Atmosphäre von Angst entwickelt: "Ausländer haben Angst vor Deutschen, und Deutsche haben Angst vor Ausländern." Überall wo er hingehe, habe er das Gefühl, angestarrt zu werden: "Manchmal drücken Frauen ihre Taschen eng an sich, weil sie denken, ich würde sie stehlen wollen."
"Die Menschenverachtung ist in dieser Stadt normal geworden"
Tatsächlich markiert das Auftauchen der sogenannten "Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" (Pegida) im Herbst 2014 einen Wendepunkt. Die islam- und fremdenfeindliche Bewegung hat den Ruf Dresdens ruiniert - und zwar international. Humberto bekommt immer wieder Mails mit Anfragen besorgter Freunde, wie es ihm in Dresden ergehe. Barbara Irmer vom Ökumenischen Informationszentrum ist sogar auf einer Reise in Indonesien auf Pegida angesprochen worden. "Der Hass ist in unserer Gesellschaft salonfähig geworden", sagt die Frau, die in Dresden das Projekt STUBE leitet - das Studienbegleitprogramm für Studierende aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Südosteuropa.
Unlängst lud TU-Rektor Hans Müller-Steinhagen ausländische Studenten und Politiker zum Thema Rassismus in den Landtag ein. Etwa zehn Betroffene berichteten von ihren Erfahrungen. "Ich bin selten so traurig und nachdenklich aus einem Gespräch gegangen", sagt Müller-Steinhagen. "Trotzdem bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass die Mehrheit der Dresdner Rassismus ablehnt."
"Ich wusste, dass die Diskriminierung steigt, aber nicht, dass sie so krass ist. Ich war schockiert", sagt Barbara Irmer. Der Rassismus sitze bei vielen Menschen so tief, das er schon als Normalität empfunden werde. Das sei den meisten Politikern offenbar noch gar nicht klar: "Sie erleben das ja auch nicht. Aber wenn ich mit den Studenten durch Dresden gehe, bekomme ich die ganzen Sprüche mit. Die Menschenverachtung ist in dieser Stadt normal geworden."
"Dresden muss ich mir nicht länger antun"
Nathalie wünscht sich manchmal, dass die Pegida-Anhänger für ein paar Tage in die Rolle eines Flüchtlings schlüpfen müssten. Als Christin finde sie den Anspruch "Liebe Deinen Nächsten" in Dresden schwierig. Manchmal habe sie Wut und müsse sich beherrschen. Innerlich leiste sie dann Buße für ihre Gedanken. In solchen Augenblicken rede sie sich ein, den Dresdnern das Evangelium bringen zu müssen. "Wenn Erwachsene mich beleidigen, sage ich mir: Die sind in ihrer Entwicklung zurückgeblieben und haben das Niveau von Kindern. Mit einem Kind zu schimpfen bringt aber nichts. So lege ich mir das zurecht, um damit klarzukommen."
Dabei könnte Nathalie sich wehren. Als Judoka wäre sie in der Lage, die Alltagsrassisten aufs Kreuz zu legen. Doch das würde wohl alles noch schlimmer machen. Deshalb erträgt sie die Schmähungen und will bis zum Studienabschluss in Dresden bleiben. Eingeschüchtert wirkt sie nicht. Wenn die 25-Jährige erzählt, dass sie mangels Geld ihre Haut nicht bleichen könne wie Michael Jackson und lieber schwarz bleibe, lacht sie selbst am lautesten. Anders als ihre Brüder will sie Dresden nach Abschluss des Studiums aber so schnell wie möglich verlassen: "Dresden muss ich mir nicht länger antun."
Ana ist kürzlich zu Besuch in Frankfurt gewesen. Dort hat sie in einem Supermarkt eine Muslima an der Kasse sitzen sehen - in Dresden wohl eine undenkbare Vorstellung. Seither schwärmt die 32-Jährige für die Stadt am Main. Wie ihre Zukunft aussieht, weiß sie noch nicht genau. Zunächst will sie in Dresden einen Job suchen. "Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt", blickt sie zurück. Dass Menschen sich gerade in einem solch entwickelten Land wie Deutschland so verhalten, findet sie merkwürdig. In Indonesien seien zwar viele Menschen sehr arm und nicht so gut gebildet: "Respekt und Hilfsbereitschaft haben sie aber."
Hemmschwelle für Rassismus sinkt weiter
Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) spricht von einer geteilten Gesellschaft und hebt auch die Arbeit jener hervor, die sich um Migranten kümmern. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) - der mit einer Südkoreanerin verheiratet ist - will das Problem des Rassismus nicht auf seine Stadt begrenzt sehen und erklärt, es gebe auch viel Offenheit gegenüber anderen Kulturen. Dann sagt er: "Das hilft mir aber nicht: Ich bin der Gründungsort von Pegida, die Bühne von Pegida und muss mich damit auseinandersetzen." Die Hemmschwelle für rassistische Äußerungen und öffentlich ausgetragene Pöbeleien gegenüber Ausländern sinke. "Das macht mir Angst."
"Man würde sich besser fühlen, wenn uns mal einer zur Seite stehen würde", sagt Nathalie. Humberto will Dresden trotz allem die Treue halten. Für ihn sei die Stadt, die einen Ausländeranteil von 6,2 Prozent hat, zur zweiten Heimat geworden: "Ich habe nicht vor, aus Dresden wegzuziehen, weil ich hier auch einige der besten und liebevollsten Menschen in meinem Leben gefunden habe. Wenn es nur böse Menschen in Dresden gäbe, wäre ich schon längst weg."