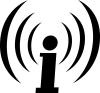Nach einem Angriff durch Neonazis stirbt in Dresden der Mosambikaner Jorge Gomondai. 25 Jahre später ist die Stimmung wie damals: aggressiv. Von Antonie Rietzschel, Dresden
Jorge Gomondai sitzt in der Falle. Gerade ist eine Gruppe Neonazis zu ihm in die Straßenbahn gestiegen. Sie umzingeln den jungen Schwarzen. Sie schubsen ihn von einem zum anderen, schlagen zu. Er versucht ihnen die Hand zu reichen. Doch die Männer hören nicht auf. "Ich fass doch keinen Neger an", wird einer von ihnen später aussagen.
Die Straßenbahn fährt los, als eine der hinteren Türen aufgerissen wird. Jorge Gomondai fällt hinaus, sein linker Fuß bleibt in der Tür stecken. Die Bahn schleift ihn ein Stück mit, bevor er mit dem Kopf hart gegen die Bordsteinkante schlägt. Mehrere Tage liegt er im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen. Am 6. April 1991 stirbt Jorge Gomondai im Alter von 28 Jahren. Ob die Neonazis ihn aus der Tram warfen oder er voller Panik versuchte zu flüchten, ist bis heute nicht eindeutig geklärt.
Gefährliche neue Heimat
Gomondai ist das erste Todesopfer rechtsextremer Gewalt in Dresden nach der Wiedervereinigung. Sein Schicksal ist der weitere Höhepunkt einer grausamen Entwicklung im Osten. Einer Entwicklung, bei der sich Hass gegen Ausländer in Gewalt entlädt. Als rechtsextreme Gruppen Jagd machten auf jeden, der anders aussah oder dachte als sie - größtenteils unbehelligt von Polizei oder Justiz.
25 Jahre sind seit dem Tod von Gomondai vergangen und in Sachsen scheint sich nicht viel geändert zu haben. Ob in den Reihen von Pegida, in Clausnitz oder Heidenau - der Hass ist zurück. Wieder haben Menschen anderer Herkunft Angst, angepöbelt und angegriffen zu werden. Die Flüchtlingskrise katapultiert Sachsen zurück in die dunklen neunziger Jahre.
Jorge Gomondai stammte aus Mosambik. Als enger Handelspartner schickte die einstige Volksrepublik seit 1979 sogenannte Vertragsarbeiter in die DDR. Die mosambikanische Regierung hoffte, gut ausgebildete Fachkräfte zurückzuerhalten, die beim Aufbau des vom Bürgerkrieg zerstörten Landes mithelfen. In der DDR mangelte es an Arbeitskräften, weswegen in den Betrieben nicht nur Mosambikaner, sondern unter anderem auch Vietnamesen oder Kubaner beschäftigt waren. Wie die Flüchtlinge heute lebten sie in speziellen Wohnheimen. In den neunziger Jahren lagen die meist am Rande der Stadt, abgeschirmt vom Rest der Bevölkerung. Es kursierten Gerüchte über die Vertragsarbeiter. Dass vor allem die jungen Männer nur an deutschen Frauen interessiert seien. Oder dass sie in Devisen bezahlt würden, also finanziell besser gestellt seien. Neid und Misstrauen bestimmen auch heute wieder die Debatte, wenn davon die Rede ist, Flüchtlinge bekämen alles geschenkt. Auch das Vorurteil des sexuell übergriffigen Ausländers lebt wieder auf.
Gomondai kam 1981 nach Dresden und arbeitete in einem Schlachthof. Nach der Wende fürchtete er, aus Deutschland abgeschoben zu werden, so wie viele andere Vertragsarbeiter. Er wollte bleiben, auch um seine Familie zu Hause weiter unterstützen zu können. Mosambik zählte bereits Anfang der neunziger Jahre zu den ärmsten Ländern der Erde. Gomondai war nach heutigen Maßstäben ein Wirtschaftsflüchtling. Er wollte sein Glück im wiedervereinten Deutschland suchen, in einer Stadt, die besonders für Ausländer immer gefährlicher wurde. Bundesweit galt Dresden nach der Wende als Neonazi-Hochburg. Die früheren Vertragsarbeiter lebten in ständiger Angst vor Übergriffen: "In der Tram habe ich mich immer in den vordersten Wagen gesetzt, in die Nähe des Fahrers. Wenn es dunkel war, bin ich nicht mehr auf die Straße gegangen - bestimmte Stadtviertel wie Gorbitz oder Prohlis waren nachts komplett tabu", sagt Emiliano Chaimite. Der 49-Jährige spricht ein weiches Deutsch, in das sich ab und zu ein sächsisches "och" statt "auch" schleicht.
Auch Chaimite stammt aus Mosambik und war Vertragsarbeiter in der DDR. Anfang 1991 zog er von Ost-Berlin nach Dresden, um eine Ausbildung als Krankenpfleger zu machen. Er kann sich noch genau an die Stimmung erinnern. An die Angst vor den Neonazis, aber auch an die alltäglichen Anfeindungen. Dass Menschen sich in der Tram von ihm weg setzten. Dass ihn eine alte Dame anzischte, was er noch hier wolle. Ob es irgendwo gebrannt habe, fragte mal jemand wegen seiner schwarzen Haut. Auf der Ausländerbehörde wurde Chaimite konsequent geduzt.
Die Bevölkerung erwartete von Vertragsarbeitern wie ihm, dass sie in ihre Heimat zurückkehrten. Jeder, der bleiben wollte, wurde als potenzieller Konkurrent im Kampf um die wenigen Arbeitsplätze gesehen. "Hinzu kam der Wunsch nach einem neuen Feindbild, nach einem Sündenbock, dem man seine eigene schlechte Situation zuschieben konnte. Die DDR gab es ja nicht mehr", sagt Marita Schieferdecker-Adolph. Nach der Wende war sie die Ausländerbeauftragte der Stadt Dresden. Feindbilder fanden die Menschen nicht nur in den früheren Vertragsarbeitern, sondern auch in den Kriegsflüchtlingen, die Anfang der neunziger Jahre aus Bosnien auch nach Dresden kamen. "Ich habe ja nichts gegen Ausländer - aber diese Asylanten." Diesen Satz hörte Schieferdecker-Adolph in den neunziger Jahren öfter. Heute ist er das Mantra der "besorgten Bürger".
"Jetzt fehlt nur noch eine Fuhre voller Neger"
In der Nacht zum 31. August 1991 warten 14 Neonazis an der Haltestelle Platz der Einheit, heute Albertplatz. Zuvor sind sie durch die Neustadt, das alternative Viertel Dresdens gezogen, haben randaliert und einen jungen Deutschen krankenhausreif geprügelt. Die Neonazis stehen an der Haltestelle, sie sind aufgekratzt. "Jetzt fehlt nur noch eine Fuhre voller Neger, die machen wir platt", soll einer Zeugenaussagen zufolge gesagt haben. "Einer würde schon reichen", soll ein anderer geantwortet haben. Da biegt die Straßenbahn der Linie 7 in die Haltestelle ein. Im hintersten Waggon, ganz allein, Jorge Gomondai.
Die Neonazis steigen ein, sie schlagen ihn, hängen sich an die Haltegurte und machen Urwaldgeräusche. Kurze Zeit später fällt Jorge Gomondai aus dem Waggon. Die Tramwagenfahrerin stoppt, weil sie merkt, dass eine der Türen nicht geschlossen ist. Da liegt der junge Mosambikaner bereits blutüberströmt und bewusstlos auf den Schienen, die Täter sind abgehauen. Herbeigerufene Polizeibeamte glauben, Gomondai sei betrunken und deswegen gestürzt, obwohl Zeugen von dem Handgemenge berichten. Der erste von zahlreichen Fehlern.
Ein Prozess, der keine Aufklärung bringt
Marita Schieferdecker-Adolph kannte Gomondai. Er war manchmal bei ihr zu Gast, in der großzügigen Wohnung mit dem knarzenden Dielenboden im Flur. Im Wohnzimmer steht ein großes Bücherregal mit geschnitzten afrikanischen Figürchen. "Ich hatte Zukunftsängste nach dem Mauerfall", sagt Schieferdecker-Adolph. "Jorge sagte zu mir: 'Worüber machst du dir Sorgen? Du hast Essen, Kleidung, eine Wohnung.'" Als Schieferdecker-Adolph am 6. April 1991 vom Tod ihres Bekannten hört, weint sie.
Die ganze Stadt ist tief getroffen: Wenige Tage nach dem Tod Gomondais versammeln sich 7000 Menschen, um seiner zu gedenken. In der Dresdner Kreuzkirche drängen sich Politiker, Punks, einfache Bürger und Migranten. Viele der offiziellen Redner sprechen die Probleme in der Stadt offen an: Fremdenfeindlichkeit verbunden mit Aggressivität. Der Sprecher der CDU-geführten Staatsregierung in Sachsen hat seine eigene Sicht auf die Dinge: Das Geschehene verdeutliche in "krasser Weise die Schwierigkeiten vieler Menschen, ihren Standort in der freiheitlich-demokratischen Ordnung zu finden". Die Regierung des Freistaates werde sich bemühen, "gesunde, attraktive Alternativen für die Freizeitgestaltung zu finden".
Als die Trauernden aus der Kreuzkirche treten, haben sich dort 100 Rechtsextreme versammelt. "Ausländer raus" schreien sie, rennen auf die Afrikaner zu, darunter auch Emiliano Chaimite. Einige Demonstranten stellen sich schützend vor ihn. "Hätten die uns nicht geholfen, wer weiß, was passiert wäre", sagt Chaimite. Die Polizei greift erst ein, als es zu Auseinandersetzungen kommt.
Die Familie hört keine Entschuldigung
Von der Kreuzkirche aus ziehen die Demonstranten zum Platz der Einheit auf der anderen Elbseite, dorthin wo Jorge Gomondai starb. "Ich hoffe, dass dieser Trauerzug Spuren hinterlässt", sagt Marita Schieferdecker-Adolph damals zu den Anwesenden. In dem Satz liegt viel Hoffnung: auf einen Prozess, der die Umstände des Todes Gomondais restlos aufklärt und die Täter zur Verantwortung zieht. Auf Toleranz und Offenheit statt Gewalt. Auf ein klares Signal der sächsischen Politik. Sie teilt diese Hoffnung mit Emiliano Chaimite. Beide werden enttäuscht.
Die Gerichtsverhandlung im Herbst 1993 bringt weder Aufklärung noch Gerechtigkeit. Von 14 möglichen Tätern werden nur drei angeklagt. Die können sich nach eigenen Angaben an nichts mehr erinnern und schweigen. Frühere Vernehmungsprotokolle sind unbrauchbar, weil sie nicht unterschrieben wurden. Im Publikum sitzen jede Menge Neonazis, die Journalisten anpöbeln und den Hitlergruß zeigen.
Der Prozess wirft ein schlechtes Licht auf die Polizei, die nach dem Sturz Gomondais weder Zeugen befragte noch Spuren sicherte. Ein Zeuge sagt vor Gericht aus, er habe die Beamten aufgefordert, etwas gegen die Rechtsextremen zu unternehmen. Ohne Strafantrag könne man nichts machen, sollen die geantwortet haben. "Da habe ich keine Töne mehr", sagt der Richter. Mit diesen Worten könnte man auch 25 Jahre später das Vorgehen der sächsischen Polizei in Heidenau kommentieren - oder in Clausnitz.
Im Fall Jorge Gomondai werden die Neonazis wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Zwei Angeklagte werden zu jeweils 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Dritte bekommt eine härtere Strafe, weil er nicht nur an der Auseinandersetzung mit Gomondai beteiligt war, sondern zuvor einen jungen Mann in der Neustadt zusammengeschlagen hat. Er bekommt zwei Jahre und sechs Monate.
Die Familie Gomondais erfährt erst 1995 durch ein Filmteam von den Umständen, unter denen ihr Sohn zu Tode kam. Sie lebt noch immer in Mosambik, eine offizielle Entschuldigung hat sie bisher nicht erhalten. Eine Entschädigungszahlung lehnte die Stadt Dresden ab, einige Stadträte sammelten daraufhin privat Spenden.
In den neunziger Jahren gründen sich in Dresden mehrere Initiativen, die sich für die Integration von Ausländern starkmachen wollen, auch auf Betreiben der Ausländerbeauftragten Marita Schieferdecker-Adolph hin, darunter der Ausländerrat und der Sächsische Flüchtlingsrat. Emiliano Chaimite selbst gründet mit anderen Landsmännern einen mosambikanischen Verein. Dennoch bleibt Dresden lange Hochburg der rechtsextremen Bewegung.
Die Neunziger sind zurück
Anfang März 2016, fast 25 Jahre nach dem Tod von Jorge Gomondai, steht Emiliano Chaimite wieder in der Dresdner Kreuzkirche. Dort wo er Anfang der neunziger Jahre seines Landsmanns gedacht hat, versucht er im Rahmen eines Bürgerdialogs ins Gespräch zu kommen mit den Anhängern von Pegida. Der mittlerweile 49-Jährige ist Vorsitzender des Vereins Afropa, einem Netzwerk für Dresdner mit Wurzeln in afrikanischen Ländern. Chaimite erzählt von deren Ängsten. Dass sie ihre Kinder nachts nicht mehr auf die Straße lassen. Dass die Kinder sich in Sportvereinen Sprüche anhören müssen, die er schon aus den neunziger Jahren kennt: "Hat man dich lackiert und dabei die Hände vergessen?"
Ausgebuht und ausgelacht
Chaimite hatte sich vor der Entstehung von Pegida endlich willkommen in Dresden gefühlt. Die üblichen Pöbeleien auf der Straße waren weniger geworden. "Ich dachte, wir hätten es geschafft." Chaimite hatte gehofft, seine Stadt hätte sich befreit von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Jetzt hat auch er wieder Angst. Er rechnet mittlerweile jeden Tag damit, dass er überfallen wird. Wieder gibt es Orte, an die er sich nachts nicht trauen würde. Der Stadtteil Prohlis gehört weiterhin dazu. Aber auch das bürgerliche Dresden-Laubegast, wo Stimmung gegen ein geplantes Asylbewerberheim gemacht wurde. Emiliano Chaimite erzählt von all dem in der Kreuzkirche. Die Anhänger von Pegida reagieren mit Gelächter und Buhrufen.
Auch Marita Schieferdecker-Adolph besucht die Bürgerdialoge. Die 70-jährige Rentnerin ist immer noch in zahlreichen Initiativen aktiv. Viele kennen sie in der Stadt - auch ihre Gegner. In den vergangenen Jahren musste sie sich öfter Beschimpfungen gefallen lassen. "Ich weiß, wo Sie wohnen", sagt einer der Pegida-Anhänger während des Bürgerdialogs zu ihr. "Es ist wieder wie früher. Da frage ich mich als Ausländerbeauftragte, was ich falsch gemacht habe und was insgesamt schiefgelaufen ist", sagt Schieferdecker-Adolph.
Die Hauptverantwortung sieht sie ganz klar bei der sächsischen Regierung, die seit der Wende von der CDU dominiert wird. Aus ihrer Sicht hätte die damals nach dem Tod von Jorge Gomondai die Weichen stellen können. "Damals hat eine klare Ansage gefehlt, dass nicht die Ausländer das Problem sind, sondern unsere Gesellschaft. Dass es bestimmte Werte gibt, an die man sich zu halten hat", sagt sie. Aus ihrer Sicht seien unter den Rechtsextremen viele Mitläufer gewesen, die man noch hätte abholen können. "Die Probleme waren offensichtlich", sagt auch Emiliano Chaimite. "Aber der politische Wille etwas zu ändern war nicht da."
Ein Zufall, dass bisher nichts passiert ist
Tatsächlich mussten 25 Jahre vergehen, bis sich die sächsische Regierung erstmals eingesteht, dass es in Sachsen ein Problem mit Rechtsextremismus und Rassismus gibt. Es scheint, als habe sie Jorge Gomondai vergessen. Im Gegensatz zu Emiliano Chaimite und Marita Schieferdecker-Adolph. Jedes Jahr treffen sie sich an dem orangefarbigen Sandstein in der Nähe des Albertplatzes. Dort wo Jorge Gomondai aus der Bahn fiel. In diesen Zeiten seiner zu gedenken, finden sie wichtiger denn je. "Ein solcher Todesfall darf sich nicht wiederholen", sagt Emiliano Chaimite. Er macht sich ernste Sorgen, dass sich das Schicksal Gomondais wiederholt. Dass noch nichts passiert sei? "Reiner Zufall", sagt Marita Schieferdecker-Adolph.
Tipp: Der eindrucksvolle Dokumentarfilm "Jorge" von Matthias Heeder und Monika Hielscher beschreibt Dresden in den neunziger Jahren und die Umstände, unter denen Gomondai starb.