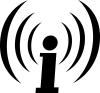Nach dem Mauerfall wurden in Ostberlin weit über 120 Häuser besetzt. Nur wenige von ihnen gibt es heute noch. Was ist von ihrem politischen Anspruch geblieben?
Mainzer Straße, Herbst 1990:
Boulevard der Hausbesetzer. Verschmutzte, bröckelnde Häuserfassaden. Bunt bemalte Fensterrahmen, an denen Transparente hängen. Darauf steht “Anarchie statt Deutschland“ oder „Die Häuser denen, die drin wohnen“. Die Mainzer Straße, sie steht für etwas: für Unzufriedenheit, für das Neu- und Andersmachen nach dem Mauerfall. Für die Zuversicht, dass die Welt nicht bleiben muss, wie sie ist. Und für das Bewusstsein, dass man sie selbst zu ändern hat. Das ist der Geist dieser Straße.
Mainzer Straße, 25 Jahre später:
Bistros, chinesische Heilmedizin, hipper Plattenladen. Eine bürgerliche Idylle in Pastellfarben. Modernisierte Altbauten, Sauberkeit, Ruhe, Ordnung. Keine Transparente, keine Anarchie. Wo Hausbesetzer einst Barrikaden bauten, steht nun die E-Klasse am Straßenrand. An der Ecke erzählt ein Stadtführer jungen Touristen von damals, als Tausende Polizisten die Häuser räumten. Irgendein Nostalgiker hat sich an einer weiß getünchten Wand verewigt: „Mainzer lebt!“, hat er dort hingeschrieben.
Doch die wilde „Mainzer“ lebt nicht mehr. Die Rebellen und Aussteiger mussten sie verlassen. Sie gingen in andere Viertel, zu anderen linken Hausprojekten. In der Mainzer Straße gibt es heute kein einziges Hausprojekt mehr. 1990 waren es in ganz Ostberlin noch weit über 120. Übrig geblieben ist deutlich mehr als die Hälfte. Sie konnten sich legalisieren.
Aber lebt in ihnen der Geist der Mainzer Straße weiter?
Wie politisch sind Berlins Hausprojekte?
Es ist ein trüber Nachmittag in Friedrichshain. Im Gemeinschaftsraum der Kreutzigerstraße 23, einen Steinwurf von der Mainzer Straße entfernt, sitzen Grit Angermann, Alfons Kujat und AB, der sich lieber mit seinen Initialen als mit seinem bürgerlichen Namen rufen lässt. Zwei Holztische haben sie im Gemeinschaftsraum zusammengeschoben, nur zwei leere Kerzenbecher aus rotem Plastik stehen darauf. An der einen Wand befindet sich eine Reihe brauner Kinositze, an der anderen verhüllt ein schwarzer Vorhang eine kleine Bühne. Im Raum nebenan produziert AB Sendungen für „Radio F-Hain“, einer Kiezsendung des nichtkommerziellen Radioprojekts „88vier“.
Häuser gehören Bewohnern
Angermann hatte früher schon ein Haus nebenan mitbesetzt, AB die Nummer 23, Alfons zog später dorthin nach. Ihre Ziele: leben, wohnen und arbeiten unter einem Dach. Heute gehören den Bewohnern die Häuser. Gekauft haben sie sie als „Selbstverwaltete Ostberliner Genoss*innenschaft“, die dem Markt Wohnraum entziehen und diesen unter Selbstverwaltung stellen will.
Aktuell umfasst die Genossenschaft fünf Projekte, zuletzt half sie beim Kauf der Reichenberger Straße 63 in Kreuzberg.
AB und Angermann tragen Schwarz. Wären sie beide nicht in die Jahre gekommen, könnte man sie sich problemlos im „Schwarzen Block“ vorstellen. Kujat, gemütlicher Typ, grauer Bart, tiefes Lachen, trägt mehr Farbe. Er hat ein Buch über seine Demo-Erfahrungen am 1. Mai geschrieben, ist Regisseur und Schauspieler.
Für ihn hat die Räumung der Mainzer Straße gezeigt, dass sich der Politikstil der Hausprojektszene ändern muss. Die Arme verschränkt, spricht er über die Rigaer Straße 94, das letzte zentrale linksradikale Hausprojekt der Stadt, das nur einen kurzen Fußmarsch entfernt ist. In dessen Umfeld kam es zuletzt immer wieder zu Attacken, etwa auf benachbarte Eigentumswohnungen und auf die Polizei.
Alfons Kujat: „In der Rigaer Straße stehen sich militante Autonome und zugezogene Mittelstandsbürger feindlich gegenüber. Ich bezweifle, dass das der richtige Weg ist. Solch eine Konfrontation ist keine Grundlage für einen breiten sozialen Widerstand, der diejenigen schützt, die nicht zu einer der beiden Gruppen gehören: Menschen, denen Wasser und Heizung abgedreht werden. “
AB: „Aber ich kann die Autonomen dort verstehen. Schau doch bei uns über die Straße: ein modernes Haus, schicke Eigentumswohnungen. Mit denen will ich auch nichts zu tun haben. Wir haben auch schon welche zum Auszug gebracht, weil wir sie spüren ließen, dass sie hier nicht erwünscht sind.“
Alfons Kujat: „Stimmt. Ein Pärchen hat unser Straßenfest fotografiert und sich beim Bezirks amt beschwert. Sie hätten so viel investiert, diesen Schmutz wollten sie nicht haben.“
Grit Angermann: „Genau deswegen bin ich für jede dreckige Ecke dankbar, die die Aufwertung der Umgebung hemmt. Wir Besetzer waren die Trüffelschweine, die den Kiez attraktiv gemacht haben. Es ist zum Heulen, wie er sich entwickelt hat.“
AB: „Wir haben das nicht verhindern können, darin haben wir versagt. Den direkten Einfluss auf unsere Nachbarschaft haben wir verloren. Wir wirken eher indirekt. Hier gibt es einen Mieterladen, Voküs, Deutschkurse für Flüchtlinge. Und unsere Genossenschaft wächst, es gibt mehrere Anfragen im Monat von Gruppen, die ihre Häuser wie wir selbst verwalten wollen. Mit den Mietüberschüssen könnten wir bald eine Stiftung gründen.“
Grit Angermann: „Und: Wir leben das, wovon andere träumen. Wir sind eine wirkliche Hausgemeinschaft: 30 Leute, eine Küche.“
Die eigene Lebensform mit der Genossenschaft propagieren, günstigen Raum bieten für Gruppen, die ihn brauchen – die politischen Ziele der einstigen BesetzerInnen in der Kreutzigerstraße liegen nicht mehr direkt vor der Haustür. Auch deshalb, weil sie den konkreten Zugang zum Kiez nicht mehr haben. Die bunt bemalten Hausprojekte in der Kreutzigerstraße – sie sind die Farbkleckse in einer bürgerlich gewordenen Umgebung, die die Rebellen von damals nicht mehr versteht. Die Kluft zwischen Hausprojekten und Umfeld wird von Jahr zu Jahr größer.
Noch deutlicher zeigt sich diese Entwicklung in Mitte.
Donnerstagabend: Treffen mit Christiane und Holger, die ihren vollen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen wollen. Zwei aus der Generation, die erst seit wenigen Jahren in den ehemals besetzten Häusern lebt. Sie wohnen in der Brunnenstraße 6/7, besetzt im Sommer 1990, im darauffolgenden Frühjahr mit Mietverträgen ausgestattet. Ein dunkles, auf den ersten Blick unauffälliges Tor führt von der Straße in die beiden Hinterhöfe des Hauses. An den bunten Wänden prangen Graffiti, Street-Art und Transparente. Eines davon fordert: „Miethaie ins Klo. Unsere Brunnen bleibt dreckig.“
In der Brunnen 7 wohnen circa 90 Menschen in WGs mit bis zu 14 Bewohnern. Hier wird auf Hausplenen demokratisch entschieden, etwa wie mit dem Obdachlosen, der seit Tagen im Hof schläft, umzugehen ist. Weil das Projekt so groß ist, agieren die Wohngemeinschaften relativ autonom und können ihre Monatsmieten organisieren, wie sie möchten.
Auf ihrer „antikapitalistisch motivierten Insel“ haben sich die BewohnerInnen ein Leben eingerichtet, das sich von dem abhebt, das außerhalb der Höfe geführt wird. Dort, gleich neben der Brunnen 7, verkaufen Boutiquen Kleidung, an der kein Preisschild hängt, verwaltet eine Agentur die umliegenden Ferienwohnungen und schlagen sich Berlins Hipster Tage und Nächte um die Ohren. Wer hier wohnen will, muss laut Immobilienportalen weit mehr als 10 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter zahlen.
„Wenn ich auf die Straße gehe, fühlt sich das an, als beträte ich eine andere Welt“, sagt Holger.“
Juristin im Hausprojekt
Der 27-Jährige ist im Kiez aufgewachsen, trägt Brille und kurz geschorenes Haar. Christiane, 38, mit Mantel und Kette, ist Juristin. Schmunzelnd bemerkt sie, dass sie damit nicht gerade dem Klischee einer linksradikalen Hausprojektbewohnerin entspricht. Den Reporter treffen die beiden lieber außerhalb der Wohnung, sonst hätte man von mehreren WGs die Zustimmung einholen müssen.
Die Brunnen 7, so erzählen sie, sei das letzte von einst drei Hausprojekten in der Straße. Ihre Bewohner hatten über Jahre hinweg mit dem Eigentümer, der Grundstücksverwaltung Gawehn, zu kämpfen. Zuletzt wollte er Mieterhöhungen durchsetzen, scheiterte damit aber im März dieses Jahres vor Gericht. Wie viele andere Häuser beschäftigt auch die Brunnen 7 der Kampf ums eigene Überleben. Aber genügt das den eigenen politischen Ansprüchen?
Christiane: Natürlich haben wir den Anspruch, nicht nur ein internes Projekt zu sein, sondern zumindest stellenweise nach außen zu wirken. Wir steuern Redebeiträge auf Demos bei, bieten Schlafplätze für Nichtberliner, die zum Demonstrieren kommen. Unser Blog, das wir betreiben, und unsere Hausfassade sollen das unterstreichen.
Holger: Wir können ja gar nicht anders als politisch sein. Wir sind in die Mietenkämpfe der Stadt involviert. Ein Hausprojekt, das in solche Kämpfe nicht involviert ist oder nicht nach außen wirken will, ist für mich keines. Als politischer Akteur wollen wir beispielgebend sein in der Nachbarschaft. Allerdings verändert sich der Kiez hier so schnell, dass wir da tendenziell auf verlorenem Posten stehen.
Christiane: Mag sein. Aber auch unser Szenehabitus macht es eben schwierig, mit der Nachbarschaft in Kontakt zu treten.
Holger: Ich würde eher sagen, der Kiez interessiert sich nicht für uns. Ein Großteil der ehemaligen Mitte-Bewohner wurde verdrängt, und die Generation Bausparvertrag, die nachgezogen ist, hat vor allem ihresgleichen im Blick. Das eigentliche Problem, das nicht nur die Bewohner der Hausprojekte haben, ist für mich ein anderes: Sie haben es nicht geschafft, die Radikalität der Mainzer Straße im Denken und Handeln ins Heute zu retten. Damals war es beispielsweise selbstverständlich, leer stehende Häuser zu besetzen, sich zu nehmen, was einem zusteht. Das ist leider verloren gegangen.
Christiane: Trotzdem ist es wichtig, dass es solche Häuser gibt. Wenn wir Dinge verändern wollen, braucht es kollektive Strukturen. Und die haben wir in unserem Hausprojekt. Leute, die bei uns wohnen, engagieren sich beispielsweise in feministischen, antirassistischen und kapitalismuskritischen Initiativen oder der Antifa.
Holger: Das gemeinsame Leben schafft Kapazitäten für unsere jeweiligen, oft unterschiedlichen politischen Aktivitäten. Unser Haus, das bedeutet eben Freiraum und Gemeinschaftlichkeit. Auch wenn das jetzt sehr kitschig klingt. Dabei ist das sehr ernst gemeint: Wir wollen die Frage nach dem gemeinsamen Leben wieder politisieren, die Vereinzelung überwinden.
Freiraum, Gemeinschaft, ein bisschen dreckig sein, wenn die Umgebung zu sauber ist – das wirkt anziehend auch auf diejenigen, die wohl nie so leben würden. Viele Touristen bestaunen die bunten Fassaden des Hausprojekts, fotografieren sich in den coolen Hinterhöfen. Dort, wo sich der Geist der Mainzer Straße versteckt, ist er zum Selfie-Motiv verkommen.
Das mag bitter sein, doch sind Berlins Hausprojekte vielleicht nicht ganz unschuldig daran – stellenweise scheint ihnen der Weltbezug abhandengekommen zu sein. Oder warum leben sie sonst so isoliert in den Kiezen? Die Hausprojekte wollen die Revolution, doch fehlen ihnen wohl die Vokabeln, um sie für alle verständlich und überzeugend zu erklären. Und so verkommen die Parolen, Transparente und Graffiti oft zu kommunistischer Folklore.
Aber wie weit sollte man der Welt, die man nicht mag, entgegenkommen?
Diese Frage hat man sich wenige Straßenecken weiter auch schon gestellt und eine Antwort gefunden. Sie lautet: Besser gar nicht. Kastanienallee 77, Prenzlauer Berg. Das hellgrüne Haus ist im Besitz einer Stiftung, die es an die Bewohner verpachtet hat. Es ist eines der ältesten im Viertel. Mit seinen zwei Stockwerken zwischen den viel höheren Nachbarhäusern wirkt es fast wie eingeklemmt.
Die Kommune kocht
Freitagabend in der „K77“, Carola Grimm schneidet Zwiebeln und Knoblauch für den Auberginenauflauf, ihr Ko-Koch Florian Hülsey kümmert sich um den panierten Fisch. Hin und wieder huscht ein Kind durch die schlauchförmige Küche, das entweder helfen oder getröstet werden will. Die Kochtöpfe und Pfannen sind breiter als in vielen anderen Küchen, die Lebensmittelmengen größer. Hier kocht man für bis zu 20 Erwachsene und 10 Kinder – eben für die ganze Kommune.
1992 wurde das Haus besetzt. Seither wird hier das meiste geteilt, die Räume werden je nach Bedürfnis immer wieder getauscht, einmal wöchentlich werden Entscheidungen im Konsens getroffen, auch darüber, wer einziehen darf und wer nicht. Jeden Tag kocht eine Gruppe für den Rest. Und wenn alle an der langen Tafel zusammensitzen, dann wirken sie tatsächlich wie eine ziemlich große Familie.
In der Küche hat Grimm den Auflauf in den Ofen geschoben. Die 50-Jährige mit zerzaustem dunkelblondem Haar und türkisfarbener Schürze schenkt sich ein Glas Bier ein – kurze Pause vom Kochstress. Carola ist eine der wenigen im Haus, die seit der Besetzung darin wohnen. Hier sind ihre drei Kinder aufgewachsen, hier arbeitet sie in einer Keramikwerkstatt. Hier lebt sie das Leben, das sie sich wünscht. Aber ist dieses Leben noch politisch? Oder hat sich die Szene in ihren gemütlichen Kokon zurückgezogen? Hülsey, zweifacher Vater, hält die K77 nicht für unpolitisch. Während er spricht, wendet er in der Pfanne den Kabeljau.
Florian Hülsey: „Natürlich wollen wir uns einmischen und hängen auch Transparente an die Fassade, wenn uns eine Sache am Herzen liegt. Aber wir verspüren hier kein Sendungsbewusstsein. Wir leben zwar, wie wir leben, und finden das auch richtig – aber ich glaube nicht, dass sich die Probleme der Welt dadurch lösen. Wir wollen niemandem unsere Lebensform aufzwingen.“
Carola Grimm: „Es hat sich alles etwas privatisiert, das stimmt schon. Das Netzwerk zwischen den Häusern ist schwächer geworden. Vielleicht war man zu sehr mit dem Überleben beschäftigt. Ich selbst bin auch nicht mehr politisch eingebunden. Aber wahrscheinlich sind wir am politischsten, wenn wir einfach wir selbst sind. Wenn wir zeigen, dass diese Art, zu leben, möglich und nicht nur was für junge Menschen ist. Das zu vermitteln ist natürlich nicht einfach, weil wir die nötige Öffentlichkeit nicht mehr herstellen können. Der Kontakt mit dem Kiez wird immer mühsamer: Als beispielsweise die Fast-Food-Läden in unserer Straße auftauchten, kam zu unserer Vokü niemand mehr. In der selbst verwalteten Kita, die unsere Kinder besucht haben, sind jetzt viele Kinder der reichen Eltern aus dem Kiez, die mit dem Gedanken der Selbstverwaltung ansonsten nicht viel anfangen können. Ob wir aber über unsere Hofoptik hinaus nach außen wirken – ich weiß es nicht. “
Die K77 lässt die Welt lieber in Ruhe. Auch weil sie erfährt, wie die eigenen, linken Strukturen problemlos ins bürgerliche Umfeld und in den Tourismus integriert werden. Während Grimm und Hülsey für die Kommune kochen, feiern im Hinterhof Eltern und Kinder aus dem Viertel am Lagerfeuer ein Laternenfest. Später am Abend kehren die meisten wieder in ihre eigene Welt zurück. Eine Welt, in der keine Transparente an der Häuserwand hängen.
Die Welt bekämpfen
Es ist ein melancholisches Bild, das die ehemals besetzten Häuser Ostberlins abgeben – zumindest diese, die ihre Türen öffnen. Anderswo, in der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain etwa, möchte man mit der Presse erst gar nichts zu tun haben, werden Anfragen ignoriert. Dort will man sich anscheinend nicht von der Welt abwenden. Dort will man sie bekämpfen. Bloß nicht so enden wie die Mainzer Straße, sondern schön dreckig bleiben.