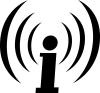Es ist eine schlichte kurze Zeitungsnotiz, zu einem Thema, das im Baskenland mittlerweile keine große Aufmerksamkeit mehr erregt, die aber im spanischen Staat undenkbar wäre: ehemalige Leute von ETA und Angehörige von ETA-Opfern diskutieren zusammen, öffentlich. Dabei sind oft auch Angehörige von Opfern von Polizeigewalt oder von Terrorschwadronen, die von staatlicher Seite organisiert waren. Diese Tagungen sind in ihrer Zusammensetzung beachtlich, was deutlich macht, wie weit der Prozess der gegenseitigen Verständigung im Baskenland fortgeschritten ist, und wie sich diese gesellschaftliche Reife von der nach wie vor vorherrschenden Rache- und Vergeltungsmentalität im Staat abhebt:
“Opfer und Ex-Gefangene von ETA und Politiker nehmen Teil an den Veranstaltungen mit dem Titel ‘Zusammenleben in Bidasoa‘, organisiert vom Radiosender Antxeta Irratia in Zusammenarbeit mit der Organisation zur Vermittlung von Konflikten, Lokarri. Die erste Veranstaltung findet am 5.Februar in Hondarribia statt. Dabei sind Belén Zabala, die Nichte von Josu Zabala, der 1976 von der Guardia Civil erschossen wurde; Cristina Sagarzazu, Witwe des Ertzaintza-Polizisten Montxo Doral, von ETA 1996 umgebracht; José Miguel Gómez Elosegi, Bruder von Francisco Javier Gómez Elosegi, Gefängnis-Psychologe von Martutene, 1988 ermordet; sowie Fermin Urtizberea, ehemaliger Stadtrat, der von einer Ultragruppe entführt worden war. Die zweite Veranstaltung findet am 12.Februar in Hendaia statt (frz: Hendaye). An ihr nehmen Teil der Pfarrer Joserra Treviño, der verurteilt wurde, weil er in seiner Kirche ETA-Flüchtlinge versteckt hatte; daneben der Ex-Gefangene Juan Ramón Rojo; der ehemalige Flüchtling Jokin Etxebarria; sowie die Anwältin Miren Illarreta. Am 19.Februar in Irun treffen sich die Bürgermeister der beiden Städte, Hondarribia und Hendaia, zur Diskussion.“
Solche Verständigungs-Treffen gibt es bereits seit Jahren im Baskenland, obwohl das definitive Ende des bewaffneten Konflikts erst vier Jahre zurück liegt. Der erste Schritt waren von Vermittlern begleitete geschlossene Treffen, nun wird immer mehr die Öffentlichkeit mit einbezogen. Im Zentrum dieser Treffen und Diskussionen stehen die Komplexe “Anerkennung des verursachten Schadens und Leidens“ und die Verarbeitung des Verlusts von Angehörigen. Die Erfahrung der nach wie vor offenen Wunden aus dem Spanischen Krieg von 1936 macht deutlich, wie wichtig diese aktuellen Versuche sind, Aspekte des bewaffneten Konflikts aufzuarbeiten, auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Nicht zu verwechseln mit der politischen Ebene. Verständigung muss stattfinden ohne politische Nivellierung, ohne Verzicht auf die eigene Identität. Die baskische Linke und ETA selbst haben mehr als ein Mal öffentlich deutlich gemacht, dass sie sich bewusst siind, dass ihre politische Aktion persönlichen und moralischen Schaden angerichtet hat. Im Baskenland wird das zur Kenntnis genommen – im Staat nicht. Dort werden von ETA-Gefangenen Reue, Abschwören und eine Reihe weiterer Kniefall-Gesten gefordert, letztendlich die Aufgabe jeglicher politischer Identität. Der SORTU-Politiker Pernando Barrena sagte zu diesem Thema kürzlich: “Reue und Denunziation sind Grenzen, die ein politischer Gefangener nicht überschreiten kann“. Solche Feststellungen waren in der vergangenen Zeit selten zu hören aus dem Mund abertzaler Politiker/innen. Sicher geschuldet der massiven spanischen Kampagne, mit der weiterhin jede kritische Äußerung zum Thema mit dem Totschlagsparagrafen “Verherrlichung von Terrorismus“ verfolgt wird. Bisher hat Barrena keine Anzeige erhalten wegen seiner Äußerung. Erstaunlich.
Veranstaltungen wie die in Hondarribia oder Hendaia sind in Madrid nicht denkbar, sie würden angegriffen oder gesprengt, von Angehörigen der ultrarechten Opferverbände oder direkt von Neonazis, im besten Fall könnten sie unter Polizeischutz stattfinden.